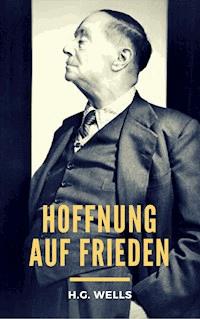Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mantikore-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Als sich außerirdische Flugobjekte der Erde nähern, erfahren die Menschen, dass sie nicht allein im Universum sind. Die Fremden sind den Erdbewohnern technisch weit überlegen und machen schnell klar: sie kommen nicht in Frieden. Als die Invasion der Erde beginnt, entbrennt ein Krieg, bei dem nicht weniger auf dem Spiel steht als das Überleben der gesamten Menschheit… Der Krieg der Welten (Original: The War of the Worlds) ist eines der bekanntesten Werke von H. G. Wells. Der erstmals 1898 erschienene Roman über die Invasion der Erde durch Außerirdische ist nach beinahe 120 Jahren immer noch von kultureller und literarischer Bedeutung und beeinflusste zahlreiche fiktionale Werke - angefangen bei Orson Welles' berühmtem Hörspiel von 1938 bis hin zu modernen Interpretationen wie Jeff Waynes "The Musical Version of The War of the Worlds" sowie Roland Emmerichs Blockbuster "Independence Day" und dem Kinoerfolg "Krieg der Welten" von Steven Spielberg aus 2005. Wir freuen uns, diesen bahnbrechenden Roman nun in einer neuen Übersetzung vorlegen zu können, und hoffen, dass das Werk auch weitere Generationen inspirieren wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
H. G. Wells
KRIEG DER WELTEN
ROMAN
Titel der englischen Originalausgabe:THE WAR OF THE WORLDS
Mit einem Vorwort von Joachim Körberund Illustrationen von Hauke Kock
1. AuflageVeröffentlicht durch denMANTIKORE-VERLAG NICOLAI BONCZYKFrankfurt am Main 2017www.mantikore-verlag.de
Copyright © der deutschsprachigen AusgabeMANTIKORE-VERLAG NICOLAI BONCZYKText © H.G. Wells 1898
Deutschsprachige Übersetzung: Jan EnselingLektorat & Korrektorat: Felix Heitmann & Michael L. JaegersSatz: Karl-Heinz ZapfCovergestaltung: Slobodan Cedić & Matthias Lück
VP: 139-108-01-04-0117
ISBN: 978-3-945493-85-4
KRIEGDER WELTEN
H. G. Wells
Inhalt
HERBERT GEORGE WELLS
KRIEG DER WELTEN
H. G. WELLS
VORWORT
ERSTES BUCH DIE ANKUNFT DER MARSIANER
KAPITEL EINS Am Vorabend des Krieges
KAPITEL ZWEI Die Sternschnuppe
KAPITEL DREI Auf Horsell Common
KAPITEL VIER Der Zylinder öffnet sich
KAPITEL FÜNF Der Hitzestrahl
KAPITEL SECHS Der Hitzestrahl auf der Chobham Road
KAPITEL SIEBEN Wie ich mein Haus erreichte
KAPITEL ACHT Freitagnacht
KAPITEL NEUN Der Kampf beginnt
KAPITEL ZEHN Inmitten des Sturms
KAPITEL ELF Am Fenster
KAPITEL ZWÖLF Was ich von der Zerstörung von Weybridge und Shepperton sah
KAPITEL DREIZEHN Wie ich dem Vikar begegnete
KAPITEL VIERZEHN In London
KAPITEL FÜNFZEHN Was in Surrey geschah
KAPITEL SECHZEHN Der Auszug aus London
KAPITEL SIEBZEHN Die „Thunder Child“
ZWEITES BUCH DIE ERDE UNTER DER HERRSCHAFT DER MARSIANER
KAPITEL EINS Begraben
KAPITEL ZWEI Was wir aus unserem zerstörten Haus sahen
KAPITEL DREI Die Tage der Gefangenschaft
KAPITEL VIER Der Tod des Vikars
KAPITEL FÜNF Die Stille
KAPITEL SECHS Die Arbeit von fünfzehn Tagen
KAPITEL SIEBEN Der Mann auf Putney Hill
KAPITEL ACHT Totes London
KAPITEL NEUN Trümmer
KAPITEL ZEHN Der Epilog
HERBERT GEORGE WELLS
H. G. Wells (1866-1946) ist neben Jules Verne vermutlich einer der bekanntesten Science-Fiction-Autoren des 19. Jahrhunderts. Nicht nur schrieb er als „Vater der Science Fiction“ eine Reihe von Werken, die heute als Klassiker bezeichnet werden, sondern legte in ihnen auch sein Denken und seine Philosophie nieder.
Zu seinen bekanntesten Werken zählen Die Zeitmaschine, Die Insel des Dr. Moreau, Der Unsichtbare, Der erste Mensch auf dem Mond und nicht zuletzt Krieg der Welten, dessen Einfluss auch heute noch spürbar ist. Er wurde vier Mal für den Literatur-Nobelpreis nominiert.
Wells starb am 13. August 1946 im Alter von 79 Jahren.
KRIEG DER WELTEN
Eine der bekanntesten Werke von H. G. Wells ist der 1898 erstmals in Buchform erschienene Roman Krieg der Welten (Original: The War of the Worlds). Die Geschichte über die Invasion der Erde durch kriegerische Außerirdische vom Mars ist an der Oberfläche recht gradlinig. Sieht man jedoch genauer hin, erkennt man gerade in diesem Werk, wie sich Sozialdarwinismus, Kritik am Imperialismus sowie der Gegensatz von Wissenschaft und Religion vermischen, alles aus dem Blickwinkel einfacher Menschen, die dem Ende ihrer Zivilisation entgegensehen.
Der Roman ist nach fast 120 Jahren immer noch von kultureller und literarischer Bedeutung und beeinflusste zahlreiche fiktionale Werke – angefangen bei Orson Welles‘ berühmtem Hörspiel von 1938 bis hin zu modernen Interpretationen wie Jeff Waynes The Musical Version of The War of the Worlds und Roland Emmerichs Independence Day.
Wir freuen uns, Ihnen – unseren treuen Lesern – diesen bahnbrechenden Roman nun in einer neuen Übersetzung vorlegen zu können, und hoffen, dass das Werk auch weitere Generationen inspirieren wird.
H. G. WELLS
VORWORT
Den Briten H. G. Wells und den Franzosen Jules Verne bezeichnet man gemeinhin als die beiden Väter der modernen Science-Fiction. Nicht zu Unrecht – beide haben für das Genre bahnbrechende Werke veröffentlicht, und dennoch stehen sie jeweils für zwei ganz unterschiedliche Spielarten des damals noch so genannten „Zukunftsromans“.
Jules Verne ist der Vertreter der antizipatorischen Science-Fiction; in seinen Romanen bemüht er sich, auf Grundlage des naturwissenschaftlichen Erkenntnisstandes seiner Zeit, mögliche technische Entwicklungen in die mehr oder weniger nahe Zukunft zu extrapolieren. Das tut auch H. G. Wells in gewissem Maße (etwa in Erzählungen wie „The Land Ironclads“), doch bei Wells bleibt stets ein anderes, wichtiges Element im Vordergrund, nämlich die Frage nach den sozialen Auswirkungen, die mögliche technische Entwicklungen mit sich bringen.
Beim Realisten Verne finden sich keine Außerirdischen – über deren Existenz zwar auch damals schon spekuliert wurde, die jedoch wissenschaftlich als nicht gesichert galt. H. G. Wells hat zwei bedeutende Romane über Außerirdische vorgelegt. Sowohl Verne wie auch Wells schicken ihre Protagonisten auf eine Reise zum Mond – Verne in De la terre à la lune1 (1865) und dem Folgeband Autour de la lune2 (1870), Wells in The First Men in the Moon3 (1901). An diesen Büchern lassen sich die unterschiedlichen literarischen Ansätze auch schön verdeutlichen. In Vernes Romanen wird eine Mondrakete aus einem Projektil geschossen, was damals durchaus im Bereich des Möglichen schien, bei H. G. Wells hebt das Raumschiff zum Mond mit Hilfe eines Metalles auf, das die Schwerkraft aufhebt. Was auch prompt das Missfallen des „Naturwissenschaftlers“ Verne erregte; sein empörter Ausruf, „Er möge mir dieses Metall zeigen, der Herr Wells!“ ist überliefert. Tatsächlich ist Wells’ Erklärung aus wissenschaftlicher Sicht Humbug – was Jules Verne freilich übersieht, ist die Tatsache, dass es Wells gar nicht um eine realistische Möglichkeit von Reisen ins Weltall geht; und während Vernes Protagonisten ganz auf dem Boden der Tatsachen einen leblosen Himmelskörper umrunden und zur Erde zurückkehren, landen Wells’ Mondreisende auf dem Erdtrabanten und finden eine Zivilisation von Seleniden vor.
Bedeutender ist Wells’ anderer Roman über Außerirdische, das bereits 1898 erschienene The War of the Worlds4, der auch sehr viel erfolgreicher war als The First Men in the Moon und der bedeutendere der beiden ist. Das Buch erlebte mehrere Adaptionen – berühmt und legendär dürfte die Hörspieladaption von Orson Welles sein, die bei der Erstausstrahlung eine Massenpanik ausgelöst haben soll, da viele sie für bare Münze nahmen. 1953 verfilmte Regisseur Byron Haskin das Buch, 2005 kam eine nicht sehr überzeugende Filmfassung von Steven Spielberg in die Kinos. Der enorme Erfolg dieser Adaptionen hat heute ein wenig den Blick auf den ursprünglichen Roman verstellt, der ihnen zugrunde liegt, was schade ist, denn es handelt sich dabei tatsächlich um ein in mehrerlei Hinsicht bedeutendes Werk.
Der Planet Mars hat früh eine Faszination auf Wells ausgeübt, was sich etwa an einer Vorlesung mit dem Titel „Are the Planets Habitable?“5 äußert, die er 1888 gehalten hat, aber auch an einem Essay, „Intelligence on Mars“6 (1896). Beide zeigen, dass Wells durchaus mit den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen seiner Zeit vertraut war – nur ist sein literarischer Ansatz, wie oben schon erwähnt, ein völlig anderer. In Wells’ Roman, landen marsianische Raumschiffe im beschaulichen, ländlichen England und beginnen unverzüglich damit, die Menschen auszurotten – ein Sachverhalt, den die Meisten für schlichtweg unmöglich halten, und selbst der Protagonist und Erzähler des Romans weigert sich, allen augenscheinlichen Beweisen des Gegenteils zum Trotz, daran zu glauben, dass tatsächlich etwas Ungewöhnliches oder gar Katastrophales im Gange sein könnte.
(Man mag erwähnen, dass The War of the Worlds damit letztendlich in einer recht langen Reihe von damals in Großbritannien erschienenen und viel gelesenen „Invasionsromanen“ steht, in denen Schriftsteller eine Invasion Englands durch fremde Mächte vor Augen geführt haben; das bekannteste Beispiel dürfte George Chesneys 1871 erschienenes The Battle of Dorking7 sein; nur sind es in Wells’ Roman eben nicht Deutsche oder Angehörige irgendeiner anderen Nation, die in England einfallen, sondern Außerirdische - ein Kunstgriff, der, wie man noch sehen wird, Wells sehr viel mehr literarische Möglichkeiten eröffnet.)
H. G. Wells’ Roman erschien in der Spätphase der Viktorianischen Epoche, einer Ära, in der Großbritannien seine wirtschaftlich wie kulturell größte Blütezeit erlebte. Aber wie einigen Zeitgenossen, scheint auch Wells klar gewesen zu sein, dass dieser enorme Aufschwung nicht von Dauer sein konnte. (Am deutlichsten hat dieses Unbehagen vermutlich Wells’ Zeitgenosse Rudyard Kipling in seinem Gedicht „Recessional“ zum Ausdruck gebracht, das er im Juli 1897 in der Times veröffentlichte, anlässlich des diamantenen Thronjubiläums von Queen Victoria und gemahnt allen Feierlichkeiten zum Trotz an die Vergänglichkeit von Weltreichen – auch des britischen.)
Der Sozialist Wells geht mit The War of the Worlds sogar noch einen Schritt weiter, hält der überheblichen, arroganten und von ihrer eigenen Überlegenheit überzeugten Viktorianischen Gesellschaft nicht nur einen satirischen Zerrspiegel vor (was er wenige Jahre später mit dem amüsanten, aber nicht weniger beißenden Fantasy-Roman The Sea Lady [1902] erneut tun wird), sondern zeigt ihr auch deutlich, wie zerbrechlich sie in Wahrheit ist.
Und natürlich war Wells klar, dass ein Großteil des britischen Wohlstands der Ausbeutung der Kolonien geschuldet war. Diesen unschönen Aspekt des Kolonialismus haben viele Autoren billigend kommentiert (auch Rudyard Kipling) oder regelrecht verteidigt, wie etwa Henry Rider Haggard. Ganz im Gegensatz zu ihnen, drückt auch H. G. Wells – und am deutlichsten in The War of the Worlds – ein Unbehagen mit der Praxis des Kolonialismus und des Imperialismus aus und geht, indem er den Spieß umdreht, sogar noch einen Schritt weiter und führt vor Augen, was geschieht, wenn die Täter, die sich unangreifbar wähnen, selbst zu Opfern werden.
Besonders in der zweiten Hälfte, die uns ein Bild der Erde unter der Herrschaft der Marsianer zeigt, ist Wells’ Roman, obwohl durchaus seiner Entstehungszeit verhaftet und mit zahlreichen Zeitbezügen versehen, weit darüber hinaus ein satirischer, beißender und in vieler Hinsicht bitterer Kommentar zum menschlichen Charakter selbst. Gleichwohl das Buch an der Oberfläche mit einer scheinbar optimistischen Not endet, ist The War of the Worlds unterm Strich doch ein pessimistischer Roman, was die menschliche Natur anbelangt – in dieser Hinsicht reiht er sich denn auch in die anderen utopischen und phantastischen Romane des Autors ein. Wells gibt sich große Mühe, uns die marsianischen Angreifer als groteske Monster zu präsentieren, doch was sie am Ende so Furcht einflößend macht, ist eben nicht ihre schreckliche Andersartigkeit, sondern die große Ähnlichkeit, die sie mit uns Menschen haben.
Diese Elemente machen The War of the Worlds zu mehr als einem zynischen Spiegel, der der Viktorianischen Gesellschaft vorgehalten wird – sie machen den Roman zu einem zeitlosen Meisterwerk, das auch heute noch unsere Beachtung verdient.
Joachim Körber
1 Von der Erde zum Mond.
2 Reise um den Mond.
3 Die ersten Menschen auf dem Mond.
4 Krieg der Welten.
5 Sind die Planeten bewohnbar?
6 Intelligentes Leben auf dem Mars.
7 Englands Ende bei der Schlacht von Dorking.
„Wer aber soll auf diesen Welten leben, wenn sie bewohnt sind? … Sind wir die Herren der Welt? … Und wie sind alle Dinge für den Menschen gemacht?“ –
Kepler (zitiert in Die Anatomie der Melancholie)
ERSTES BUCH
DIE ANKUNFT DER MARSIANER
KAPITEL EINS
Am Vorabend des Krieges
Niemand hätte in den letzten Jahren des neunzehnten Jahrhunderts geglaubt, dass diese Welt scharf und aufmerksam beobachtet würde durch eine Intelligenz, die größer ist als die des Menschen, aber ebenso vergänglich wie seine eigene; dass die Menschen, während sie sich ihren unterschiedlichen Belangen widmeten, beobachtet und studiert wurden, beinahe so genau, wie ein Mann mit einem Mikroskop die kurzlebigen Kreaturen untersuchen mochte, die in einem Tropfen Wasser umherschwammen und sich darin vermehrten. Mit grenzenloser Selbstgefälligkeit liefen die Menschen hierhin und dorthin und gingen ihren Angelegenheiten nach, gleichmütig ob ihrer Gewissheit ihrer Herrschaft über die Materie. Es ist möglich, dass die Infusorien unter dem Mikroskop das Gleiche tun. Niemand dachte daran, dass die älteren Welten des Alls eine Quelle der Gefahr für die Menschen darstellten, oder dachten lediglich an sie, um die Vorstellungen, dass es Leben auf ihnen gäbe, als unmöglich oder unwahrscheinlich abzutun. Die meisten Erdenmenschen meinten, dass es andere Menschen auf dem Mars geben könnte, die ihnen selbst vielleicht unterlegen und bereit waren, ein missionarisches Unternehmen zu empfangen. Dennoch beobachteten Intelligenzen, für deren Geist wir das sind, was für unseren die Tiere sind, die zugrunde gehen, weitreichende und kalte und gefühllose Intellekte, diese Erde mit neidigen Augen, und langsam und sicher wandten sie ihre Pläne gegen uns. Und früh im Zwanzigsten Jahrhundert kam es zur großen Desillusionierung.
Der Planet Mars, wie ich den Leser kaum erinnern muss, dreht sich mit einer durchschnittlichen Entfernung von 140.000.000 Meilen um die Sonne und das Licht, das er von der Sonne erhält, beträgt kaum die Hälfte dessen, was diese Welt empfängt. Er muss, wenn man der Nebulartheorie glauben darf, älter sein als unsere Welt; und lange, bevor diese Erde abgekühlt war, musste sich auf seiner Oberfläche Leben gebildet haben. Die Tatsache, dass seine Größe kaum ein Siebtel der Erde ausmacht, muss seine Abkühlung beschleunigt und eine Temperatur erreicht haben, bei der Leben beginnen konnte. Er besitzt Luft und Wasser und alles Notwendige, um eine lebende Existenz aufrechtzuerhalten.
Jedoch ist der Mensch so eitel und so geblendet von seiner Eitelkeit, dass kein Schriftsteller bis zum Ende des Neunzehnten Jahrhunderts der Vorstellung Ausdruck gab, dass sich dort Leben, falls es dort überhaupt welches gab, weit über das irdische Maß hinaus entwickelt hatte. Noch verstand die Allgemeinheit, dass der Mars, da er älter ist als die Erde, kaum ein Viertel ihrer Außenoberfläche besitzt und weiter von der Sonne entfernt liegt, woraus notwendigerweise folgt, dass er sich nicht nur weiter vom Anfang der Zeit, sondern auch näher zu deren Ende befindet.
Die lang anhaltende Abkühlung, die eines Tages unseren Planeten bedecken wird, ist auf unserem Nachbarn bereits weit fortgeschritten. Sein physikalischer Zustand bleibt weiterhin größtenteils ein Rätsel, aber wir wissen inzwischen, dass selbst im Äquatorialbereich die mittäglichen Temperaturen kaum die eines unserer kältesten Winter erreichen. Seine Luft ist viel dünner als unsere, seine Ozeane sind zurückgegangen und bedecken nun gerade einmal ein Drittel der Oberfläche, und während seine Jahreszeiten nur langsam voranschreiten, sammeln sich riesige Schneekuppen und schmelzen um einen der beiden Pole herum und überschwemmen regelmäßig die gemäßigten Zonen. Diese letzte Phase der Erschöpfung, die für uns noch in unfassbarer Weite liegt, ist zu einem derzeitigen Problem für die Bewohner des Mars geworden. Der unmittelbare Druck der Notwendigkeit hat ihren Intellekt aufflammen lassen, ihre Kräfte gestärkt und ihre Herzen verhärtet. Und mit Blick durchs All mit Instrumenten und Intelligenzen, von denen wir kaum zu träumen wagen, sehen sie, in nächster Nähe und nur 35.000.000 Meilen sonnenwärts von ihnen entfernt, einen Morgenstern der Hoffnung, unseren eigenen, wärmeren Planeten, voller grüner Pflanzen und grauem Wasser, mit einer wolkenbehangenen Atmosphäre flüssiger Fruchtbarkeit und bei flüchtigen Blicken durch dahinziehende Wolkenfetzen erscheinen breite, bevölkerte Landstriche und enge Meere, auf denen sich die Kriegsflotten drängen.
Und wir Menschen, die Kreaturen, die diese Erde bewohnen, müssen ihnen mindestens so fremd und klein vorkommen, wie uns die Affen und die Lemuren. Die intellektuelle Seite der Menschheit gibt bereits zu, dass das Leben ein ständiger Daseinskampf ist, und es scheint, als wäre es ebendas, was die Intelligenzen auf dem Mars auch glauben. Ihre Welt ist schon sehr weit abgekühlt und diese Welt ist immer noch voller Leben, jedoch überfüllt mit Kreaturen, die sie als unterlegene Tiere betrachten. Den Krieg sonnenwärts zu tragen, ist ihre einzige Flucht vor der Zerstörung, die sie von Generation zu Generation überkommt.
Und bevor wir sie zu hart verurteilen, müssen wir uns erinnern, welch ruchlose und vollständige Vernichtung unsere eigene Spezies gebracht hat – nicht nur über die Tiere wie der ausgestorbene Bison und den Dodo, sondern auch über seine eigenen schwächeren Rassen. Die Tasmanier wurden trotz ihres menschlichen Äußeren völlig vom Antlitz der Erde getilgt in einem Vernichtungskrieg, der in einem Zeitraum von fünfzig Jahren von europäischen Einwanderern geführt wurde. Sind wir solche Friedensapostel, dass wir klagen, wenn die Marsianer im gleichen Geiste Krieg führten? Die Marsianer scheinen ihren Anflug mit erstaunlicher Raffinesse berechnet – ihre mathematischen Kenntnisse übertreffen die unseren offenkundig bei Weitem – und ihre Vorbereitungen in fast perfektem Einvernehmen getroffen zu haben. Hätten unsere Instrumente es zugelassen, hätten wir schon damals im Neunzehnten Jahrhundert den Ärger erkannt, der sich zusammenbraute. Männer wie Schiaparelli beobachteten den roten Planeten – übrigens ist es kurios, dass der Mars über unzählige Jahrhunderte der Planet des Krieges war –, konnten aber das fluktuierende Erscheinungsbild der Markierungen, die sie so gut kartografiert hatten, nicht interpretieren. Die ganze Zeit über mussten die Marsianer sich vorbereitet haben.
Während der Opposition von 1894 wurde ein helles Licht beobachtet, das einen Teil der Scheibe beleuchtete – zunächst durch das Lick-Observatorium1, dann von Perrotin2 in Nizza und schließlich von anderen Beobachtern. Englische Leser hörten zum ersten Mal in der Ausgabe von Nature3 vom 2. August davon. Ich bin geneigt zu glauben, dass dieses Aufblitzen von der Form einer riesigen Kanone in einem breiten, in den Planeten eingesackten Krater stammt, mit der die Schüsse auf uns abgegeben wurden. Sonderbare, bis dahin ungeklärte Markierungen wurden während der folgenden beiden Oppositionen nahe dem Ort des Ausbruchs gesichtet.
Vor nun sechs Jahren brach der Sturm über uns aus. Während der Mars sich der Opposition näherte, versetzte Lavelle aus Java die Telegrammleitungen für astronomischem Austausch in Schwingungen mit der außergewöhnlichen Nachricht über den Ausbruch eines weiß glühenden Gases auf dem Planeten. Dies hatte zur Mitternacht des Zwölften stattgefunden; und das Spektroskop, auf das er sofort zurückgegriffen hatte, zeigte eine Masse aus feurigem Gas an, größtenteils Wasserstoff, das sich mit enormer Geschwindigkeit auf die Erde zubewegte. Dieser feurige Strahl war um Viertel nach zwölf sichtbar geworden. Er verglich es mit einer kolossalen Feuerwolke, die plötzlich und heftig aus dem Planeten hervorbrach, „wie feuriges Gas aus einer Pistole hervorschießt“.
Dies stellte sich als außerordentlich passender Ausspruch heraus. Am nächsten Tag jedoch stand davon nichts in den Zeitungen, abgesehen von einer Randnotiz im Daily Telegraph4, und die Welt drehte sich weiter im Unwissen über die größte Gefahr, die jemals die Menschheit bedroht hatte. Ich hätte von dem Ausbruch überhaupt nichts gehört, hätte ich nicht den bekannten Astronomen Ogilvy in Ottershaw getroffen. Er war überaus aufgeregt wegen der Neuigkeit und in seinem Hochgefühl lud er mich ein, in dieser Nacht abwechselnd mit ihm den roten Planeten zu beobachten.
Trotz alledem, was bisher geschehen ist, erinnere ich mich noch sehr genau an diese Nachtwache: an das dunkle und stille Observatorium, an die beschattete Lampe, die ein schwaches Glühen auf den Boden in der Ecke warf, an das ständige Ticken des Räderwerks des Teleskops, an den schmalen Schlitz im Dach – eine längliche Zurschaustellung, über die Sternenstaub hinwegzog. Ogilvy bewegte sich hin und her, unsichtbar, aber hörbar. Blickte man durch das Teleskop, sah man einen tiefblauen Kreis und den kleinen, runden Planeten, der in dem Feld schwebte. Er erschien so winzig, so hell und klein und still, leicht bedeckt von quer laufenden Streifen und leicht abgeflacht von dem perfekten Rund. Aber er war so klein, so silbrig warm – ein Stecknadelkopf voller Licht! Es war, als würde er zittern, aber in Wirklichkeit war es das Teleskop, das vibrierte aufgrund der Arbeit des Räderwerks, das den Planeten im Blickfeld hielt.
Während ich zusah, schien der Planet zu wachsen und zu schrumpfen und heranzukommen und sich zurückzuziehen, aber das lag einfach daran, dass meine Augen müde waren. Vierzig Millionen Meilen war er von uns entfernt – mehr als vierzig Millionen Meilen in der Leere. Nur wenige Leute erfassen die Unermesslichkeit der Verlassenheit, in welcher der Staub des materiellen Universums schwimmt.
Ich erinnere mich, dass nahe dem Planeten in dem Feld drei schwache Lichtpunkte auftraten, drei teleskopische Sterne, unendlich weit entfernt, und um alles herum lag die unergründliche Dunkelheit des leeren Raums. Sie wissen, wie diese Schwärze in einer eiskalten, sternerfüllten Nacht aussieht. Durch ein Teleskop erscheint sie viel tiefgründiger. Und für mich unsichtbar, weil es so weit entfernt und klein war, wie es rasch und stetig über jene unglaubliche Entfernung auf mich zugeflogen kam, sich mit jeder Minute über viele Tausend Meilen näherte, kam das Ding, das sie uns schickten, das Ding, das so viel Kampf und Unheil und Tod über die Erde bringen sollte. Während ich zusah, wäre es mir niemals eingefallen; niemand auf der Erde dachte an dieses treffsichere Geschoss.
Auch in dieser Nacht schoss weiteres Gas aus dem entfernten Planeten hervor. Ich sah es. Ein rötliches Aufblitzen am Rand, die geringste Projektion des Umrisses, als der Chronometer gerade Mitternacht schlug; und daraufhin sagte ich es Ogilvy und er nahm meinen Platz ein. Die Nacht war warm und ich hatte Durst und ich vertrat mir ungelenk die Beine und tastete mich durch die Dunkelheit zu dem kleinen Tisch, auf dem der Siphon stand, während Ogilvy wegen des Gasstroms, der auf uns zukam, aufschrie.
In dieser Nacht machte sich ein weiteres Geschoss vom Mars auf dem Weg zur Erde, knapp eine Sekunde unter vierundzwanzig Stunden nach dem ersten. Ich erinnere mich, wie ich dort in der Schwärze auf dem Tisch saß, während grüne und purpurne Punkte vor meinen Augen schwammen. Ich wünschte, ich hätte ein Licht, bei dem ich rauchen könnte, und erahnte kaum die Bedeutung des feinen Glühens, das ich gesehen hatte, und all dessen, was es mir bald bescheren würde. Ogilvy beobachtete bis um eins, dann gab er auf; und wir entzündeten die Laterne und gingen hinüber zu seinem Haus. Unten in der Dunkelheit lagen Ottershaw und Chertsey mit ihren Hunderten von friedlich schlafenden Menschen.
In dieser Nacht spekulierte er viel über den Zustand des Mars und spottete über die vulgäre Vorstellung, dass auf ihm Bewohner lebten, die uns Signale sendeten. Seiner Meinung nach fielen womöglich Meteoriten in einem starken Schauer auf den Planeten herab, oder vielleicht war ein heftiger Vulkanausbruch im Gange. Er wies mich daraufhin, wie unwahrscheinlich es war, dass eine organische Entwicklung auf den beiden benachbarten Planeten die gleiche Richtung eingeschlagen hatte.
„Die Chancen, dass es irgendetwas Menschenähnliches auf dem Mars gibt, stehen eine Million zu eins“, sagte er.
In dieser und in der darauffolgenden Nacht sahen Hunderte von Beobachtern gegen Mitternacht das Aufflammen und wiederum in der Nacht darauf; und so zehn Nächte lang, jede Nacht eine Flamme. Warum die Schüsse nach dem zehnten Mal aufhörten, hat niemand auf der Erde zu erklären versucht. Es mag sein, dass die Gase durch den Abschuss den Marsianern Unbehagen bereiten. Dichte Wolken aus Rauch oder Staub, die durch ein starkes Teleskop auf der Erde als kleine, graue, fluktuierende Flecken zu sehen waren, breiteten sich über die klare Atmosphäre des Planeten aus und verdeckten die bekannteren Merkmale.
Sogar die Tageszeitungen wurden endlich auf die Unruhen aufmerksam und populäre Kommentare über die Vulkane auf dem Mars erschienen hier, dort und überall. Die halb ernste, halb heitere Zeitschrift Punch5 machte, soweit ich mich erinnere, freudig Gebrauch davon in ihrer politischen Karikatur. Und völlig unvermutet zogen jene Geschosse, welche die Marsianer auf uns abgefeuert hatten, auf die Erde zu und rasten nun mit einer Geschwindigkeit von unzähligen Meilen pro Sekunde durch den leeren Abgrund des Alls, Stunde für Stunde, Tag für Tag, näher und näher. Jetzt erscheint es mir unglaublich erstaunlich, dass die Menschen trotz des raschen Verhängnisses ihren belanglosen Sorgen nachhingen wie zuvor. Ich erinnere mich, wie erfreut Markham über den sicheren Kauf einer neuen Fotografie des Planeten für die illustrierte Zeitung war, die er zu jener Zeit herausgab. Die Menschen der Neuzeit begreifen kaum die Menge und den Unternehmungsgeist der Zeitungen unseres Neunzehnten Jahrhunderts. Was mich betraf, so war ich sehr damit beschäftigt zu lernen, wie man Fahrrad fährt, und arbeitete an einer Reihe von Abhandlungen über die möglichen Entwicklungen von Moralvorstellungen bei der Entwicklung der Zivilisation.
Eines Nachts (damals konnte das erste Geschoss kaum mehr als 10.000.000 Meilen entfernt sein) unternahm ich mit meiner Frau einen Spaziergang. Die Sterne standen am Himmel und ich erklärte ihr die Tierkreiszeichen und zeigte auf den Mars, ein heller Lichtpunkt, der allmählich auf den Zenit zukroch, auf den derart viele Teleskope gerichtet waren. Es war eine warme Nacht. Auf dem Heimweg kam eine Gruppe von Ausflüglern aus Chertsey oder Isleworth singend und musizierend an uns vorbei. Licht schien aus den oberen Fenstern der Häuser, als die Bewohner zu Bett gingen. Vom entfernten Bahnhof erklang der Laut rangierender Züge, klingend und polternd, und wurde durch die Entfernung beinahe zu einer Melodie abgeschwächt. Meine Frau machte mich auf die Helligkeit der roten, grünen und gelben Signallichter aufmerksam, die an einem Gerüst hingen und sich gegen den Himmel abhoben. Alles schien sicher und beschaulich.
1 Astronomisches Observatorium der University of California, benannt nach dem Pianobauer Lick, aus dessen Nachlass der Bau finanziert wurde.
2 Henri Joseph Anastase Perrotin (1845-1904), franz. Astronom; von 1884 bis zu seinem Tod Direktor des Observatoriums von Nizza.
3 Englische Fachzeitschrift für Naturwissenschaften, erstmals herausgebracht 1869.
4 Englische Fachzeitschrift für Naturwissenschaften, erstmals herausgebracht 1869.
5 Londoner Satirezeitschrift, gegründet 1841.
KAPITEL ZWEI
Die Sternschnuppe
Dann kam die Nacht der ersten Sternschnuppe. Sie wurde früh am Morgen gesichtet, als sie nach Osten über Winchester hinwegjagte, eine flammende Linie weit oben in der Atmosphäre. Hunderte mussten sie gesehen und für eine einfache Sternschnuppe gehalten haben. Albing beschrieb sie, als ob sie einen grünen Streifen hinter sich herzog, der einige Sekunden lang aufglühte. Denning, unsere Koryphäe, was Meteoriten betraf, gab an, dass die Höhe bei ihrem ersten Erscheinen bei neunzig oder einhundert Meilen lag. Für ihn sah es so aus, als sei sie einhundert Meilen östlich von seinem Standort auf die Erde gestürzt.
Zu dieser Stunde war ich daheim und schrieb in meinem Arbeitszimmer; und obwohl die Balkontür nach Ottershaw zeigte und die Rollläden hochgezogen waren (denn damals liebte ich es, in den Nachthimmel hinaufzublicken), sah ich nichts davon. Dennoch musste dieses seltsamste aller Dinge, das jemals aus dem Weltraum auf die Erde stürzte, heruntergekommen sein, während ich dort saß, und wäre für mich sichtbar gewesen, hätte ich doch nur bei seinem Vorbeiflug aufgeschaut. Manche von denen, die seinen Flug beobachteten, sagten, es flog mit einem Zischen. Ich selber hörte nichts davon. Viele Leute in Berkshire, Surrey und Middlesex mussten den Sturz gesehen und höchstens gedacht haben, dass ein weiterer Meteorit heruntergegangen war. Niemand schien sich die Mühe gemacht zu haben, nach der gefallenen Masse zu suchen.
Aber sehr früh am Morgen erwachte der arme Ogilvy, der die Sternschnuppe gesehen hatte und überzeugt war, dass irgendwo auf dem Anger zwischen Horsell, Ottershaw und Woking ein Meteorit liegen musste, mit dem Gedanken, ihn zu finden. Er fand ihn auch bald nach Sonnenaufgang und nicht weit von den Sandgruben entfernt. Ein riesiges Loch war durch den Aufprall des Projektils entstanden und Sand und Kies waren gewaltsam in alle Richtungen über die Heide geschleudert worden und bildeten Haufen, die noch auf anderthalb Meilen zu sehen waren. Im Osten brannte die Heide und ein dünner Rauchfaden hob sich gegen die Dämmerung ab.
Das Ding selbst lag fast gänzlich eingegraben im Sand und inmitten der verstreuten Späne einer Tanne, die es beim Anflug in kleine Stücke zersprengt hatte. Der unbedeckte Teil sah aus wie ein massiver Zylinder, bedeckt und die Umrisse abgeschwächt durch eine dicke, schuppenförmige, graubraune Verkrustung. Er näherte sich der Masse, überrascht durch die Größe und noch mehr durch die Form, da die meisten Meteoriten mehr oder weniger vollkommen rund sind. Sie war durch ihren Flug durch die Luft immer noch so heiß, dass er nicht nahe herantreten konnte. Ein Geräusch wie durch Bewegung innerhalb des Zylinders schrieb er der ungleichmäßigen Abkühlung der Außenfläche zu; denn zu diesem Zeitpunkt war ihm noch nicht in den Sinn gekommen, dass er hohl sein konnte.
Er blieb am Rande der Grube stehen, die das Ding für sich ausgegraben hatte, und starrte auf das merkwürdige Äußere, größtenteils erstaunt über dessen ungewöhnliche Form und Farbe, und er erkannte sogar undeutlich einige Anzeichen für eine absichtliche Ankunft. Der frühe Morgen war wunderbar ruhig und die Sonne, die gerade durch die Pinienwälder nach Weybridge hin brach, war bereits warm. Er erinnerte sich nicht, an diesem Morgen irgendwelche Vögel gehört zu haben, mit Sicherheit hatte keine Brise geweht und die einzigen Geräusche entstanden durch die kaum hörbaren Bewegungen aus dem Inneren des glühenden Zylinders. Er war ganz allein auf dem Anger.
Dann stellte er plötzlich und erschrocken fest, dass ein Teil des grauen Backsteins, der ascheähnlichen Verkrustung, die den Meteoriten bedeckte, von dem runden Rand des Endes hinabfiel. Sie blätterte ab und rieselte auf den Sand. Auf einmal löste sich ein großes Stück und schlug mit einem lauten Krachen auf, sodass ihm das Herz zum Halse schlug.
Eine Minute lang begriff er kaum, was das bedeutete, und obwohl die Hitze enorm war, kletterte er in die Grube hinab und nahe an die Masse heran, um sich das Ding genauer anzusehen. Sogar zu dem Zeitpunkt glaubte er noch, dass dies auf die Abkühlung des Gehäuses zurückzuführen war. Was diese Vorstellung jedoch zerrüttete, war die Tatsache, dass die Asche nur vom Ende des Zylinders herabfiel.
Und dann nahm er wahr, dass das kreisrunde Kopfende sich sehr langsam auf dem Gehäuse drehte. Die Bewegung war derart langsam, dass er sie erst ausmachte, als er eine schwarze Markierung bemerkte, die vor fünf Minuten nahebei gewesen war und sich nun auf der anderen Seite der Kreislinie befand. Selbst da begriff er kaum, was dies kennzeichnete, bis er ein gedämpftes Kratzen hörte und sah, wie die schwarze Markierung ungefähr einen Zoll weit nach vorne ruckte. Blitzartig wurde es ihm klar. Der Zylinder war künstlich – hohl – mit einem Ende, das herausgeschraubt wurde! Irgendetwas im Inneren schraubte das Kopfende auf!
„Gütiger Himmel!“, sagte Ogilvy. „Da ist ein Mensch drin – Menschen sind da drin! Halb zu Tode verbrannt! Sie versuchen herauszukommen!“
Sofort, mit einem raschen Gedankensprung, verband er das Ding mit dem Aufblitzen auf dem Mars.
Der Gedanke an eine gefangene Kreatur erschien ihm so schrecklich, dass er die Hitze vergaß und auf den Zylinder zuging, um beim Aufdrehen zu helfen. Zum Glück aber hielt ihn die dumpfe Strahlung zurück, bevor er sich die Hände an dem immer noch glühenden Metall verbrennen konnte. Daraufhin stand er einen Augenblick unentschlossen da, wandte sich dann um, kletterte aus der Grube und machte sich wild rennend auf den Weg nach Woking. Es musste ungefähr sechs Uhr gewesen sein. Er traf auf einen Fuhrmann und versuchte ihn dazu zu bringen, dass er ihn verstand, aber die Geschichte, die er erzählte, und sein Äußeres waren so unglaublich – sein Hut war in der Grube heruntergefallen –, dass der Mann einfach weiterfuhr. Ebenso wenig Glück hatte er bei dem Kellner, der gerade dabei war, die Türen zum Wirtshaus bei Horsell Bridge aufzuschließen. Der Geselle hielt ihn für einen flüchtigen Wahnsinnigen und versuchte erfolglos, ihn im Schankraum einzusperren. Dies ernüchterte ihn ein wenig; und als er Henderson, den Journalisten aus London, in seinem Garten sah, rief er über den Zaun zu ihm herüber und machte sich verständlich.
„Henderson“, rief er, „haben Sie letzte Nacht die Sternschnuppe gesehen?“
„Ja, und?“, sagte Henderson.
„Sie liegt jetzt draußen auf Horsell Common.“
„Gütiger Gott!“, sagte Henderson. „Ein abgestürzter Meteorit! Das ist gut.“
„Aber es ist etwas mehr als ein Meteorit. Es ist ein Zylinder – ein künstlicher Zylinder, Mann! Und jemand befindet sich im Inneren.“
Henderson erhob sich mit einem Spaten in der Hand.
„Wie bitte?“, fragte er. Er war auf einem Ohr taub.
Ogilvy berichtete ihm alles, was er gesehen hatte. Henderson ließ es einen Augenblick lang einsickern. Dann ließ er den Spaten fallen, packte seine Jacke und trat auf die Straße. Die beiden Männer eilten zurück auf den Anger und stellten fest, dass der Zylinder immer noch an derselben Stelle lag. Inzwischen aber waren die Geräusche aus dem Inneren verstummt und ein schmaler Ring aus hellem Metall zeigte sich zwischen dem Kopfende und dem Gehäuse des Zylinders. Mit einem hohen Zischen drang entweder Luft am Rand hinein oder trat aus.
Sie horchten, klopften mit einem Stock gegen das schuppenartige, verbrannte Metall und als sie keine Antwort erhielten, kamen beide zu dem Schluss, dass der Mensch oder die Menschen darin entweder bewusstlos oder tot sein mussten.
Selbstverständlich konnten die beiden kaum etwas unternehmen. Sie riefen tröstende Worte und Versprechen und kehrten wieder in die Stadt zurück, um Hilfe zu holen. Man kann sich vorstellen, wie sie voller Sand, aufgeregt und durcheinander im Sonnenlicht die schmale Straße entlangliefen, gerade als die Verkäufer ihre Fensterläden abnahmen und die Bewohner ihre Schlafzimmerfenster öffneten. Henderson ging sofort zum Bahnhof, um die Nachricht nach London zu telegrafieren. Die Zeitungsartikel hatten den Verstand der Menschen auf den Empfang der Idee vorbereitet.
Um acht Uhr hatte sich bereits eine Reihe von Burschen und arbeitslosen Männern auf den Weg zum Anger gemacht, um „die toten Menschen vom Mars“ zu sehen. In dieser Form wurde die Geschichte erzählt. Ich hörte sie zum ersten Mal ungefähr um Viertel vor neun durch meinen Zeitungsjungen, als ich hinausging, um mir den Daily Chronicle6 zu kaufen. Ich war natürlich erstaunt, verlor keine Zeit und ging hinaus und über die Brücke von Ottershaw zu den Sandgruben.
6 Britische Tageszeitung, herausgegeben zwischen 1872 und 1930.
KAPITEL DREI
Auf Horsell Common
Ich fand eine kleine Menge aus vielleicht zwanzig Leuten vor, die das riesige Loch umstanden, in welchem der Zylinder lag. Ich habe bereits das Äußere der kolossalen Masse beschrieben, die im Boden eingegraben war. Die Sode und der Kies drum herum schienen wie von einer plötzlichen Explosion verkohlt worden zu sein. Zweifellos hatte der Aufprall ein plötzliches Feuer entfacht. Henderson und Ogilvy waren nicht da. Ich glaube, sie erkannten, dass derzeit nichts unternommen werden konnte, und waren zum Frühstücken zu Hendersons Haus zurückgekehrt.
Vier oder fünf Burschen saßen dort am Rand der Grube, ließen die Beine baumeln und machten sich einen Spaß daraus – bis ich ihnen Einhalt gebot –, Steine auf die riesige Masse zu schmeißen. Nachdem ich mit ihnen gesprochen darüber hatte, fingen sie an, in der Gruppe von Schaulustigen, Fangen zu spielen.
Unter ihnen befanden sich ein paar Radfahrer, ein Aushilfsgärtner, den ich gelegentlich beschäftigte, eine junge Frau, die einen Säugling trug, Gregg der Metzger mit seinem kleinen Sohn sowie zwei oder drei Nichtstuer und Golfcaddys, die sich gewohnheitsmäßig am Bahnhof herumtrieben. Es wurde nur wenig gesprochen. Wenige aus dem gemeinen Volk in England hatten damals auch die geringste Vorstellung von Astronomie. Die meisten von ihnen starrten still auf das große, tischähnliche Kopfstück des Zylinders, der weiterhin dalag, wie Ogilvy und Henderson ihn zurückgelassen hatten. Ich glaube, die allgemeine Erwartung eines Haufens verbrannter Leichen wurde durch die unbelebte Masse enttäuscht. Manche Leute gingen, während ich dort war, andere kamen. Ich kletterte in die Grube hinab und glaubte, ein dumpfes Geräusch unter meinen Füßen zu hören. Das Kopfstück drehte sich jedenfalls nicht mehr.
Erst als ich derart nahe an das Objekt herangetreten war, wurde mir dessen Fremdartigkeit gänzlich bewusst. Auf den ersten Blick war es tatsächlich nicht aufregender als ein umgestürzter Karren oder ein umgewehter Baum, der auf der Straße lag. Eigentlich war dem nicht so. Es sah aus wie ein rostiger Tankwagen. Es war schon ein gewisses Maß an wissenschaftlicher Bildung nötig, um zu erkennen, dass die grauen Schuppen auf dem Ding kein einfaches Oxid waren; dass das gelblich-weiße Metall, das in der Spalte zwischen dem Deckel und dem Zylinder schimmerte, einen unbekannten Farbton hatte. Für die meisten Schaulustigen hatte der Begriff „außerirdisch“ keine Bedeutung.
Zu diesem Zeitpunkt sagte mir mein eigener Verstand recht klar, dass das Ding vom Planeten Mars gekommen war, aber ich ermaß es als unwahrscheinlich, dass es irgendein lebendes Wesen barg. Ich dachte, das Aufschrauben würde automatisch erfolgen. Ogilvys Ansichten zum Trotz glaubte ich weiterhin, dass es Menschen auf dem Mars gab. Mein Verstand raste voller Fantasie ob der Möglichkeit, dass das Ding Manuskripte enthielt, ob der Übersetzungsschwierigkeiten, die sich ergeben würden, ob wir Münzen und Baumuster darin finden würden und so weiter. Allerdings war es ein wenig zu groß, als dass diese Vorstellung gesichert werden konnte. Ich verspürte Ungeduld, als ich zusah, wie es sich öffnete. Gegen elf, als augenscheinlich nichts geschah, ging ich voll mit solchen Gedanken zu meinem Haus in Maybury zurück. Ich fand es jedoch schwierig aufgrund meiner abstrakten Untersuchungen, an die Arbeit zu gehen.
Am Nachmittag hatte sich die Erscheinung auf dem Anger stark verändert. Die Frühausgaben der Abendzeitungen hatten die Londoner mit ungeheuren Schlagzeilen aufgeschreckt:
„EINE BOTSCHAFT VOM MARS“, „ERSTAUNLICHE GESCHICHTE AUS WOKING“,
und so weiter. Zudem hatte Ogilvys Kabel7 zum Astronomischen Amt jedes Observatorium in den drei Königreichen wachgerufen.
Ein halbes Dutzend oder mehr Herumtreiber von Bahnhof in Woking standen auf der Straße bei den Sandgruben, dazu eine Bockchaise und eine recht herrschaftliche Kutsche. Daneben gab es eine ziemliche Ansammlung an Fahrrädern. Darüber hinaus mussten viele Leute trotz der Tageshitze von Woking nach Chertsey gelaufen sein, sodass das sich zusammengenommen eine ordentliche Menge zusammengefunden hatte – unter ihnen auch die eine oder andere farbenfroh gekleidete Dame.
Es war unerträglich heiß, keine Wolke am Himmel und kein Windhauch und die einzigen Schatten wurden von den vereinzelten Pinien geworfen. Die brennende Heide war gelöscht worden, aber die ebene Erde auf Ottershaw war geschwärzt, soweit das Auge reichte, und noch immer stiegen senkrechte Rauchbänder daraus hervor. Ein unternehmungsfreudiger Süßigkeitenverkäufer aus der Chobham Road hatte seinen Sohn mit einer Wagenladung grüner Äpfel und Ingwerlimonade hinaufgeschickt.
Ich ging zum Rand der Grube und stellte fest, dass sie von einer Gruppe aus gut einem halben Dutzend Männern in Beschlag genommen wurde: Henderson, Ogilvy und ein großer, blonder Mann, von dem ich später erfuhr, dass er Stent war, der Hofastronom, zusammen mit mehreren Arbeitern, die Spaten und Spitzhacken schwangen. Stent gab mit klarer, hell klingender Stimme Anweisungen. Er stand auf dem Zylinder, der nun offensichtlich viel kühler war; sein Gesicht war hochrot und triefte vor Schweiß und irgendetwas schien ihn irritiert zu haben.
Ein großer Teil des Zylinders war inzwischen freigelegt worden, wenngleich das untere Ende immer noch eingegraben war. Sobald Ogilvy mich inmitten der glotzenden Menge am Grubenrand entdeckte, rief er mir zu, ich solle hinunterkommen, und fragte mich, ob es mir etwas ausmachen würde, zu Lord Hilton zu gehen, dem Gutsherrn.