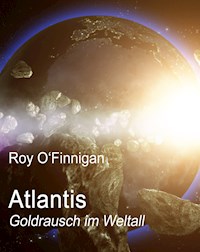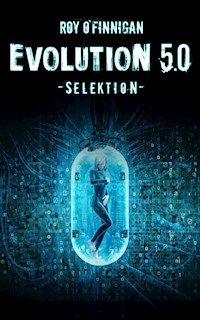Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: publi4all
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Krieg ums Internet findet in der Virtual Reality statt. Für CycloneB, den Erfinder von Nanobots und VR-Brille ein fast unlösbares. Aber CyconeB und seine Freundin Phire sind mit ihrem kleinen Team extrem smart. Wenn da nicht noch diverse andere Angriffe wären...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Roy O‘FinniganKrieg ums Internet
© Thomas Hoffmann, publi4all, 2014http://www.publi4all.de Impressum: http://www.publi4all.de/impressum
Coverfoto mit freundlicher Genehmigung von Syda Productions.
Die Wiedergabe auch auszugsweise ist mit Genehmigung von publi4all gestattet. Anfragen bitte per E-Mail. Respektieren Sie den kreativen Einsatz des Autors und aller Beteiligten und erwerben das eBook bitte käuflich.
Vorwort
Dieses eBook erzählt drei Geschichten, die eines verbindet: sie handeln von der Zukunft. Einer möglichen Zukunft, die aus zwei Gründen etwas dystopisch geraten ist. Zum einen finde ich Utopien langweilig und zum anderen gehe ich - wie alle Optimisten - vorsichtshalber vom Schlimmsten aus. Dann kann es nur noch besser werden.
„Krieg ums Internet“ ist ein Auszug aus meinem Science-Fiction-Thriller, an dem ich seit fast zwei Jahren schreibe. Naturgemäß gibt es viele Hinweise auf Ereignisse des Romans, die offen bleiben müssen. Das ließ sich nicht vermeiden, denn mein Buch wird erst 2015 erscheinen. Vorläufig trägt es den Arbeitstitel „Nanobots“.
Jede Technologie, die nur weit genug fortgeschritten ist, kann von Magie nicht mehr unterschieden werden. Das gilt für das Auto, das zum ersten Mal von Steinzeitmenschen erblickt wird, genauso, wie für das Smartphone, welches einem Römer vorgeführt wird.
Oder für eine Schnittstelle, die im Gehirn eines Menschen implantiert wird und ihn direkt mit dem Internet verbindet. Dort laufen von Menschen oder Programmen erschaffene virtuelle Welten, in denen Menschen sich bewegen und empfinden wie in der realen Welt. Doch deren Gesetze gelten dort nicht. Alles ist möglich. Lediglich die eigene Fantasie setzt noch Grenzen. Und die Rechenkapazität des Computers.
Sie glauben, das sei Science-Fiction? Vielleicht. Doch die Technologie, die in meinen Geschichten vorkommt, existiert bereits. Zumindest im Labor. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann sie realisiert wird. Wer mehr darüber erfahren möchte, kann sich gerne auf meinem Blog darüber informieren. http://royofinnigan.blogspot.de.
Ach, ich vergaß. Die Sache hat einen Haken. Das Internet ist nicht mehr frei. Die Regierungen, Behörden, Geheimdienste und Unternehmen haben es unter sich aufgeteilt, um die Menschen zu kontrollieren, zu normieren und deren Daten auszubeuten. Doch es regt sich Widerstand.
Und noch etwas. Meine Geschichte spielt sowohl in der realen als auch in der virtuellen Welt. Der Übergang ist manchmal fließend. Um das für meine Leser nachvollziehbar zu machen, verwende ich für meine Protagonisten normale Namen, wenn sie sich in der Realität befinden, und Hackerpseudonyme, wenn sie durch die virtuellen Welten kreuzen.
Der Klimawandel ist hausgemacht? Die Menschen sind selbst daran schuld? Von wegen! Während die einen sich noch darüber streiten ob sich das Klima überhaupt ändert und wenn ja, wie stark, gibt es einen lachenden Dritten. Mehr dazu in „Terbols Mission“!
„Nur der Tod macht frei“ ist die Geschichte eines Menschen, der in Zeiten der Totalüberwachung versucht, zu verschwinden. Nicht freiwillig, sondern getrieben von Behörden und Unternehmen, die Unmenschliches von ihm verlangen. In letzter Verzweiflung sieht er nur noch einen Ausweg. Mit dieser Story habe ich den Schreibwettbewerb anlässlich des 30. Geburtstags der Computerzeitschrift c’t gewonnen.
Für Ihre Anregungen zu den Episoden bin ich dankbar. Bitte senden Sie mir eine E-Mail an [email protected]
Terbols Mission
Terbol war äußerst zufrieden mit der Entwicklung. Er genehmigte sich einen Schluck Pangagarblas und lehnte sich zurück. Er wusste, was jetzt kommen würde, und er hatte vor, jede einzelne Sekunde der Show zu genießen. Gut gelaunt betrachtete er die riesige weiße Wolke mit dem schwarzen Loch in der Mitte, wie sie sich langsam rotierend der Küste näherte. Aus dem Weltall sah das faszinierend und harmlos aus. Aber er brauchte die Daten nicht zu studieren, um sich vorstellen zu können, wie das Meer unter dieser Wolke brodelte. Bei einem Wirbelsturm dieser Größe waren Wellenhöhen bis zu 16 Metern keine Seltenheit.
Wehe dem Schiff, das in diesem Sturm gefangen war und den Wellen trotzen musste. Wellen, die von bis zu 175 km/h schnellen Winden aufgepeitscht wurden. Terbol hatte es persönlich noch nicht erlebt, aber er glaubte sich vorstellen zu können, was es hieß, auf so einem schlingernden, stampfenden und rollenden Schiff durchgeschüttelt zu werden. Am schlimmsten musste es sein, unter diesen Bedingungen auf das offene Deck hinauszugehen, um überschüttet von eiskalten Brechern Ladung oder losgerissene Teile der Ausrüstung zu sichern, bevor sie Schäden am Schiff anrichten konnten.
Er gönnte sich einen weiteren Schluck von seinem exquisiten Getränk.
Langsam begann der Pangagarblas zu wirken. Terbol spürte, wie sich eine wohlige Wärme in seinem Körper ausbreitete und er genoss seine wachsende Euphorie.
Die Menschen hatten diesem Sturm den harmlos klingenden Namen „Sandy“ gegeben. Wie dumm sie doch waren. Die meisten von ihnen hielten ihn für einen Jahrhundertsturm. Sie dachten, es sei nichts weiter als ein Ereignis mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit, die so gering war, dass es nur alle einhundert Jahre eintreten würde. Und jetzt traf es sie halt. Das war Pech für sie, aber der Sturm würde vorübergehen. Nach dem Sturm würden sie alle Schäden reparieren und es würde weitergehen wie immer.
Nichts wussten sie, gar nichts. Nichts verstanden sie, überhaupt nichts.
Terbol war das nur recht. Es war gut so, und ein wenig war er auch stolz darauf. Er hatte nämlich persönlich dafür gesorgt, dass das so war. Es war seine Idee gewesen. Eine seiner vielen guten Ideen vor seiner Ankunft hier vor 246 Jahren.
Er ließ sich von der Welle der Euphorie treiben, die der Pangagarblas bei ihm ausgelöst hatte. Er brauchte nichts weiter für sein Glück. Andere hätten sich in diesem Moment vielleicht die Gesellschaft eines Mädchens oder eines Jünglings gewünscht. Aber ihm bedeutete das nichts. Zu beobachten, wie der Wirbelsturm auf die Ostküste der Vereinigten Staaten zu kroch, war ihm Erregung und Befriedigung genug.
Er betrachtete die riesige weiße Wolkenscheibe. Wie unschuldig sie von oben wirkte. Sie Sandy zu nennen war treffend und konsequent. 3000 Kilometer reinstes jungfräuliches Weiß. Und doch führte sie die gewaltige Kraft mit sich, die alles zerstörte, das den Fehler machte, sich ihr in den Weg zu stellen. Rücksichtlos, brutal und ohne die geringsten Emotionen würde sie aus Immobilien äußerst bewegliche Objekte machen. Sie würde auf einer Küstenlänge von 1000 Kilometern zwischen den Staaten North Carolina und Maine die Infrastruktur zerstören, Menschen und Tiere töten, Häuser verschwinden lassen, Autos durch die Luft wirbeln, ganze Landstriche unter Wasser setzen und noch vieles mehr, wofür Wirbelstürme für gewöhnlich verantwortlich gemacht werden.
Terbol war stolz auf Sandy. Für ihn war sie fast wie eine Tochter. Sein Geschöpf. Er hatte mehr als ein Leben damit verbracht, solche Stürme zu erschaffen. Er war der unangefochtene Meister der Stürme.
Ein wenig bedauerte er in diesem Moment sogar, dass die Menschen dort unten auf der Erde das nicht wussten. Dass sie ihn nicht kannten. Aber er brauchte ihre Bewunderung nicht. Es hätte ihm gereicht, wenn sie ihn gefürchtet hätten. Terbol, Gott der Stürme. Das klang doch nicht schlecht, fand er.
Sie ahnten nicht, wer für den Sturm verantwortlich war.
Dieser Sturm war Teil eines Planes. Eines Planes, vor Abertausenden von Jahren geschmiedet, lange bevor er geboren worden war. Terbol hatte keine Ahnung, wie oft dieser Plan schon umgesetzt worden war. Er selbst wusste von Hunderten von Fällen. Aber es war unmöglich zu sagen, wie viele es insgesamt waren. Aber das spielte in diesem Moment keine Rolle. Jetzt zählte nur sein Projekt. Und das war gerade in der Endphase angekommen. Nach Sandy würden noch viele weitere Stürme folgen. Immer häufiger, immer stärker, immer mehr, immer katastrophaler.
Noch gab es eine Möglichkeit, den Prozess zu stoppen. Aber Terbol würde alles tun, um das zu verhindern. Nur noch ein paar Jahre. Dann hätten sie es geschafft. Dann würde der Prozess unumkehrbar sein und niemand würde ihn dann noch aufhalten können.
Niemand. Nicht einmal Terbol selbst, wenn er es gewollt hätte. Aber das würde er niemals wollen. Warum auch? Auf diesen Moment hatten er und die Besatzung der Xorcha schließlich über 2500 Jahre gewartet.
Er nahm einen weiteren Schluck Pangagarblas. Das Getränk begann, sich auf sein Bewusstsein auszuwirken, und seine Erinnerungen flammten wieder auf. Er erinnerte sich an den Tag vor genau 2503 Jahren auf Antrab, als alles begann. Seine Erinnerung war dermaßen präsent und detailliert, dass er alles so durchlebte, als würde es gerade in diesem Moment zum ersten Mal geschehen.
Irgendwann hatte er aufgehört zu zählen, wie oft er die Erinnerung an diesem Punkt abgebrochen hatte. Aber dieses Mal ließ er sie zu. Er wusste nicht genau warum, aber aus irgendeinem Grund erschien es ihm richtig. Terbol entspannte sich und ließ seiner Erinnerung ihren Lauf.
***
„Hörst du das?“ fragte Terbol seine Begleiter. Cesteso und Balandia sahen ihn verwundert an.
„Was hast du denn gehört?“, fragte Cesteso.
„Ich höre es immer noch. Da ist ein tiefes Brummen. Ihr solltet euch mal die Ohren ausputzen lassen, wenn ihr das nicht hört“, sagte Terbol von oben herab. Dafür erntete er einen vorwurfsvollen Blick von Balandia. Den ignorierte Terbol und kletterte hoch.
Die Beiden folgten ihm, konnten aber mit seinem Tempo nicht mithalten. Terbol war einer der geschicktesten Kletterer ihres Stammes. Er hörte erst auf zu klettern, als er ganz oben angekommen war. Während er sich mit einer Hand an dem dünnen Wipfel festhielt, spähte er in alle Richtungen. Dabei bog sich sein Halt bedenklich durch. Er machte den Eindruck, jeden Moment unter der Spannung zu zerbrechen, aber Terbol schien es nicht zu bemerken.
„Terbol, pass auf! Der Wipfel bricht gleich!“ warnte ihn Balandia. Doch er hörte nicht auf sie.
„Dort“, rief er und zeigte über die Baumwipfel hinweg in Richtung der Berge, die weit hinten am Horizont steil in die Höhe ragten. Dann ließ er sich fallen, breitete seine Flügel aus und glitt zwischen den Bäumen dahin. Schließlich landete er auf einem niederen Ast und kletterte blitzschnell hoch. Oben angekommen warf er einen Blick zurück.
„Warte doch auf uns!“ schrie Balandia, aber Terbol lachte nur. „Nicht so lahm! Beeilt euch!“ Dann flog er los, noch bevor seine Freunde den Baum erreicht hatten. „Dein Bruder ist mal wieder unmöglich“, sagte Balandia zu Cesteso, während sie hochkletterten. „Ich werde euren Eltern davon berichten. So ein Verhalten entspricht nicht den Regeln unseres Stammes.“
Cesteso zuckte mit den Schultern. „Tu, was du nicht lassen kannst“, sagte er. „Es wird nichts nützen. Egal was man sagt, Terbol macht immer, was er will.“ Ohne eine Antwort abzuwarten, ließ er sich fallen und folgte seinem Bruder. Dessen unverkennbares Gefieder am Kopf und auf dem Rücken machte es leicht, ihm auch auf größere Distanz zu folgen.
Mittlerweile hatte Terbol mehrere Flugstrecken Vorsprung. Wieder landete er auf einem Ast und wollte gerade hochklettern, als er mitten in der Bewegung innehielt. Über ihm saß ein Horot, fletschte die Zähne und stieß dabei einen hohen Zischlaut aus. Der Ton war so schrill, dass Terbol die Ohren schmerzten. Er spürte die Gefahr. Gegen einen ausgewachsenen Horot hatten selbst die besten Krieger der Parstakoi kaum eine Chance. Darum ging keiner von ihnen alleine in den Wald.
Unwillkürlich stellten sich Terbols Nackenfedern auf. Der Horot war bereit zum Angriff. Es war zu spät, um nach dem Messer zu greifen. Das Raubtier würde sich auf ihn stürzen, noch bevor er sein Messer ziehen konnte. Zur Flucht war es auch zu spät. Es würde ihm hinterher springen obwohl es nicht fliegen konnte. Einmal auf ihre Beute fixiert, nahmen die Horots keine Rücksicht auf die Höhe. Selbst wenn sie zusammen mit ihrem Fang in den Tod stürzen würden.
Terbol blieb nur eine Möglichkeit. Und die baumelte direkt vor seiner Nase. Blitzschnell ergriff er den Schwanz des katzenartigen Raubtiers und zog daran mit aller Kraft. Es gelang ihm, den Horot zu überraschen und ihn von seinem Ast zu ziehen, bevor er seine Krallen in Terbols Rücken schlagen konnte. Nur wenige Millimeter schnitten die rasiermesserscharfen Krallen über seinen Federn durch die Luft. Dann hing der Horot kopfüber nach unten an seinem Schwanz, den Terbol noch immer festhielt. Wild fauchend peitschte er mit seinen Pranken durch die Luft Schließlich ließ Terbol los und sah zu, wie der Horot nach unten fiel und auf dem Waldboden aufschlug.
Geschickt federte das Tier den Sturz auf dem weichen Waldboden ab. Es dauerte nur einen Moment, bis der Jäger sich von dem Fall erholt hatte. Dann lief er zu dem Baumstamm zurück und begann schnell hochzuklettern. Doch er war nicht schnell genug!
Als Terbol am Gipfel ankam, lagen immer noch einige Meter zwischen ihm und seinem Verfolger. Terbol segelte davon und der Horot sprang hinterher. Es bedurfte nur eines kleine Ausweichmanövers und das Ende des Raubtiers war besiegelt. „Guten Flug, du blöder Bettvorleger!“ schickte Terbol ihm einen Abschiedsgruß hinterher.
An seinem Ziel angekommen, wartete Terbol auf seine Freundin und seinen Bruder. „Du dämlicher Idiot!“ schimpfte Balandia schon von weitem. „Ich habe gesehen, wie dich der Horot beinahe erwischt hätte. Ich werde es dem ganzen Stamm erzählen, wie leichtsinnig du dich in Gefahr gebracht hast.“
„Beruhige dich, es ist doch gar nichts passiert. Nur ein besoffener Volltrottel lässt sich von einem Horot im Flug erwischen.“
Balandia funkelte ihn wütend an. „Du hast ja keine Ahnung, wie viel Glück du gehabt hast. Sei froh, dass der Horot von unten kam. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn du ihm beim Hochklettern begegnet wärst.“
Terbol grinste. „Federchen, du enttäuscht mich. Mittlerweile solltest du wissen, dass so ein bisschen Horot kein Problem für mich ist“, sagte er großspurig. „Keiner ist so schnell wie …“
Terbols Selbstlob wurde jäh durch ein lautes „KRAWUMM“ unterbrochen. Alle blickten gespannt dorthin, von wo der Lärm kam. Erst jetzt fiel ihnen die Lichtung auf. Es war offensichtlich, dass sie künstlich war und noch nicht lange bestand. Am Rande lagen gefällte Bäume herum. Auf der Lichtung arbeiteten riesige Maschinen und trieben Löcher in den Boden.
„W… was treiben die da?“ rief Balandia entsetzt. „Sie vergreifen sich an der Natur. Terbol, das dürfen die nicht. Das ist streng verboten.“
„Sieht mir aus wie Rohstoffräuber“, sagte Terbol. „Los, kommt. Wir müssen ihnen Einhalt gebieten, bevor noch größerer Schaden entsteht.“
„Wir?“ fragte Balandia verwundert. „Wir können gegen Rohstoffräuber gar nichts ausrichten. Sieh nur, was die für Maschinen haben. Bestimmt sind sie bewaffnet. Das ist Sache der Waldhüter. Ich werde sie rufen.“
„Sieht mir nicht nach Rohstoffräubern aus“, sagte Cesteso nachdenklich. Doch niemand hörte ihn. Balandia war mit ihrem UniCom beschäftigt. Terbol blickte angestrengt in eine andere Richtung. „Da drüben ist ein Schwarm Varixe.“
„Was sollen wir denn mit denen?“ fragte Cesteso verwundert. „Lass sie besser in Ruhe. Wenn die mal aufgeschreckt sind, kann alles Mögliche passieren.“
„Genau“, erwiderte Terbol.
Cesteso brauchte einen Moment, bis er verstand. „Du bist verrückt. Lass das mal lieber sein, Bruder. Varixe kann man nicht lenken. Das ist noch nie jemandem gelungen.“
„So ein Mist!“ schimpfte Balandia. „Die Nachricht geht nicht raus. Das kommt bestimmt von den Maschinen. Die stören den Funkverkehr.“
„Also doch Rohstoffräuber“, stellte Cesteso nachdenklich fest.
Balandia kannte Terbol schon lange. In seinen Augen lag mal wieder dieses besondere Funkeln. Dieser Blick war der Vorbote einer Katastrophe. Immer. Zumindest fast immer. Schon als sie ihn kennenlernte, war das so gewesen. Da hatte er den gleichen Ausdruck gehabt. Als sie ihn das erste Mal sah, hatte sie den Fehler gemacht, in seine violetten Augen mit den goldenen Flecken zu sehen. Sofort hatte sie sich in ihn verliebt, obwohl ihre Charaktere gegensätzlicher nicht sein könnten. Und Terbol gab ihr regelmäßig einen Grund, sich daran zu erinnern. Schon oft hatte sie Schluss machen wollen, aber dieser Blick hatte es immer wieder vereitelt.
„Balandia, was ist mit dir?“ rief Cesteso. „Los, komm schon. Wir müssen verhindern, dass Terbol etwas Dummes anstellt.“
Cestesos Stimme holte sie zurück in die Gegenwart. „Terbol, warte!“ rief sie ihm hinterher. „Ich habe die Waldhüter informiert. Sie werden in einer halben Stunde hier sein.“ Doch Terbol war schon zu weit voraus, um sie noch zu hören. Balandia seufzte. Vermutlich hätte er das mit den Waldhütern sowieso nicht geglaubt. Wieder einmal musste sie ihm hinterher hetzen. Seufzend breitete sie ihre Schwingen aus und stürzte sich in die Tiefe.
Ach, könnte sie doch nur richtig fliegen, dachte sie. Dann würde sie Terbol spielend einholen können. Das wäre mal etwas Anderes. Balandia stellte sich vor, wie Terbol sie neidisch bewunderte, wenn sie ihn flügelschlagend in der Luft überholte und elegant wie eine Elfenprinzessin vor ihm auf dem Ast landete.
Leider hatten die Parstakoi schon vor dreihundertfünfzigtausend Jahren das Fliegen verlernt. Balandia wusste von ihrem Lehrer, dass ihre Vorfahren einen größeren Körper gebraucht hatten, um das wachsende Gehirn mit Energie zu versorgen. Irgendwann waren sie dann zu schwer geworden, um sich vom Boden aus in die Luft erheben zu können. Von nun an mussten sie auf Bäume oder Klippen hochklettern, um sich von dort dann im Gleitflug in die Tiefe zu stürzen.
Vorsichtig schob Terbol die Blätter zur Seite und warf einen Blick auf die Varixe. Die Herde war noch da und weidete sich friedlich an den Blättern der Storabäume. Das war ihre Lieblingsnahrung. Terbol musterte die riesigen Vögel. Schließlich entdeckte er den Anführer. Er war ein gutes Stück größer als alle anderen. Um ihn herum war eine Gruppe Weibchen versammelt. Für Terbol gab es keinen Zweifel.
Ohne den Blick von dem Varix abzuwenden, nahm Terbol das Seil zur Hand, das er immer bei sich trug, und knüpfte ein Zaumzeug. Auf die Entfernung war es nicht so einfach, die Größe abzuschätzen. Deshalb verließ er sich mehr auf sein Gefühl, als auf seinen Verstand.
Dann begann der schwierige Teil. Er musste zu einem Baum, der nahe genug an dem Anführer war, so dass Terbol sich von oben auf den Varix stürzen konnte, bevor dieser ihn bemerkte. Wenn der Varix erst einmal mit Fluchtgeschwindigkeit flog, hatte Terbol keine Chance mehr, ihn einzuholen.
Terbol schätzte seine Chance, unbemerkt zu dem Baum hinüberzufliegen, gegen Null. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als hinunterzuklettern und zu Fuß zu gehen. Das war gefährlich. Am Waldboden lauerten alle möglichen Gefahren für Parstakoi. Deshalb betraten sie ihn äußerst selten.
Terbol hatte keine Angst davor. Er war schon oft dort unten gewesen. Alleine. Heimlich. Nie hatte jemand davon erfahren. Er würde dafür sorgen, dass es sein Geheimnis blieb. Er kletterte hinunter.
Auf den letzten Metern vermied er jedes Geräusch. Etwa zehn Meter über dem Boden studierte er seine Umgebung. Nichts regte sich. Nichts war zu hören. Nachdem sich seine Augen an das Dämmerlicht gewöhnt hatten, seilte er sich langsam an einer Liane herab.
Wie immer durchfuhr ihn ein seltsames Kribbeln, als seine Füße den Boden berührten. Der Waldboden war eine Mischung aus trockenem Laub, Nadeln, Moos, Ästen und Früchten in allen möglichen Reifestadien, die von oben heruntergefallen waren. Dazwischen krochen Ameisen und Käfer umher. Von den meisten kannte er nicht einmal die Namen. Der süßliche Duft von Verwesung lag in der Luft.
In dem Dämmerlicht konnte man leicht die Orientierung verlieren. Kein Sonnenstrahl drang bis zum Waldboden vor. Selbst polarisiertes Licht fehlte, das die Parstakoi zur Orientierung bei bewölktem Himmel verwendeten. Terbol brauchte das nicht. Er war einer der wenigen seines Volkes, der über einen funktionierenden Magnetsinn verfügte. Bei den meisten war er so verkümmert, dass er nicht mehr zu gebrauchen war. Nicht bei ihm.
Terbol konzentrierte sich. Das Dämmerlicht half ihm dabei. Dann sah er den Schimmer in einer Farbe, für die es keinen Namen gab. Nachdem er wusste, wo Norden war, galt es, keine Zeit mehr zu verlieren. Es war hier unten nicht ratsam, zu lange an einer Stelle stehen zu bleiben. Sorgfältig darauf bedacht, nur auf das weiche Moos zu treten, stakste er los.
Nach etwa zehn Minuten hatte er sein Ziel erreicht. Terbol nahm sich einen Moment die Zeit, den Storabaum zu bewundern. Noch nie hatte er einen so gewaltigen Stamm gesehen. Seiner Schätzung nach hätte es mindestens fünfzehn Parstakoi gebraucht, um ihn mit ausgebreiteten Schwingen zu umfassen.
Ein Knacken hinter ihm schreckte ihn auf. Blitzschnell griff er nach der nächstbesten Liane und zog sich daran hoch. Erst als er zwanzig Meter über dem Boden war blickte er nach unten. Nichts war zu sehen. Oder war da ein Schatten, der sich hin- und her bewegte?
Terbol kletterte schnell weiter. Zweihundert Meter weiter oben hielt er inne. Hier oben war der Storabaum so dünn, dass ihm das Laub keinen weiteren Sichtschutz mehr bot. Der Anführer der Varixe äste jetzt an Blättern in höheren Regionen, war aber immer noch etwa fünfzig Meter unter ihm. Und in Reichweite.
Terbols Herz begann zu klopfen. Adrenalin schoss in seine Adern und das Jagdfieber packte ihn. Der Moment war günstig und es gab keinen Grund zu zögern. Noch während er sprang, stieß einer der Varixe einen durchdringenden Warnschrei aus.
Zu spät. Terbol landete auf dem Rücken des Anführers, noch bevor dieser reagieren konnte. Während er sich mit seinem linken Flügelarm an den Hals des Varixes klammerte, machte Terbol sich mit der anderen daran, das vorbereitete Zaumzeug zu befestigen.
Der Varix versuchte alles abzuschütteln. Terbol ließ sich nicht beirren. Die wilden Flugmanöver verwirrten den Schwarm. Aufgeregt flatterten sie umher, aber solange ihr Anführer keine Richtung vorgab, wussten die anderen Varixe nicht, wohin sie fliegen sollten.
Endlich hatte Terbol sein improvisiertes Zaumzeug festgemacht. Die Enden benutzte er gleichzeitig als Zügel und um sich festzuhalten. Der Varix ließ sich nur unwillig steuern. Aber er folgte in etwa der Richtung, die Terbol durch Drehen seines Kopfes mit den Zügeln vorgab.
Der junge Parstakoi genoss das Gefühl, auf dem riesigen Varix zu reiten. Er hatte eine Flügelspannweite von über zwanzig Metern. Noch nie war Terbol so schnell geflogen. Sie rasten ganz knapp über den Baumwipfeln durch die Luft. Fast glaubte er zu spüren, wie sie ihn an den Fußsohlen kitzelten. Der Wind brauste in seinen Ohren, tausendfach verstärkt durch den Flügelschlag des Schwarms. Für einen Moment glaubte er, Stimmen zu hören, aber er hatte keine Zeit, um nach den Rufern Ausschau zu halten.
Terbol riss mit aller Kraft an den Zügeln und zog den Kopf des Varix hoch. Dieser folgte und begann zu steigen. Schnell gewannen sie an Höhe. Als die Lichtung mit den Rohstoffräubern in Sicht kam drückte er mit dem Fuß den Kopf nach unten. Der Anführer ging wie befohlen in einen Sturzflug über. Die Herde folgte.
Alles verlief nach Plan. Terbol war berauscht von Euphorie und jubelte laut. Plötzlich tauchten vor ihm drei Gleiter der Waldhüter auf. Terbol schaffte es gerade so, ihnen auszuweichen, aber der Schwarm rammte die Gleiter einfach vom Himmel.
Sein Varix stürzte in die Lichtung. Jetzt war der Moment gekommen, abzuspringen. Er schlug heftig mit den Flügeln, um Höhe zu gewinnen. Unter ihm rammte der Anführer mit seiner gepanzerten Schädelplatte eine der Maschinen.
Es gab ein lautes „Klonk“, das wie der Schlag auf einen schlecht abgestimmten Gong klang. Unmittelbar darauf wurde es zu einem ohrenbetäubenden Trommelwirbel, als der Schwarm dem Beispiel seines Anführers folgte.
Sekunden später war alles vorbei. Die Varixe hatten den Zusammenstoß mit den Metallmonstern größtenteils unbeschadet überstanden und sich fluchtartig aus dem Staub gemacht. Nicht so die Maschinen. Was immer die Rohstoffräuber mitgebracht hatten, war jetzt Schrott. Dazwischen lagen, kaum zu erkennen, die zertrümmerten Gleiter der Waldhüter.
Terbol nützte die Thermik aus und kreiste im Gleitflug über dem Trümmerfeld und war außerordentlich zufrieden mit sich. Nur die abgestürzten Gleiter der Waldhüter störten etwas sein Hochgefühl. Aber das würde sich schon finden. Schließlich hatte er ihren Job gemacht und den Rohstoffräubern das Handwerk gelegt. Er freute sich schon auf die öffentliche Belobigung.