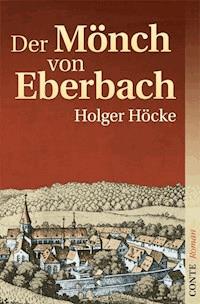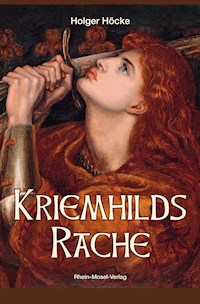
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Wie schon in "Kriemhild und ihre Brüder" erzählt Holger Höcke die Sagen- und Märchenwelt des Nibelungenliedes kraftvoll und spannend. Die Fortsetzung des spannenden Nibelungenromans behandelt die Zeit nach Siegfrieds Tod und der Versenkung des Nibelungenhorts im Rhein. Kriemhilds Trauer um ihren ermordeten Ehemann ist nach wie vor tief. Doch als der Hunnenkönig Attila um die attraktive Witwe wirbt, flammt ein alter Gedanke wieder auf, und ein Schwur von einst kann nun wahrgemacht werden: Endlich kann sie als Attilas Gemahlin Rache nehmen an Hagen von Tronje, dem Mörder. Doch wie werden sich ihre Brüder Gunther, Gernot und Giselher verhalten? Stehen sie zu Hagen oder sagen sie sich von ihm los? Während ein unbarmherziges Schicksal seinen Lauf nimmt, findet Giselher Erfüllung in der Liebe. Doch wie alles Glück ist auch dieses bedroht und zerbrechlich. Und dann ist da noch ein geheimnisvoller Junge, der seine Herkunft nicht kennt. Ihn zieht es nach Worms, wo einst alles begann …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2022 – e-book-AusgabeRHEIN-MOSEL-VERLAGZell/MoselBrandenburg 17, D-56856 Zell/MoselTel 06542/5151 Fax 06542/61158Alle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-89801-920-0Ausstattung: Stefanie ThurTitelbild: Joan of Arc, Dante Gabriel Rossetti 1882
Holger Höcke
Kriemhilds Rache
Roman
Rhein-Mosel-Verlag
… von weinen und von klagenmuget ir nu wunder hœren sagen.Nibelungenlied
Höre. Ich will dir ein Geheimnis sagen: Frühling stürzt in Sommer, Sommer in Herbst, Herbst in Winter. In was kann der Winter stürzen, wenn nicht in Tod? Jeder Winter ist der letzte, wie jeder Tod der einzige ist. Werner Bergengruen: Das Buch Rodenstein
Prolog
Kalte Härte.
Es war, als wären selbst die Wolken am Himmel erstarrt. Weiße und graue Schroffheit allenthalben, kein grüner Zweig, kein Blau von Wasser oder von Himmel. Wochenlang waren dicke Flocken gefallen und hatten alles zugedeckt, auch das Rot, das weiche, sprudelnde, lebendige Rot, von dem es so viel gegeben hatte. Strenger Frost in den Nächten machte alles noch schroffer: verharschter, schmutziger Schnee, hässlich und kalt.
Hier in den Niederungen des großen Flusses, unterhalb des steil aufragenden Aggsteins, war die Uferstraße seit Wochen unpassierbar. Erst war das Hochwasser gekommen, dann der Frost, der das von den Römern angelegte Pflaster sprengte. Dann kamen die Eisplatten, die von den eisigen Fluten an Land gespült wurden. Der Ufersaum glich einer wilden Landschaft aus weißen Trümmern, bizarr aufgetürmt zu Eisgebirgen, darunter irgendwo die Wasser der Donau, die ihren ewigen Lauf von West nach Ost nahm und die Reiche und Völker – scheinbar – verband.
Schwarz hob sich vor der weißen Kulisse das Skelett eines alten Baumes ab. Ein Apfelbaum vielleicht, der an der Uferstraße gestanden hatte und Frucht gebracht haben mochte, Jahr für Jahr, Herbst für Herbst. Jetzt hatte ihn das scharfe, kalte Eis gefällt und sterben lassen.
Auf einem Ast saßen drei Krähen, noch finsterer als der Baum. Unbeweglich. Lautlos. Mit einem Mal hob einer der Vögel den Kopf ein wenig an, dann wetzte er den Schnabel am toten Holz. Er schien etwas erspäht zu haben. Dann hob er sich mühsam in die Lüfte, die Kälte hatte wohl seine schwarzen Schwingen starr gemacht. Der Vogel schien seine letzten Kräfte zu sammeln für diesen Flug, und schließlich erreichte er sein Ziel. Halb unter einer Eisscholle verborgen, ragten die Reste eines menschlichen Leichnams heraus, die Flanke mitsamt dem Kettenhemd aufgerissen von der scharfen Kante der Scholle, vielleicht auch von einer tödlichen Waffe.
Als die Krähe mit vollem Schnabel zu ihrem Ast zurückkehrte, saß dort nur noch eine ihrer Artgenossinnen. Die andere war heruntergefallen und lag im Schnee.
Doch es war nicht nur Tod im Tal des Flusses. Unweit des Baumgerippes hatten sich die Brocken und Schollen zu einer Art Hügel aufgetürmt. Im Inneren hatte sich eine Eishöhle gebildet, in der zwei Gestalten ihr Lager hatten. Deren untere Hälfte wurde vom frostigen Wasser umspült; die Oberkörper ruhten auf Eis und glattem Stein. Uralt wie vom Anbeginn der Zeit, und doch stets frisch und jung zugleich. Mit gedämpften Stimmen unterhielten sie sich; es war, als hätte der strenge Winter die Zungen der beiden Flussgötter gelähmt, aber vielleicht mehr noch der Inhalt ihres Gesprächs, der sie fast flüstern ließ.
»Wie lange ist das nun her, Bruder?«, fragte die Donaugöttin.
»Du meinst, dass wir uns zuletzt gesehen haben?«, erwiderte der Rhein.
»Ja. Waren es zehn Jahre? Eigentlich hatten wir uns ja vorgenommen, uns nach einem Jahr wieder zu treffen.«
»Ein gutes Dutzend Jahre sind ins Land gegangen. Zunächst vier und dann noch gute acht Unglücksjahre.« Der Alte vom Rhein blickte betrübt drein. »Unglück? Hm, hm … Das Wort Unglück reicht sicher nicht aus, das zu beschreiben, was passiert ist. Katastrophe trifft es eher. Hätten wir damals geahnt, was geschehen würde, wir hätten eingegriffen.«
»Du weißt, was sich ereignet hat?«
»Wie sollte ich nicht? Sterbliche und Unsterbliche haben die Kunde schon verbreitet. In groben Zügen weiß ich von einem Untergang, der beispiellos ist in der Geschichte. Doch möchte ich alles wissen. Vor allem will ich hören von meiner Schönen, der Lieblichen aus Worms.«
Der Alte wischte sich mit dem Arm über die Augen und ließ sich kurz in die eisigen Fluten sinken. Die Donau merkte wohl, dass er seine Tränen nicht zeigen wollte.
Als er wieder an die Oberfläche kam, tat er laut einen Ausruf, und seine Stimme wurde in der Eishöhle zu hallenden Echos: »Frieden!«
Er machte eine Pause und warf die lange, nasse Mähne zurück. »Frieden. – Das war es, was ich erhoffte, als ich vorschlug, dass wir uns nach einem Jahr wiedersehen, liebe Schwester. Was ich dir damals erzählt hatte, war schon schlimm genug …«
»Und was ich dir jetzt erzähle«, sagte die Donau und legte ihm eine Hand aufs Haupt, »es tut mir leid, aber alles ist noch viel schlimmer geworden. Das, was du mir berichtet hast, es war ein Windhauch gegen die Ereignisse, die sich an meinen Ufern zugetragen haben.«
»Es ist kaum zu glauben. Das ist mehr, als Sterbliche ertragen können.«
»Es ist auch mehr, als Unsterbliche wie wir ertragen können.«
Beide schwiegen eine Weile. Der Alte zog sich mühsam ein paar Eisstückchen aus seinem langen, struppigen Bart.
»Deine Schöne aus Worms«, fuhr die Donau fort, »sie ist auch zu meiner Freundin geworden in all den Jahren.«
»Hatte sie denn noch irgendeine Spur von Anmut? Liebreiz? So wie sie früher einmal gewesen war? Zuletzt hatte sie sich doch das volle rote Haar abgeschnitten. Sie sah aus wie eine geschorene Hexe.«
»Sie trug es länger, aber zunächst noch streng zusammengebunden. – Doch was mich auch interessiert: Was ist aus dem Schatz geworden?«
»Wie kannst du nach dem Hort fragen?« Der Rhein wurde barsch. »Wo es doch um das Schicksal von Menschen geht. Ich will wissen, was passiert ist. Was ich bislang nur in groben Zügen weiß, das alles will ich erfahren, jede Einzelheit …«
»Sei nicht so streng mit mir, Bruder. Es gibt noch Lebende, die Gutes tun können. Der Schatz kann ihnen dabei helfen. All das Gold, in den richtigen Händen …«
»Gold, Gold!«, unterbrach der Alte unwirsch. »Etwas anderes kennen sie nicht als Geld und Gold!«
»Hast du es noch?«, insistierte die Donau. »Ist es noch dort, wo es damals war, du weißt schon …?«
»Ich erzähle es dir am Ende. Jetzt bist erst du dran mit deinem Bericht. Deshalb sind wir hier.« Der Flussgott schlug ungeduldig mit beiden Händen aufs Wasser, Tropfen spritzten auf, fielen wieder herunter und klatschten auf die beiden Wesen in der Höhle. »Ich halte es nicht mehr aus in dieser Eisgrotte. Hier fühle ich mich nicht frei.« Er tauchte unter und war kurz darauf verschwunden.
Die Schwester zuckte mit den Schultern und folgte ihm nach draußen.
Die klare Luft wurde inzwischen von der Wintersonne erhellt. Doch sie hatte nichts Wärmendes. Die beiden suchten sich einen Weg durch das weiße Eis, blieben in Ufernähe, wieder ragten ihre Körper halb heraus.
Der Blick des Alten fiel auf die Stelle, wo eben noch die Krähe gefressen hatte. Die neigte den Kopf und blickte vom Baum herab. Sie schien die Anwesenheit der Flussgötter zu spüren und öffnete den Schnabel, als wolle sie reden.
»Und der Tote da? Was war das für einer?«, stieß der Rhein traurig hervor. »Einer von meinen Gestaden oder von deinen?«
Die Donau schüttelte traurig den Kopf. »Von deinen. Einer, der fliehen konnte. Wenn auch schwer verletzt. Bis hierher hat er es geschafft, dann ist er vom Pferd gefallen. Im Spätherbst hat ihn das Eis konserviert.«
»Gefallen«, wiederholte murmelnd der Rhein.
»Ja, wie so viele. – Ich nehme ihn nachher zu mir und bereite ihm ein nasses Grab, bevor die Vögel das, was von ihm übrig ist, ganz auffressen. Hier bei der Nixe von Aggstein soll er Ruhe finden.«
»Gut so.« Der Alte hatte sich wieder etwas beruhigt. »So erzähle nun von Beginn an, von dort, wo wir damals stehen geblieben waren, vor gut zwölf Jahren.«
»Das kann ich nicht.«
»Wie das?«
»Erst bist du dran, mein Lieber. Denn der erste Teil der Geschichte spielt wiederum an deinen Ufern. Zwar kann ich mir diesen Teil ungefähr erschließen; ich will aber wie du alles ganz genau erfahren. Wie sagtest du so treffend? Jede Einzelheit.«
»Du hast recht. So lass uns reden. Erst ich, dann du.«
»Wir ergänzen einander«, stimmte die Donau zu. »Immer wieder im Wechsel, wenn nötig.«
»So soll es sein. – Beginnen wir im Jahre … hm, wann war das doch gleich?«
»Im Jahre des Herrn 430.«
»Lass uns gleich vier Jahre überspringen, in denen sich wenig ereignet hat. Vier Sommer und Winter waren also vergangen, seit wir beide uns zuletzt gesehen hatten. Kriemhild lebte immer noch in Worms, und ihr Söhnchen Gunther war gerade fünf Jahre alt …«
1. Kapitel Kloster und Grab
Kriemhild lauschte.
Etwas summte und brummte um ihren Kopf herum, störte ihre Andacht. Gedankenverloren griff sie über sich in die Luft und berührte kurz etwas Vibrierendes, das sofort entwich. Sie schaute nach oben, und der feine schwarze Schleier, den sie über dem Kopf trug, rutschte nach hinten und blieb an dem festen Knoten hängen, zu dem sie ihr Haar im Nacken zusammengezwungen hatte. Das Insekt flog hastig davon in Richtung Klostermauer und kam gleich darauf zurück, um eine Armlänge vor Kriemhilds Gesicht in der Luft stehen zu bleiben, eine dünne, leuchtend blaue Nadel. So blau waren Siegfrieds Augen gewesen.
Die Libelle schien die Witwe neugierig anzuschauen, drehte dann endgültig ab und verschwand in Richtung eines kleinen Baches. Kriemhild bückte sich, streichelte, was da wuchs, spürte saftiges Gras und die fleischigen langen Blätter von Traubenhyazinthen. Sie berührte die schwere braune Erde darunter und dann raschelte altes, totes Laub unter ihren Händen. Die Fingernägel kratzten im harten Grund, die Kuppen bohrten sich ein.
Plötzlich waren andere, wohlklingende Geräusche in der Luft, aus der Klosterkirche kam hoher Gesang aus dreißig Mönchskehlen, friedlich und getragen, eine Ahnung nur, wie ein feines Band, das sich durch die Luft wand. Einer der Brüder musste die Kirchentür geöffnet haben, um die sanfte Frühlingsluft hereinzulassen. Kriemhild betrachtete ihre Hände, rieb die bröckelnde Erde ab und kratzte sie sich aus den Fingernägeln. Sie hob den Kopf. Nicht graben, dachte sie. Ich soll nicht graben, ich darf nicht graben. Der Abt hat es gesagt. Pater Johannes, er ist mir gut. Sie zog den Schleier wieder über Kopf und Augen und stand auf. Wenn ich weiter wühle, könnte ich auch die Wurzeln des Rosenstrauchs beschädigen.
»Wo ist er?«, sprach sie, zur Erde gewandt. »Wie oft habe ich dich schon gefragt, mein Gemahl? Könntest du mir doch antworten.«
Sie betrachtete das schlichte graue Kreuz aus hartem Odenwälder Granit, auf dem grüne und gelbe Flechten ein unregelmäßiges Fleckenmuster gebildet hatten.
»Ist er bei dir? Ist er noch am Leben?«
Sie lauschte erneut. Der Gesang hatte aufgehört, der Mittagsgottesdienst war zu Ende.
Plötzlich fiel ein Schatten auf das Grab. Kriemhild spürte eine Hand auf ihrer Schulter und erschrak.
»Auf ein Wort, Königin.«
»Pater Johannes, ich habe gar nicht … ich war …«
Der Abt schüttelte milde lächelnd den Kopf und schlug wortlos seinen rechten Arm um sie. Sein schwarzes Ordensgewand hatte die Wärme der Frühlingssonne gespeichert. Sein grauer, langer Bart kitzelte sie im Gesicht, sein Atem roch ein wenig säuerlich, nach Wein.
Der Abt hatte eine große Kanne mitgebracht. Er nahm ihre Hände und spülte die Erdreste mit einem sanften Guss ab. Den Rest des Wassers schüttete er an den Rosenstrauch.
»Schau«, sagte er freundlich, »das Leben. Wie es sich Bahn bricht, wie es überall blüht.« Er nahm eine kleine, noch geschlossene Rosenknospe in die Hand und lächelte Kriemhild an. »Wie mild es schon ist für diese Jahreszeit.«
Kriemhild spürte die Wärme in seiner Stimme. Und zugleich wusste sie, was nun kommen würde. Die Moralpredigt. Nicht in der Erde wühlen. Die Toten ruhen lassen. Doch es kam anders.
»Schau, Königin«, murmelte Johannes, sich mehrmals räuspernd, er strich sich umständlich den langen grauen Bart, »Trauer ist gut. An sich. Du kommst nun Woche für Woche her. Und das seit Jahren. Und solltest doch …«
»Was sollte ich, Pater Johannes?«
»Du solltest deinen Kummer zu Gott tragen. Mit ihm musst du reden, weniger mit deinem toten Mann. Zu Gott dem Vater kannst du all deinen Kummer tragen, er selbst hat …«
»Verzeih mir, Pater!«, unterbrach Kriemhild und ballte die Fäuste. »Gott? Dein Gott mit seinem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist – er hat meine Gebete nicht erhört. Manchmal denke ich tatsächlich, ich sollte mich wieder an die alten Götter wenden. Wenn ich an Donars Kraft denke, an Baldurs Schönheit …« Ihre Rede brach ab; sie merkte, was für eine Zumutung ihre Worte für einen Ordensmann waren.
Der Abt sagte nichts, nahm ihre Hand und führte sie zu einer Bank, die im Schatten unter einer alten Ulme lag. Er nahm in der Mitte Platz, Kriemhild setzte sich ans linke Ende.
»Ich habe es dir schon oft gesagt: Du trägst noch Hass in dir. Hass ist nicht gut. Er zersetzt denjenigen, der ihn in sich trägt. Er ist wie Säure, in der sich Fleisch auflöst. – Vergebung! Das ist der Weg, den du beschreiten solltest. Bedenke doch: Nach so vielen Jahren! Du musst Abstand gewinnen, vielleicht kannst du bei Hof wieder am Leben teilnehmen und einen neuen Mann finden.«
»So viele Jahre?« Sie schüttelte den Kopf. »Sag mir: Wie lange ist es denn her?«
»Fast vier Jahre sind nun vergangen seit dem Tod deines Mannes. Vier Jahre sind eine lange Zeit.«
»Vier? Nein. Nein, niemals. Nicht länger als ein, zwei Jahre! Eigentlich kommt es mir so vor, als sei es erst ein paar Wochen her. Mein Gott, diese Endgültigkeit: Es ist, als sei die Sonne fort und ewige Nacht umgibt mich.«
»Die Trauer hat dich blind gemacht, Kriemhild. Blind und unempfindlich gegen den Lauf der Zeiten. Woche für Woche lässt du dich hier herüberbringen, an jedem Donnerstag, Sommer wie Winter. Du hättest damals nach Xanten gehen können mit deinem Schwiegervater. Doch du wolltest hierbleiben, um trauern zu können an Siegfrieds Grab. Ich sagte es schon: Trauer ist gut, aber im Übermaß ist sie schädlich. Vier Jahre ist es her. Du glaubst mir nicht? Schau dein Haar, wie es wieder gewachsen ist. Du hattest es abgeschnitten damals. Du hattest kurze rote Stoppeln wie ein abgeerntetes Getreidefeld. Mach dein Haar auf, löse den Knoten.«
Der Abt kam näher, Kriemhild rückte weiter nach außen, spürte plötzlich Leere unter sich, und hätte Johannes sie nicht rasch am Arm gepackt, wäre sie von der Bank gefallen. Erneut nahm er sie in den Arm, dann zog er behutsam die Nadeln heraus, die das Haar eingesperrt hielten wie in einem Käfig.
Das steht ihm nicht zu, dachte Kriemhild empört, er ist ein Mönch. Das letzte Mal, dass mir jemand ins Haar gegriffen hat, war es Siegfried. Sie wehrte sich aber nicht. Ein überraschender Augenblick des Begehrens flammte in ihr auf, der wahnsinnige Gedanke, wie es wäre, wenn der Abt sein altes Gesicht ihrem näherte, seinen Mund auf ihren presste und …
»Schau dein Haar«, wiederholte Johannes. Sie glaubte, Erregung in seiner Stimme zu hören. »Es hat keinen Glanz, es ist brüchig, aber es reicht dir wieder fast bis zur Brust!«
Kriemhild biss sich auf die Unterlippe. »Und wenn es so wäre – dann ist er schon zwei Jahre weg.«
»Du irrst dich. Vier. Vier Lenze, vier Sommer, vier …«
»Nein«, unterbrach Kriemhild und merkte, wie sich ihre Augen füllten. »Der andere.«
Der Abt schlug sich an die Stirn. »Du sprichst von Gunther, deinem Sohn.«
Sie nickte wortlos und ließ den Kopf hängen.
»Er müsste nun fünf Jahre alt sein, nicht wahr?«
»Ich weiß nicht. Zwei, vier, fünf? Was spielt das alles für eine Rolle? Die Zeiten sind durcheinander. Siegfried tot, mein Sohn fort, in Burgund regieren Schlangen, vorhin habe ich eine Libelle gesehen, und man sagt, Rom gibt es nicht mehr lange. Solange ich hierherkommen kann, geht es mir gut. Vielleicht sendet mir Siegfried doch einen Engel oder erscheint mir im Traum und sagt mir endlich, wo mein Kind ist. Von Gott erwarte ich nichts mehr, vergib mir, Pater Johannes.«
Kriemhild merkte selbst, wie wirr ihre Rede war, und brach abrupt ab. Sie griff unter ihr Gewand, wo sie als junges Mädchen ein silbernes Kreuz getragen hatte. Dort hing nun an einem Lederband ein Säckchen, in dem sie einen Kieselstein aus dem Rhein trug. Nach Siegfrieds Beerdigung hatte sie ihn damals am Ufer aufgesammelt.
Johannes sagte etwas über Maria, die Himmelskönigin, die … Leiden … ihren toten Sohn im Arm … die Mutter des Herrn, sie könne doch …
Die Burgundentochter hörte nicht mehr zu. Sie nahm den Stein heraus und drückte ihn fest.
2. Kapitel Eiche und Erinnerung
Giselher sann.
Hier unter der alten Eiche, weit vor den Toren von Worms, hier hatte alles begonnen, vor so vielen Jahren. Hier waren sie damals aufgetaucht, die blau gewandeten Reiter mit ihrem stattlichen Anführer, der die Kraft von Göttern besaß und einen Drachen bezwungen hatte. Giselher erinnerte sich: Er selbst war noch ein junger Spund gewesen, heißblütig, aber grün und unerfahren. Hierher zu diesem prächtigen Baum war er in voller Waffenrüstung in einem seiner wilden Läufe gerannt, hatte seine Muskeln mit Klimmzügen gestählt und war müde eingeschlafen. Aufgeweckt hatte ihn die Stimme Siegfrieds, seines zukünftigen Schwagers.
Wenn ich damals geahnt hätte, was alles passiert, dachte Giselher, ich hätte ihm gesagt: Reite weiter mit deinen Leuten, such dir ein anderes Königreich, eine andere Braut, ganz weit fort, wo es noch mehr Drachen gibt, an denen du deine Kraft messen kannst.
Stattdessen ritt der große blonde Mann in Worms ein, wollte in einem seiner Wahnsinns-Anfälle Gunther zum Kampf fordern. Dennoch wurde er freundlich empfangen, mauserte sich schließlich zum Freund und half Burgund im Kampf gegen Sachsen und Dänen. Hier zeigte er erneut seine grausame, wölfische Seite.
Er errang die Liebe der Schwester der drei Könige Burgunds und verhalf Gunther mit seinen Riesenkräften und einer List, Brünhild, die Königin von Island, zur Frau zu gewinnen. Doch auch das stand unter keinem leuchtenden Stern: Brünhild, dieser stolzen Frau aus einer anderen Welt, diesem Wesen vom Meer, aus Salz, aus Eis und vielleicht auch aus Odins Kraft geboren, tat das Klima im warmen Germanien nicht gut. Erst recht nicht die Ehe mit Gunther. Dann war da noch der frevelhafte Betrug im Brautbett, um Brünhild hinterhältig zu bezwingen. Siegfried hatte die Königin des Nordens im Ringkampf besiegt und ihr den magischen Gürtel genommen. Seither hatte sich Brünhilds Verfall beschleunigt. Giselher dachte mit Schaudern daran, dass die einst so wunderschöne Frau inzwischen sogar ein paar Zähne verloren hatte. Es war ein Wunder, dass sie noch lebte.
Der Streit der beiden Königinnen vor dem Portal der Wormser Kirche – Kriemhild, die Brünhild düpierte und als Erste durch das Portal schritt – mit Brünhilds Ring und Gürtel, ein Skandal, ein Schock.
Schließlich der Plan, Siegfried zu töten – an dem auch er, Giselher, mit beteiligt war –, reifte in den folgenden Wochen heran. Und er wurde Wirklichkeit im Mord im Odenwald, an der Quelle mit dem alten Lindenbaum. Hagen hatte dem Widersacher den Speer zwischen die Schulterblätter gerammt wie einer Bache den Sauspieß. Hagen, der Mörder: schuldig vor Gott und den Menschen. Der Täter hatte gar nicht gewollt, dass der Mord vertuscht wurde, im Gegenteil: Stolz war er sich sicher, als erster Diener und Heermeister Burgunds dem Reich einen Dienst getan zu haben. Gunther: ebenfalls schuldig. Gernot: schuldig. Er selbst, Giselher: schuldig. Kriemhild gebrochen, lebte in ihrem kleinen Häuschen in der Stadt, eine treue Dienerin an ihrer Seite.
Dann war da noch die Sache mit Gertrud gewesen, dem alten heilkundigen Kräuterweib, Kriemhilds Freundin. Eines Tages lag sie totgeschlagen in ihrer zerstörten Waldhütte, und die drei Könige Burgunds wussten, wer der Mörder war. Kriemhild wusste nichts, ahnte nichts. Irgendwann war auch Kriemhilds Hund gestorben. Die Schwester war vereinsamt, sie war niemals in die Burg zurückgekehrt, und mit Gunther und Gernot sprach sie überhaupt nicht mehr. Geschweige denn mit Hagen. Allein er, Giselher, besuchte sie hin und wieder.
Hagen hatte den Hort der Nibelungen, Siegfrieds Schatz, im Rhein versenkt – an einem Ort, den nur er kannte. Von seinen Begleitern, den Besatzungen der beiden Frachter, hatte man nichts mehr gehört. Der Goldschatz, der nach Siegfrieds Tod Kriemhild zustand, war aus dem Weg geschafft, und niemand hatte mehr nach ihm gefragt.
Träge waren die Jahre danach vergangen, langsam und zäh, und nichts passierte. Burgund lebte in Frieden mit den Nachbarn. Gunther wurde immer mürrischer und ging mehr und mehr zu seinen Edelhuren, weil seine graue, faltige Frau ihn abstieß. Die einzige Freude des Königspaares war ihr Sohn, Jung-Siegfried.
Gernot trank keinen Alkohol mehr und war dafür fromm geworden, was jedermann bei Hofe in ungläubiges Erstaunen versetzte. Der ehemalige Säufer betete viel, vor allem zu Maria, und zündete Kerzen in der Kirche an. Es war seine Art, mit der Schuld umzugehen.
Giselher blickte nach oben.
Ein frisches, grünes Blatt hing an einem Spinnwebfaden über seinem Kopf und sank langsam tiefer. Er pustete, und das Blatt bewegte sich im Hauch, drehte sich wie zum Tanz. Weiter oben im Baum schwankten ein paar Zweige, hin und wieder erklang ein Rascheln.
Welcher Hohn, dachte er, die beiden Kinder Gunthers und Siegfrieds, sie trugen jeweils den Namen des Vaters des anderen. Hätten Siegfried und Kriemhild gewusst, was geschehen würde, niemals hätten sie ihren Sohn Gunther genannt.
Hätte, wäre, würde, wenn und aber. Möglichkeiten, die die Pflugschar des Schicksals unter die Erde geschaufelt hatte, unwiederbringlich.
Jung-Gunther, er musste jetzt auch schon fünf Jahre alt sein. Die beiden Knaben waren fast gleich alt. Während der kleine Prinz Siegfried am Wormser Hof gedieh und zu einem munteren, neugierigen Knaben heranreifte, hatte sich der Weg von Gunther im Nebel des Nicht-Wissens verloren.
Als der Drachentöter starb, war der Sohn in Xanten gewesen, aber Kriemhild hatte ihn bald darauf zu sich geholt. Doch sie konnte sich seiner nicht lange erfreuen. Der Kleine war eines Tages fort, wie vom Erdboden verschluckt. Seine Mutter war im Kloster gewesen, so wie jeden Donnerstag. Siegfrieds Grab, es hatte eine geradezu magische Anziehungskraft, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Donnerstag, der Todestag Siegfrieds. Als sie zurückkam, war ihr kleiner Sohn fort. Die Dienstmagd wusste von nichts, sagte, das Kindchen habe in seinem Bettchen gelegen und geschlafen. Gunther hatte sie auspeitschen lassen wollen, doch er, Giselher, hatte widersprochen. Selbst Hagen legte ein Wort ein für die arme Frau. Wochenlange Nachforschungen hatten nichts ergeben – das Kind blieb verschwunden.
Giselher hatte sich damals schon gewundert, wie Kriemhild diesen erneuten Verlust überlebt hatte, war doch das, was ihr widerfuhr, mehr, als ein Mensch, eine Mutter zumal, verkraften konnte. Sie hatte nicht einmal viele Tränen vergossen, es schien, als wäre sie nach Siegfrieds Tod gar nicht mehr in der Lage zu weinen. Allein, sie sprach noch weniger. Wenn Giselher sie besuchte, hielt er oft nur ihre Hand. Wenn jemand etwas sagte, dann er. Vom Wald und von Wiesen, vom Zug und vom Gesang der Vögel. Vom Wachsen des Getreides und der Früchte. Die Schwester hörte stets zu, schaute meist aus dem Fenster, und wenn sie ihn manchmal ansah, war es, als blickte Giselher in ein leeres Haus.
Kriemhild, sie war nicht krank, aber auch ganz gewiss nicht gesund.
Giselher spürte, dass sein rechter Arm, den er sich unter den Kopf geschoben hatte, taub geworden war. Er stand auf, reckte und streckte sich. Einige Gelenke knackten wie totes Holz. Ich bin eingerostet, dachte er. Einst war ich ein Kämpfer, bezwang Alberich, den widerwärtigen Zwerg, Siegfrieds seltsamen Begleiter, vor der Höhle des Drachen; ich bin ein Mann geworden – und nun? Rost auf meinen Knochen, Rost auf Kriemhild, die Schwägerin Brünhild ein einziger Rosthaufen, Rost auf ganz Burgund. Ein Königreich, einst blanker Stahl, jetzt knirschend vor rotem Rost.
Giselher schüttelte den Kopf ob dieser Erkenntnis, grub seine Hände in den furchigen Stamm der Eiche, riss mit Gewalt ein Stück Rinde ab und tappte ziellos umher. Drei-, viermal umrundete er den Baum, die eine Hand immer am Stamm. Er dachte an die Quelle im Odenwald, den Ort des Meuchelmordes. Die Linde dort war vom Umfang her mit dieser Eiche vergleichbar. Niemals wieder waren sie am Schauplatz des Verbrechens gewesen, die drei königlichen Brüder. Wenn eine Jagd anstand, mieden sie das Gebiet weiträumig. Ein Fluch schien auf diesem Ort zu liegen.
Mit einem Mal kam ihm ein Gedanke. Was wäre, wenn …? Nein, abwegig, ich kann nicht, ich darf nicht, und sie wird niemals …
Noch einmal umrundete er den Baum, zuckte mit den Schultern, wog ab, verwarf und blieb dann doch dabei.
»Ich werde es ihr vorschlagen«, sagte er laut. »Vielleicht bewirkt es etwas. Schlimmer als jetzt kann es jedenfalls nicht werden.«
Wie zur Bestätigung ließ über ihm eine Krähe ein heiseres Krächzen hören. Es klang wie jemand, der eine schwere Halsentzündung hatte. Oder wie rostige Schwerter, die in lautem Knirschen aneinander gerieben wurden.
3. Kapitel Feuer und Frost
Gunther hustete.
Er verfluchte das Kratzen im Brustkorb, das ihn seit langem quälte. Seit einigen Wochen war ein seltsames Stechen in der Herzgegend hinzugekommen.
»Du kannst gehen«, sagte er nach dem Hustenkrampf zu dem Boten.
»Warte!«, rief Hagens Bruder Dankwart dem Mann hinterher. »Lass dir in der Küche zu essen geben. Sag dann zu Rumold, er soll dir eine Kammer zuweisen. Morgen kannst du gestärkt und ausgeruht wieder nach Hause reiten.«
»Du hast recht getan, uns zu informieren«, fügte Gernot hinzu.
Der Mann, der bislang vor dem Rat der burgundischen Edlen gestanden hatte, als hätte er die Hosen voll, verbeugte sich und verließ dann raschen Schritts den großen Saal.
Gunther blickte auffordernd in die Runde. Am Tisch saßen sein Bruder Gernot, Hagen von Tronje, Dankwart, Volker von Alzey und Ortwin von Metz, dazu der trotz seines hohen Alters immer noch rüstige Kaplan Bertram. In einem bequemen Stuhl in einer Ecke fast versunken, hatte Gunthers Mutter Ute Platz genommen, eine Decke über den Beinen. In ihrem Schoß saß sein Sohn Siegfried, der an einem Finger der linken Hand nuckelte und interessiert in Richtung Tafel schaute. Eine Weile sprach niemand.
Gunther strich sich über den schimmelgrauen Vollbart, den er sich im Winter hatte wachsen lassen. In den Gesichtern Gernots, Volkers und Ortwins las er Ratlosigkeit; Hagens Augen konnte er nicht sehen, da der Heermeister den Kopf in die Hände gestützt hatte und ein Brett mit Hartkäse anstarrte, als könne er dort die Zukunft lesen. Vielleicht zählte er auch einfach die Löcher.
»Also«, sagte Gunther. »Was denkt ihr?«
»Präfekt Rüdiger ist auf dem Weg nach Worms«, wiederholte Volker die Worte des eben entlassenen Boten.
»Ein weiter Weg«, meldete sich Dankwart zu Wort. »Präfekt Rüdiger hat seine Residenz in Pöchlarn an der Donau, das sind viele, viele Meilen. Er muss etwas Wichtiges zu sagen haben.«
»Zu sagen – oder zu verkünden«, schaltete sich Gernot ein. »Doch hoffentlich keine Kriegserklärung?«
»Das wäre fatal«, sagte Gunther und zog die Stirn in Falten. »Rüdiger ist ein Vasall des Hunnenkönigs Etzel. Falls er uns den Krieg erklärt, dann im Auftrag seines Herrn.«
Er fühlte sich unangenehm an die Ankunft seines Schwagers Siegfried erinnert. Mein Gott, dachte er, wie lange ist das schon her? Siegfried hatte damals sofort einen Zweikampf mit ihm, Gunther, gefordert, der Preis des Siegers sollte die Herrschaft über das jeweils andere Königreich sein.
Seine Gedanken wurden durch Ortwin unterbrochen: »Wir alle wissen, dass Etzel gefährlich ist. Greift er uns an, so haben wir ihm kaum etwas entgegenzusetzen. Burgund hat Frieden mit allen Nachbarn – unser Heer ist nicht mehr kriegserfahren, ihm fehlt die Übung.«
»Wir alle wissen auch«, knüpfte Volker an, »über welche Streitmacht Etzel gebietet. Seine Reiterhorden sind überall gefürchtet. Konstantinopel und Ravenna zittern vor ihm, sie können nur hoffen, dass er sich an die Bündnisse hält, die er mit ihnen schließt. Von den Langbögen seiner Männer erzählt man sich Wunderdinge. Die Durchschlagskraft …«
»Es sind vielmehr kurze Bögen, lieber Spielmann«, berichtigte Dankwart. »Eine spezielle Biegung sorgt für die Schnellkraft. Dazu kommt die Präzision der Schützen, und schon …«
»Ich glaube nicht«, schnitt Gunther ihm das Wort ab, »dass ein Mann wie Etzel es nötig hat, uns den Krieg zu erklären. Wenn er jemanden angreifen möchte, dann fällt er mit seinen Reitern einfach ein wie ein Sturmwind, und niemand kann ihm widerstehen. Rüdiger muss etwas anderes wollen.« Gunther presste die Lippen zusammen und hoffte, dass die Zuversicht seiner Worte in sein eigenes Herz einsickerte.
»Die Hunnen sind Heiden«, murmelte der Kaplan wie zu sich selbst, »sie glauben nicht an unseren Gott.« Doch niemand achtete auf ihn.
Prüfend schaute Gunther in die Runde, und plötzlich bemerkte er etwas. »Wo ist eigentlich Giselher?«
»Er ist offenbar mit unserem Schwesterlein unterwegs«, sagte Gernot. »Hat mich nicht aufgeklärt, was genau er wollte. Tat ganz geheimnisvoll. Sprach von einem Durchbruch …«
»Durchbruch, Durchbruch«, äffte ihn Gunther ärgerlich nach. Das Bild von tausend wilden, schlitzäugigen Reitern, die, Pfeil um Pfeil abschießend, die Stadttore von Worms durchbrachen, kam ihm in den Sinn; er merkte, wie das Blut sein Gesicht und seine Stirnglatze erhitzte.
»Volker, du kannst dir jedenfalls schon mal ein Lied ausdenken, das dem Hunnenkönig huldigt. Das kommt sicher gut an.«
Der Spielmann antwortete nicht, sein Blick schien durch Gunther hindurchzugehen. Mit einem Mal wurde sich Gunther gewahr, dass jemand hinter ihm stand, und er wusste auch wer. Sein Sohn sprang vom Schoß der Großmutter auf und rannte los. Brünhild hatte den Saal betreten und sich genähert, lautlos und unbemerkt, wie es ihre Art war. Ein Schatten, ein Gespenst. Die weißen Haare hingen ihr ins Gesicht. Das Kind eilte auf sie zu und umarmte sie. Sie streichelte ihm zärtlich die Wangen, küsste seine Stirn. Weiberkram, dachte Gunther. Dass sich der Sohn immer noch an die Mutter anschmiegte, ärgerte ihn. Er sollte allmählich an die Waffen herangeführt werden.
»Was kann er wollen?«, fragte Brünhild, und Burgunds König wunderte sich mehr über die offensichtliche Neugier in ihrer Stimme als über die Tatsache, dass sie genau wusste, worüber gesprochen worden war. Seit Jahren lebte Brünhild apathisch an seiner Seite – ihre einzige Aktivität schien darin zu bestehen, zu altern. Wie alt ist sie eigentlich, fragte sich Gunther. Er wurde sich bewusst, dass er nie gefragt hatte, wie alt seine Frau war. Dreißig, fünfzig oder tausend Jahre – was spielte das für eine Rolle bei einem solchen Wesen?
Er wusste, dass Brünhild heimlich den alten Göttern huldigte. Manche sagten, dass sie eine Walküre sei – oder zumindest gewesen war –, ein geheimnisumwittertes Geistwesen aus dem Gefolge des Göttervaters Wodan. Ein Jahr nach der Geburt ihres Sohnes Siegfried war Brünhild aus dem gemeinsamen Schlafgemach ausgezogen und hatte ausgerechnet die Kammer bezogen, die damals Siegfried von Xanten bewohnt hatte. Mit Fichtenzweigen hatte sie sich vor der Fensternische eine Art künstlichen Hain errichten lassen – so wie früher die Menschen nördlich der Alpen in den Wäldern den alten Göttern gehuldigt hatten –, und pflegte dort in ihrer isländischen Sprache zu beten. Die Knechte mussten immer dafür sorgen, dass frisches Grün in der Kammer war; wehe, wenn trockene, braune Nadeln auf dem Boden lagen.
Und noch etwas setzte Gunther in Erstaunen. Brünhild trug an der linken Hand ihren Ring und über dem Gewand ihren Gürtel, jene Utensilien, die ihr einst die gewaltige Stärke verliehen, ihre Kraft aber verloren hatten, seit Gunther damals die starke, blonde Frau mit Siegfrieds Hilfe im Brautbett genommen hatte. Genommen, das hieß: unterworfen wie ein störrisches Pferd, das man mit Sporen qualvoll zureitet. Gunther erinnerte sich, dass man Kriemhild damals nach Siegfrieds Tod die beiden Gegenstände abgenommen und an Brünhild zurückgegeben hatte.
Er schüttelte unwillig den Kopf. Brünhild trat an den Tisch heran, sie schenkte sich aus einem Krug Wein in einen Kelch und trank einen kleinen Schluck. Ihr Sohn wich nicht von ihrer Seite. Sie umrundete die Tafel und aller Augen folgten ihr. Hinter Hagen von Tronje blieb sie stehen. In diesem Moment wurde Gunther bewusst, dass der Heermeister noch kein Wort gesprochen und sich kaum bewegt hatte. Sein Kelch stand noch unberührt vor ihm neben dem Käsebrett. Trübe starrte Hagen mit seinem linken Auge vor sich hin.
»Hagen!«, versuchte Gunther wieder das Heft in die Hand zu nehmen. »Was denkst du? Du kennst Rüdiger von früher.«
Er spielte auf eine Begebenheit vor vielen Jahren an: Damals war Hagen als junger Mann zusammen mit Rüdiger eine Weile an Etzels Hof gewesen.
Da kam Leben in den alten Heermeister. Langsam drehte er sich um und schaute seine Herrin an, als nähme er sie eben erst wahr. Strenge lag in seinem Gesicht, ein geradezu schrecklicher Ernst, dachte Gunther. Sein alter Gefährte Hagen – er wirkte seit Jahren unzufrieden und müde. Er war ein Mann des Krieges, des Kampfes. Gunther wusste, dass er sich in Friedenszeiten nach ein paar Monaten schon langweilte. Und nun herrschte – abgesehen von einem Scharmützel im Norden mit ein paar marodierenden ehemaligen römischen Soldaten im vergangenen Jahr – seit über einer Dekade Frieden.
Hagens Stimme war seltsam rau, als er sprach: »Es hat nichts Gutes zu bedeuten.« Mühsam, als hätte er Schmerzen, drehte er sich wieder in Richtung Tischplatte, zog sein Messer, das er immer am Gürtel trug, und schnitt sich mit einer raschen Bewegung der linken Hand ein Stück Käse ab. Er spießte es auf die Messerspitze und betrachtete es versonnen. Seine Handknöchel waren weiß, so fest hielt er das Messer. Alle schauten ihn an, warteten auf die Fortsetzung.
»Es kommt etwas auf uns zu«, murmelte Hagen.
»Was …«, wollte ihn Gernot unterbrechen, doch der Einäugige sprach unbeirrt weiter: »Ich spüre eine große Hitze. Ein Feuer wird kommen.« Mit einem Ruck griff er mit der Rechten nach Brünhilds Hand; er nahm ihr den Kelch weg und stürzte dann mit einem Schwall den Rest des Weines in die Kehle, als wolle er den Brand löschen, von dem er gesprochen hatte.
Da stand Ute auf. »Mein Traum«, sagte sie. »Beim leibhaftigen Gott, ich hatte einen Traum. Lange ist es her, lange …«
Gunther wusste nichts mehr zu sagen. Seine Mutter fixierte Hagen, der starrte zurück, es war eine furchtbare Spannung im Raum. Sein Sohn schluchzte auf.
Gunther spürte nichts von der Hitze, von der sein Heermeister sprach. Vielmehr war es ihm, als striche ein eisiger, froststarrer Finger von oben nach unten über seine Wirbelsäule. Was würde kommen?
Gunther hustete.
Gunther fror.
4. Kapitel Quelle und Qual
Kriemhild schluckte.
Erst war ihr Mund trocken gewesen auf dem langen Ritt, doch seit sie hier weilte, war es, als hätte die frische Quelle geradezu zum Sprudeln ihres Speichels geführt. Fürwahr ein seltsamer, ein magischer Ort. Sie presste Flüssigkeit zwischen den Zähnen hindurch, schluckte erneut.
Eigentlich ein wunderschöner Platz, dachte sie und kniete sich nahe an der Quelle hin. Frisches Wasser, ein hoher Baum, der die grelle Sonne abhielt. Leider hatte er den Tod nicht abhalten können. Sie streichelte mit der Hand über das frische grüne Moos, das im Schatten der Felsen und am Fuß der alten Linde auf breiter Fläche den Boden bedeckte. Die Farbe erinnerte sie an Siegfrieds Schwert Balmung, dessen Klinge grünlich-blau geschimmert hatte.
Mit einem Mal wollte Kriemhild mehr, wollte spüren und riechen; sie riss ein Büschel Moos aus, rieb sich die Wange damit, weich war das Geflecht, sie hielt es sich unter die Nase, atmete, schnupperte und sog dann tief den herb-würzigen Duft der Pflanze ein.
»Hier ist es geschehen?«
»Ja«, bestätigte Giselher und räusperte sich. »Hier war es.«
Kriemhild nickte. Ein leichter Wind kam auf und strich durch die Zweige der Linde. Ein erster Hauch Süße war in der Luft, eine Ahnung von Blütenduft und Sommer.
Mit einem Mal war alles in ihr wieder da, das Schwimmen im See, der erste Kuss, die erste intime Berührung, der Sommer voller aufregender Nähe und lustvoller Intensität. Giselher sprach etwas, doch sie hörte nicht hin. Alles war in ihr präsent und lebendig, Liebe und Leidenschaft, Sonne und Siegfried.
Sie lächelte.
Weiter unten, wo der Bach die Lichtung verließ und in den Wald eintrat, trank ein kleiner Vogel, flatterte auf und verschwand dann in den Baumkronen.
Giselher blickte sie an, nahm ihr Lächeln wahr, er schien erleichtert und zeigte auf ihre Hände. Dann benetzte er ein Tuch in der kühlen Quelle und reinigte ihre Hände vom feuchten Erdreich. Es fühlte sich gut an, weich und behutsam.
Seltsam, dachte sie. Das ist nun schon das zweite Mal in kurzer Zeit, dass mir ein Mann die Hände wäscht. In diesem Augenblick sprach Kriemhild ihren Bruder in Gedanken frei. Erteilte ihm Absolution.
»Geht es dir gut, Schwester?«
»Gut?«, wiederholte sie. Was meinte er? Gut wie damals? – »Es geht mir nie wieder gut.«
»Dein Verlust …«, sagte Giselher und brach dann ab. Er setzte sich zu ihr ins Gras und hielt die Hand ins frische Wasser. »Dein Mann … Siegfried … Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll …«
Giselher schöpfte Wasser mit der hohlen Hand und atmete schnaufend aus. Er wand sich, etwas wollte aus ihm heraus. »Es hat dir noch keiner gesagt …«
»Dass er tot ist? Willst du mich verhöhnen?«
Giselher schüttelte unwirsch den Kopf. »Er ist seit vier Jahren tot, Kriemhild. Das ist es nicht, was ich meine.«
Kriemhild verzog das Gesicht. Mit einem Mal hatte sich das Wasser einen neuen Weg gesucht. Es rann nicht mehr nur im Bachbett und in ihrem Mund, es rann auch über ihre Wangen.
»Gut«, sagte Giselher und stand auf. »Gut, gut, gut. Wenn das so ist. Ein andermal. – Übrigens: Ich habe noch etwas für dich. Es wird dich vielleicht aufmuntern.« Er ging zu seinem Pferd, griff in die Satteltasche und zog etwas hervor. Rückwärts kam er wieder auf sie zu und verbarg mit dem Körper, was er geholt hatte.
»Augen zu!«
Kriemhild wollte der Bitte nicht gehorchen, zierte sich und schloss dann doch die Augen.
Der Bruder drückte ihr etwas in die noch feuchten Hände. Sie spürte eine Art Stoff. Es war ein leichtes, spinnwebdünnes Kleidungsstück, das sie sehr gut kannte. Ihre Lider hoben sich.
»Nutze es«, sagte Giselher, und plötzlich war Schärfe in seiner Stimme: »Aber mit Vorsicht!«
Neue Erinnerungen strömten ein in Kriemhild, die erste Liebesnacht: nackt bis auf dieses Kleidungsstück, das zuerst der Liebste und dann sie selbst getragen hatte.
Kriemhild hatte plötzlich das Gefühl, nicht mehr atmen zu können.
Sie sprang auf und zog sich das feine Gewand über den Kopf. Sofort spürte sie die Wirkung. Erst verschwanden ihre Hände und Füße, dann die Arme und Beine und schließlich auch der Rumpf samt Kopf. Sie ging leise am Bruder vorbei, stand jetzt unmittelbar hinter ihm.
»Das Schwert wäre mir lieber gewesen!«, rief sie laut.
Giselher fuhr erschrocken herum und stieß einen Laut des Schreckens aus.
Dann rannte sie los, in den dichten Wald, dorthin, wo der Vogel verschwunden war.
»Kriemhild!«, rief Giselher laut hinter ihr her. Es klang besorgt, ja verzweifelt. »Sei vorsichtig! Nutze sie nicht zu oft! Mein Gott, ich wollte dir eine Freude bereiten! Nein, nein, nein! Halt, warte! WARTE DOCH! Mein Gott, da zeigt sich schon ihre Macht. So wollte ich das nicht …«
Kriemhild rannte, brach sich ihren Weg durch Unterholz und Gebüsch. Kaum noch war die Stimme des Bruders zu vernehmen.
Nur noch ein Wort konnte sie hören: »Teufelszeug!«
5. Kapitel Flucht und Felsen
Kriemhild rannte.
Hatte es plötzlich abgekühlt, oder war es nur der Luftwiderstand, dieses Kältegefühl am ganzen Körper? Frösteln, Bibbern, Gänsehaut.
Sie raste rücksichtslos durch Holz und Hecken, stolperte mehrmals, spürte trockene Fichtennadeln und Laub vom Vorjahr, die sich auf ihrem Gewand sammelten, rannte und rannte, an nichts denkend, außer an das Schwert. Mit einem Mal war er da gewesen in ihren Gedanken, Siegfrieds Balmung, die Meisterwaffe, der Drachenaufschlitzer, der Sachsentöter. Und mit jedem wilden Schritt durch den Wald klang es in ihr wie ein Marschtakt: das Schwert, das Schwert, Bal-mung, Bal-mung, Bal-mung …
Jahrelang hatte sie nicht mehr daran gedacht, es war ihr gleich gewesen. Bei einer mächtigen Buche hielt sie an, außer Atem. Hatte man die Waffe nicht damals dem toten Siegfried als Grabbeigabe auf die Brust gelegt? Nein, das wäre ihr aufgefallen. Sie hatte doch selbst noch einmal das Grab öffnen lassen und den verwesenden Schädel geküsst. Kriemhild kämpfte gegen einen Würgereiz, zwang sich, tief zu atmen und konnte ein Erbrechen verhindern.
Nein, dem Leichnam hatte man die Hände gefaltet, ihre Runen-Halskette hatte sie in den Sandsteinsarg gelegt, sonst nichts. Da war nichts anderes im Sarg. Das Schwert, wo um Gottes willen war es?
»Oh mein Gott!«
Sie lehnte die Stirn an die Buche, umschlang den Stamm, betrachtete zwei schwarz-rote Feuerwanzen, die langsam nach oben kletterten.
Was erklang da hinter ihr für ein Geräusch? War es der Bruder? Ein Wildschwein?
Sie hastete weiter, knickte ein, stolperte, wild pochte das Herz. Bal-mung, Bal-mung …
Sie wusste nicht, wie weit sie gelaufen war, als sie, einen Abhang hinunterstolpernd, an eine Lichtung kam. Vor ihr stieg das Gelände steil an, runde, glatt geschliffene Felsbrocken, so weit das Auge in die Höhe reichte. Kleinere Felsen, vom Volumen her wie Weinfässer, aber auch riesige, die fast die Größe von Häusern hatten. Ein gewaltiger Anblick.
Kriemhild trat näher. Sie erinnerte sich daran, von diesem Ort schon einmal gehört zu haben. Ihr Vater Dankrat hatte vor langer Zeit einmal davon gesprochen, vom sagenhaften Felsenmeer im Odenwald.
Von weiter unten drangen jämmerlich klagende Laute an ihr Ohr; eine Schafherde graste dort. Ein Schäfer mit einem schwarzen, zottigen Hund stand auf einen langen Stab gestützt und hielt sich die Hand über die Stirn, um die Augen gegen die tief stehende Sonne abzuschirmen.
»He, guter Mann!«, rief sie ihn an.
Der Schäfer blickte in ihre Richtung und kam langsam in Bewegung. Seine Haltung war unsicher. Der Hund bellte laut und sprang in weiten Sätzen auf Kriemhild zu. Als er sie erreicht hatte, winselte er ängstlich und stand wie erstarrt.
»Was hast du denn, dummes Vieh?!«, rief der Schäfer laut.
Da wurde sich Kriemhild gewahr, dass der Mann sie nicht sehen, das Tier sie aber sehr wohl wittern konnte. Dem Hund war das Ganze plötzlich unheimlich, und jaulend wich er mit eingeklemmtem Schwanz zu seinem Herrn zurück.
Da nahm sie die Tarnkappe ab.
»Herr Gott!«, rief der Schäfer aus. »Ein Geist!« Vor Schreck knickte er in den Beinen ein wie eine Marionette, der plötzlich die Fäden durchgeschnitten werden.
»Nein, bleib!«, bat sie und versuchte, Freundlichkeit in ihre Stimme zu legen. Sie lockte den Hund an und ließ ihn an ihrer Hand schnuppern, bedauerte, dass sie kein Stück Fleisch oder Wurst für ihn hatte. Mit Wehmut erinnerte sie sich an Lothar, ihren struppigen Mischling, der vor Jahren gestorben war.
»Du bist nicht von hier«, sagte der Mann schüchtern und erhob sich mühsam. Kritisch musterte er ihre höfische, aber stark verschmutzte Kleidung.
»Nein«, erwiderte Kriemhild. »Ich bin aus Worms. Ich bin – oder vielmehr war – vom Königshof.«
Verwundert fragte er, was eine so hohe Dame hierhergeführt habe, und sie antwortete wahrheitsgemäß, sie sei mit ihrem Bruder zur Lindenquelle geritten, habe sich verlaufen.
Plötzlich wurde das Gesicht des Mannes hell. »Ich glaube, ich weiß, wer du bist. Du bist die, die ihren Mann verloren hat – die Prinzessin, die Herrin.«
»Herrin, das war ich einmal.« Sie lachte bitter auf. »Jetzt bin ich nur noch eine arme Witwe.«
Der Schäfer nahm ein Stück Brot aus einer Tasche, die er über der Schulter trug, und bot ihr es an. Aus Höflichkeit nahm sie ein Stück, obwohl sie keinen Hunger geschweige denn Appetit verspürte. Wider Erwarten schmeckte das Brot gut, feinsäuerlich mit einer kräftigen Roggennote.
»Wo sind wir hier? Ist das das Felsenmeer?«
Der Mann nickte. Er drehte sich um, um nach den Schafen zu sehen, die inzwischen weit auf der Lichtung verstreut grasten. Ein scharfer Pfiff, der Hund rannte los und trieb die Herde wieder zusammen.
»Wo kommt man hin, wenn man dort hinaufsteigt?«, fragte sie.
»Um Gottes willen!«, stieß der Schäfer hervor und hob warnend die Hand. »Das ist unheimliches Gebiet. Geh dort nicht hin, Herrin.«
»Nicht Herrin«, wiederholte sie, »nur arme Witwe. Weshalb?«
Da erzählte der Mann ihr eine alte Mär.
Einst in grauer Vorzeit, hieß es, lebten hier zwei Riesen. Zuerst waren sie Freunde, doch dann entzweiten sie sich. Jeder wollte Herr über das Land sein.
»Eines steht doch fest: Mir gehört die Lichtung und der Wald«, sagte der eine.
»Nein, ich bin der Herr über diese Gefilde«, sprach der andere. »Verschwinde und such dir woanders eine Heimat.«
»Einst waren wir Freunde«, sagte der Erste, »doch nun bist du herrisch und habgierig geworden.«
»Herrisch? Habgierig? Du hast doch mit dem Streit angefangen!«
»Nicht nur herrisch und habgierig bist du, auch hochmütig. Warte, ich zeige dir, wer hier der Stärkere ist!« Der Riese nahm einen Felsbrocken und drohte ihn zu werfen.
Auch der andere stemmte einen Felsen hoch, noch größer, und dann fing einer an, oder vielleicht warfen sie auch gleichzeitig. Da sie aber harte Köpfe hatten wie aus Eisen, gingen sie nicht zu Boden; sie hoben noch größere Brocken auf und warfen und warfen.
Manche erzählten, nur einer sei gestorben und der andere habe das Weite gesucht wie Kain nach seiner Tat. Wieder andere sagten, alle beide hätten bei dem wilden Streit den Tod gefunden und ruhten unter dem Meer aus Felsen.
»Geh dort nicht hinauf«, wiederholte der Schäfer seine Warnung. »Ich bringe dich zurück zur Quelle, zu deinem Bruder, Herrin.«
»Arme Witwe«, berichtigte sie zum dritten Mal. Sie gab dem Mann die Hand, dankte und ging los. Die Felsen ließen sich ohne große Mühe erklimmen, und Stück für Stück gelangte sie höher. Die Sonne war fort und am Himmel zogen dunkle Wolken auf. Nun war es merklich kühler geworden. Irgendwo hoch oben ließ ein Vogel einen knarzenden Laut hören.
»Hör, der Buchfink«, rief der Schäfer hinter ihr her. »Wenn er so ruft, fängt es bald an zu regnen.«
Zwei Riesen oder mindestens einer unter dieser Felsenlast. Wenn doch nur einer von ihnen wieder auferstehen könnte und mit einem gewaltigen Brocken eine verlassene Witwe unter sich begraben könnte! Immer weiter stieg sie bergauf. Trotz der recht glatten Oberfläche ließ es sich auf den Granitfelsen gut klettern.
Mit einem Mal wurde ihr bewusst, dass sie noch immer die Tarnkappe in der Hand hielt. Sie war ihr hinderlich beim Klettern, denn immer wieder musste sie sich mit den Händen an dem Gestein oder den Wurzeln festhalten. So setzte sie sie wieder auf den Kopf. Es war kein Ende des Anstiegs in Sicht.
Da klatschten die ersten Regentropfen aus finsteren Wolken herab, es wurden mehr, sie spritzten auf die Felsen und prallten ab, und mit einem Mal war überall Wasser. Kriemhild stieß einen ärgerlichen Laut aus. Mochte die Tarnkappe auch unsichtbar machen, vor Regen schützte sie ganz bestimmt nicht.
Hinauf oder hinunter? Besser seitlich in den dichten Wald. Sie orientierte sich nach rechts, die Felsen wurden rutschiger und die Schritte mühsamer. Da sah sie am Waldrand einen umgestürzten Baum. Seine herausgerissenen Wurzeln hatten neben einem großen Felsbrocken eine Art Höhle gebildet, und Kriemhild kroch hinein. Irgendein kleines Tier floh fiepend. Ein Donnergrollen erklang und der Regen wurde heftiger. Gerade zur rechten Zeit, dachte sie und kroch tiefer unter den Felsen. Wind kam auf und trieb ihr dünne, abgestorbene Baumwurzeln mit krümeliger Erde darin ins Gesicht. Sie schreckte zusammen, merkte, wie durchnässt sie schon war. Kalt war es geworden.
Da zuckte ein Blitz, und ein Licht erhellte Kriemhilds Zufluchtsort. Und plötzlich formte sich das Wurzelwerk, wurde Gestalt, wurde Gesicht, ein hageres Gesicht mit grauen Haaren und einem Kinnbart, der in zwei dünnen Spitzen endete, und ein Auge blickte sie an, eines nur, und die dünnen Lippen schienen höhnisch zu grinsen und setzten an zu irgendeinem lästerlichen Spruch, und dann riss sie sich in höchster Angst die Tarnkappe vom Kopf, Teufelszeug, Teufelszeug, und heftige Weinkrämpfe schüttelten ihren Körper.
6. Kapitel Wasser und Wahrheit
Giselher fluchte.
Kurz überlegte er, ob er Kriemhild hinterhereilen sollte, und entschied sich dann dagegen. Wenn sie die Kappe trug und nicht gefunden werden wollte, würde er sie auch nicht finden. Er hätte sie ausdrücklich warnen sollen vor der Macht des verdammten magischen Kleidungsstücks. Nein, er hätte es ihr erst gar nicht geben sollen. Er selbst, Giselher, hatte es in einem tiefen Winkel seines Schranks versteckt und seit Jahren nicht mehr angerührt.
Aufmuntern hatte er die Schwester wollen, vielleicht hätte sie – unsichtbar – durch die Stadt gehen und Leute erschrecken können, wie schon einmal vor Jahren. Er wusste selbst, dass die Kappe ihrem Träger ein prickelndes, beschwingtes Gefühl gab, so wie ein leichter Weinrausch. Und doch – man hatte es an Siegfried gesehen, was das Kleidungsstück anrichten konnte. Erst stellten sich sonderbare Gedanken ein, Verrücktheiten, Albernheiten, und dann wurde ihr Besitzer mehr und mehr wahnsinnig – in dem Maße, wie oft er die Kappe trug. Auch hier war die Wirkung in etwa vergleichbar mit dem Alkohol.
Bloß gut, dass er der Schwester nicht erzählt hatte, wer schuld am Tod ihrer Freundin Gertrud war. Fast wären die Worte seinem Mund entschlüpft. Nein, es war noch zu früh.
Und wenn die Schwester nun strauchelte, einen Abhang hinunterfiel und sich den Hals brach? Einen Augenblick lang dachte er, gut so, dann hat das Elend ein End und sie ist erlöst. Doch der böse Gedanke wurde sogleich weggespült von einem warmen Gefühl der Liebe. Es war immer eine außergewöhnliche Beziehung zwischen den beiden Königsgeschwistern gewesen, vielleicht hatte es damit zu tun, dass sie vom Alter her nahe beieinander waren.
Giselher fühlte sich müde. Er legte sich neben der Quelle auf den Boden und streckte eine Hand ins munter plätschernde Wasser. Da kam eine Erinnerung auf – damals: der unheimliche Bach im Siebengebirge in der Drachenschlucht, als er Alberich verfolgte, den Zwerg. Jener Bach hatte mit ihm gesprochen: »Kehr um, kehr um, sei nicht dumm, nicht dumm«, so hatte er klar das Plätschern der kleinen, flinken Wellen vernommen. Er war nicht umgekehrt und hatte mit Alberich gekämpft – und gewonnen. Und dann hatte er den Schatz entdeckt.
Giselher lauschte.
Giselher, Verräter,
arger Übeltäter!
Giselher, du Mörder,
böser Schwagermörder!
Fort, fort
von diesem Ort!
Worte des Wassers – oder waren es Stimmen in seinem Kopf? Erschrocken zog er die Hand zurück, schüttelte wild die verbleibenden Tropfen ab. Oben auf einer Buche saß eine Elster und ließ ihr Meckern hören, es klang wie ein Spottgesang. Etwas fiel Giselher ins Auge und er dachte an Vogelkot, merkte aber plötzlich, dass der Himmel fast schwarz war und es zu regnen begann. Die beiden Reitpferde schnaubten nervös und kamen näher, um unter der Linde Schutz zu suchen. Schon ein paar Lidschläge später schienen im Himmel alle Dämme gebrochen, und Giselher und die Tiere waren triefnass.
Erneut stieß er einen Fluch aus. Kriemhild würde sich den Tod holen, sofern sie nicht irgendwo eine Zuflucht fand, und er selbst auch.
Drei Stunden später stand er völlig durchgefroren mit den Pferden am Rhein gegenüber seiner Heimatstadt und winkte dem Fährmann. Unterwegs hatte er in Gehöften und Dörfern nach der Schwester gefragt, aber niemand hatte sie zu Gesicht bekommen. Der Fährmann Helge, sonst ein freundlicher Mann, wirkte mürrisch, weil er bei diesem Wetter jemanden übersetzen musste. Er erzählte, dass er heute Morgen einen Fremden zu Gast auf der Fähre hatte.
»Der hat sich ganz schön wichtig gemacht. Angeblich hatte er eine Nachricht von größtem Belang für König Gunther.«