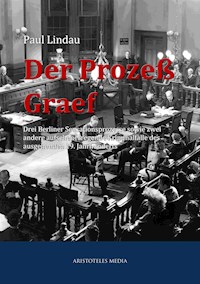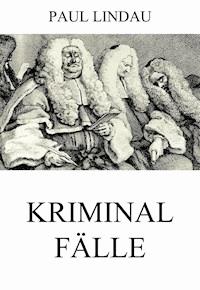
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Paul Lindau war ein deutscher Schriftsteller, Journalist und Theaterleiter. Er war u.a. bekannt für seine Gerichtsreportagen, von denen sich die folgenden in diesem Band wiederfinden: Der Prozeß Graef Das Schulmädchen Marie Schneider Der Mörder des Kaufmanns Max Kreiß Die Ermordung des Advokaten Bernays Der Mörder der Frau Marie Ziethen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kriminalfälle
Paul Lindau
Inhalt:
Paul Lindau – Biografie und Bibliografie
Kriminalfälle
Der Prozeß Graef
Das Schulmädchen Marie Schneider
Der Mörder des Kaufmanns Max Kreiß
Die Ermordung des Advokaten Bernays
Der Mörder der Frau Marie Ziethen
Der Prozeß Graef, Paul Lindau
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849630812
www.jazzybee-verlag.de
Paul Lindau – Biografie und Bibliografie
Deutscher Schriftsteller, Bruder des Diplomaten und Schriftstellers Rudolf Lindau, geb. 3. Juni 1839 in Magdeburg, verstorben am 31. Januar 1919 in Berlin. Besuchte in Magdeburg das Gymnasium zum Kloster Unsrer Lieben Frauen und später die lateinische Schule in Halle, studierte daselbst und in Berlin und beschloss sehr früh, sich der literarischen Laufbahn zuzuwenden. Seine Vorstudien dafür machte er bei einem mehrjährigen Aufenthalt in Paris, von wo er für deutsche Zeitungen korrespondierte. 1863 nach Deutschland zurückgekehrt, übernahm er die Redaktion der »Düsseldorfer Zeitung« und wurde Anfang 1866 Chefredakteur der »Elberfelder Zeitung«, die er bis zum Herbst 1869 leitete. Der heinisierenden Sommerreise »Aus Venetien« (Düsseld. 1864) und einem Skizzenbuch: »Aus Paris. Beiträge zur Charakteristik des gegenwärtigen Frankreich« (Stuttg. 1865), ließ er die »Harmlosen Briefe eines deutschen Kleinstädters« (Leipz. 1870, 2 Bde.; 2. Aufl., Bresl. 1879), »Moderne Märchen für große Kinder« (Leipz. 1870) und die »Literarischen Rücksichtslosigkeiten« (1.–3. Aufl., das. 1871) folgen, Schriften, deren boshafter und unterhaltender Witz der Zeit gefiel. Ernstere wissenschaftliche Tendenzen verfolgte L. in den Schriften »Molière« (Leipz. 1871) und »Alfred de Musset« (Berl. 1877). Nachdem er 1869 in Leipzig »Das Neue Blatt« begründet und bis 1871 redigiert hatte, siedelte er Mitte dieses Jahres dauernd nach Berlin über und rief hier die Wochenschrift »Die Gegenwart« ins Leben, die er bis zum Herbst 1881 geschickt leitete; 1878 begründete er außerdem die bis 1904 von ihm herausgegebene Monatsschrift »Nord und Süd«. Daneben widmete sich L. vorzugsweise dramatischen Arbeiten. 1891 siedelte er nach Strehlen bei Dresden über, 1895 wurde er zum Intendanten des Hoftheaters in Meiningen ernannt, legte dies Amt 1899 nieder und kehrte nach Berlin zurück, wo er erst das Berliner Theater, dann bis 1905 das Deutsche Theater leitete. Mit dem Schauspiel »Marion« hatte er 1868 seine dramatische Laufbahn begonnen; rasch nacheinander folgten das Lustspiel »In diplomatischer Sendung« (1872), die Schauspiele: »Maria und Magdalena« (1872) und »Diana« (1873), das Lustspiel »Ein Erfolg« (1874), das Schauspiel »Tante Therese« (1876), der Schwank »Der Zankapfel« (1875), die Schauspiele: »Johannistrieb« (1878) und »Gräfin Lea« (Berl. 1879), denen sich später noch die Schauspiele: »Verschämte Arbeit« (1881), »Jungbrunnen« (1882), »Mariannens Mutter« (1883), »Frau Susanne« (mit H. Lubliner, 1884) und »Galeotto« (frei nach dem Spanischen des José Echegaray, 1886), »Die beiden Leonoren« (1888), »Der Schatten« (1889), »Die Sonne« (1890), »Der Komödiant« (1892), »Der Andre« (1893), »Ungeratene Kinder« (1894), »Die Venus von Milo« (1895), »Die Erste« (1895), »Der Abend« (1896), »Der Herr im Hause« (1899), »Nacht und Morgen« (1901), »Lucians Satiren« (1901), »... so ich dir« (1903) anschlossen, Werke, die sich zum Teil durch pikanten Dialog und geschickte Technik auszeichnen. Gesammelt erschien ein Teil derselben als »Theater« (Berl. 1873 bis 1888, 5 Bde.). Außerdem schrieb L.: »Kleine Geschichten« (Leipz. 1871, 2 Bde.); »Gesammelte Aufsätze. Beiträge zur Literaturgeschichte der Gegenwart« (Berl. 1875, 2. Aufl. 1880); »Vergnügungsreisen« (Stuttg. 1875); »Dramaturgische Blätter« (das. 1875, 2 Bde.; 2. Aufl. 1877; neue Folge, Bresl. 1878, 2 Bde.); »Die kranke Köchin. Die Liebe im Dativ. Zwei ernsthafte Geschichten« (Stuttg. 1877); »Nüchterne Briefe aus Bayreuth« (Bresl. 1876, 9. Aufl. 1879); »Überflüssige Briefe an eine Freundin«, Feuilletons (das. 1877, 3. Aufl. 1878); »Wie ein Lustspiel entsteht und vergeht« (Berl. 1877); »Aus dem literarischen Frankreich« (Bresl. 1882); »Bayreuther Briefe vom reinen Toren« (das. 1882, 5. Aufl. 1883); »Herr und Frau Bewer«, Novelle (das. 1882, 10. Aufl. 1899); »Toggenburg und andre Geschichten« (das. 1883); die Erzählung »Mayo« (das. 1884); »Aus der Hauptstadt. Briefe an die Kölnische Zeitung« (Leipz. 1884). Eine besondere Liebhaberei und Gewandtheit bekundete L. in der Darstellung merkwürdiger Gerichtsverhandlungen, deren er mehrere veröffentlichte: »Interessante Fälle« (Gräf etc., Bresl. 1887), »Der Mörder der Frau Ziethen. Ziethen oder Wilhelm?« (das. 1892) u.a. Von einem Romanzyklus: »Berlin«, erschienen die Abteilungen: »Der Zug nach dem Westen« (Stuttg. 1886, 10. Aufl. 1903), »Arme Mädchen« (das. 1887, 9. Aufl. 1905) und »Spitzen« (das. 1888, 8. Aufl. 1904); außerdem: »Wunderliche Leute« (Bresl. 1888), »Im Fieber«, Novelle (das. 1890), der Roman: »Hängendes Moos« (das. 1892), »Vater Adrian und andere Geschichten« (Berl. 1893), »Die Gehilfin«, Berliner Roman (Bresl. 1894), »Die Brüder« (Dresd. 1895), »Der König von Sidon«, Erzählung (Bresl. 1898), »Vorspiele auf dem Theater. Dramaturgische Skizzen« (das. 1895); endlich die Reiseschilderungen: »Aus der Neuen Welt« (Berl. 1884) und »Altes und Neues aus der Neuen Welt« (das. 1893, 2 Bde.); »Aus dem Orient« (Bresl. 1890); »Ferien im Morgenlande« (Berl. 1899), »An der Westküste Kleinasiens« (das. 1900) u.a. Auch als Übersetzer und Bearbeiter französischer Theaterstücke war L. tätig. Vgl. »Paul L., eine Charakteristik« (Berl. 1875); Hadlich, Paul L. als dramatischer Dichter (2. Aufl., das. 1876).
Kriminalfälle
Drei Berliner Sensationsprozesse sowie zwei andere aufsehenerregende Kriminalfälle des ausgehenden 19. Jahrhunderts
Der Prozeß Graef
In neun überlangen Sitzungen, vom Montag, 28. September, bis Mittwoch, 7. Oktober 1885, ist vor den Berliner Geschworenen ein Prozeß verhandelt worden, der zu den denkwürdigsten und aufregendsten unserer Tage gerechnet werden darf. Vier Angeklagte haben unter der schweren Beschuldigung entehrender und widerwärtiger Verbrechen – des Meineids, der Anstiftung zum Meineid, der Vornahme unzüchtiger Handlungen und der schweren Kuppelei – auf der Anklagebank gesessen. Als Hauptbeschuldigter ein bisher nicht bloß unbescholtener, sondern sogar in der Achtung und Verehrung seiner Mitbürger hochstehender Mann, der den besten gesellschaftlichen Kreisen angehört, durch Verwandtschaft mit einigen der ersten Familien Berlins eng verknüpft ist und durch die Schöpfungen seiner Kunst Ehren aller Art, den Titel eines Königlichen Professors und die Mitgliedschaft der Akademie erworben und im Kreise seiner Kunstgenossen sowie im großen Publikum Ruhm und Anerkennung gefunden hat. Fünf Anwälte sind den Angeklagten zur Verteidigung ihrer Sache beigetreten. Dem Staatsanwalt, der die Anklage erhoben und durchgefochten, hat sich zur Bewältigung der riesigen Aufgabe ein zweiter Staatsanwalt zur Unterstützung beigesellt. Im Hinblick auf die voraussichtliche Länge und Anstrengung der Verhandlungen sind zu den gewöhnlichen zwölf Geschworenen noch zwei Ersatzgeschworene hinzugelost worden. Ungefähr neunzig Zeugen sind vernommen worden. Sechs Sachverständige, vier Ärzte und zwei Künstler, sind gehört worden. Und dieser gewaltige Apparat hat, wie gesagt, volle anderthalb Wochen lang rastlos gearbeitet, die Beteiligten unausgesetzt in einer Art fiebernder Bewegung und die öffentliche Aufmerksamkeit in sich immer steigender Erregung erhalten – in einer Erregung, die, aus den halbverschlossenen Türen des Schwurgerichtssaales hervorbrechend, zunächst alle Schichten der hauptstädtischen Bevölkerung tief ergriffen und von da, die Bannmeile der Stadt überflutend, die Öffentlichkeit in ganz Deutschland und über die Grenzen unseres Vaterlandes hinaus mit sich gerissen hat.
Die ausführlichen Zeitungsberichte, die den Verhandlungen Schritt auf Schritt gefolgt und in gekürzter Fassung durch den Draht nach allen Windrichtungen hin verbreitet worden sind, wurden wahrhaft verschlungen. Sie haben, soweit das bei derartigen Berichten überhaupt möglich ist und namentlich bei Berichten über Verhandlungen so ganz besonderer Art, den Lauf des Prozesses in allen seinen überraschenden und wundersamen Windungen erkennen lassen.
Es ist nicht der Zweck dieser Zeilen, auf diese dem Namen nach geheimen, in Wahrheit aber in allem Wesentlichen öffentlichen Verhandlungen zurückzukommen. Es soll hier vielmehr der Versuch gemacht werden, die Wirklichkeit, wie sie sich aus den sehr verwickelten und oft verworrenen Verhandlungen für den unbefangenen Beobachter ergeben hat, herauszuschälen, sie wahrheitsgetreu in einer leidenschaftslosen Darstellung zu schildern, den gewaltigen Stoff organisch zu gliedern und die handelnden Personen in ihren eigenen Verhältnissen und in dem Verhältnis, in dem sie zueinander gestanden haben und stehen, möglichst anschaulich hinzustellen.
Bei den durchaus widerspruchsvollen Angaben, die von dieser und jener Seite über die Wahrheit gemacht worden sind, wäre es eine Vermessenheit, behaupten zu wollen, daß der redliche Wunsch, vollkommen vorurteilsfrei das Dargebotene zu prüfen und es dem befundenen Werte nach abzuschätzen, auch schon zur Ermittlung der objektiven Wahrheit führen müsse. Der Verfasser dieser Zeilen kann in vielen Punkten nicht sagen: Das ist nun wirklich so, wie er es schildert. Er kann für seinen Bericht nur das eine in Anspruch nehmen, daß er stets beflissen gewesen ist, aus all den Widersprüchen heraus das als das Tatsächliche zu bezeichnen, was ihm als die subjektive Wahrheit und als das Wahrscheinliche erschienen ist.
I. Der Fall Hammermann
Verurteilung wegen Erpressungsversuchs (November 1883 bis 6. Juni 1884)
Da, wo die letzten Häuser stehen, im hohen Norden der Stadt, hinter dem alten jüdischen Kirchhof, mündet in die Schönhauser Allee die Franseckistraße. Die Straße zeigt neben den bekannten Mietskasernen noch einige Rohbauten und zahlreiche Baustellen. Eines der zuerst fertig gewordenen Häuser dieser Straße trägt die Nummer 3, und da wohnte im Winter des Jahres 1883 die Familie Hammermann.
Der Vater, Wilhelm Hammermann, kommt aus Süddeutschland. Er hat glückliche und, wie er sagt, ehrenreiche Tage gekannt. Er ist Schieferdeckermeister und Spritzenmeister gewesen und hat in dieser städtischen Vertrauensstellung Gelegenheit gehabt, mit hohen Standes- und Magistratspersonen zu verkehren. Welche Umstände ihn veranlaßt haben, sein ehrliches Handwerk aufzugeben und nach einem anderen, ich will nicht sagen unehrlichen, aber doch etwas zweifelhafteren und jedenfalls in der allgemeinen Schätzung weniger angesehenen zu greifen, weiß ich nicht. Kurzum, eines Tages finden wir ihn als Begleiter und Geschäftsgenossen seines Schwagers, der Zauberkünstler ist, auf den Jahrmärkten. Er scheint auch noch mit anderen Schaubuden herumgezogen zu sein. Er macht schlechte Geschäfte, er trennt sich von dem Zauberkünstler und kommt nach Berlin. Seine Frau ist inzwischen gestorben, und um seiner kleinen Tochter Helene eine andere Mutter zu geben, verheiratet er sich zum zweiten Male.
So besteht denn der Haushalt aus drei Mitgliedern: dem Vater, der zweiten Frau und der Tochter. Alle wollen leben. Da erinnert sich Wilhelm Hammermann, daß seine Schwägerin, die Schwester seiner verstorbenen Frau, mit Modellstehen Geld verdient hat; und da er kräftig und gut gebaut ist, meldet er sich bei den Künstlern und findet in der Tat eine anscheinend ziemlich lohnende Beschäftigung. Um sein Einkommen zu vermehren, nimmt er sein Kind, die damals (1881) zwölfjährige Helene, aus der Schule und veranlaßt auch sie, sich bei den Malern als Modell anzumelden. Das magere, unentwickelte, reizlose Kind findet aber geringeren Anklang.
So vergehen zwei Jahre. Helene steht hart an der Schwelle des vollendeten vierzehnten Lebensjahres. Hammermann kennt, wie wir aus einer seiner gelegentlichen Äußerungen wissen, die gesetzliche Bedeutung dieser Altersgrenze des vollendeten vierzehnten Lebensjahres für ein Kind weiblichen Geschlechts sehr wohl, und es ist durchaus nicht unmöglich, daß gerade der unmittelbar bevorstehende Übergang seiner Tochter aus dem vierzehnten in das fünfzehnte Lebensjahr entscheidend gewesen ist für den Entschluß zu jener Tat, die den Ausgangspunkt des Prozesses Graef bildet.
Hammermanns Äußeres widerspricht den ungünstigen Auffassungen, die man sich über seinen Charakter hat bilden müssen, durchaus nicht. Er ist mittelgroß, stämmig und kräftig gebaut, die Stirn ist hoch, die geschwungene Nase fein geschnitten, volles dunkles Haar und der dunkle Vollbart umrahmen das ziemlich bleiche Gesicht, das namentlich durch die tiefliegenden lauernden Augen einen etwas unheimlichen, raubvogelartigen Eindruck macht. Er spricht sehr gewandt, pathetisch, schwülstig, mit lebhaften Gesten, und er schreibt gerade so, wie er spricht: mit volltönenden Phrasen – ein schreckliches Beispiel anmaßlicher Viertelsbildung. Durch Tatsachen ist erwiesen, daß der Mann für jede Unwahrheit dieselben warmen, gefühlvollen, heuchlerischen Ausdrücke findet. Er weint, wenn es ihm darauf ankommt, zu weinen; er veranlaßt die Seinigen zu schriftlichen Lügen unter feierlichsten Formen; kurz, er scheut vor keinem Mittel zurück. Und doch ist auch in diesem Manne ein menschlich liebenswürdiger und freundlicher Zug: das ist die Liebe zu seiner Frau Antonie, zu seiner Tochter Helene, für die er warm empfindet, wenn er sein Kind auch zum Modellstehen zwingt.
Seine Frau ist eine kleine, hagere, kränklich nervöse Person, sehr kurzsichtig, mit scharfer Brille, in gebückter Haltung, mit schlechter Gesichtsfarbe, Ausgang der zwanzig oder Anfang der dreißig Jahre. Sie besitzt eine unsagbare Zungenfertigkeit. Wenn die Schleusen ihrer Beredsamkeit geöffnet werden, so ergießt sich der Wortschwall unaufhaltsam. Diese wenig beneidenswerte Gabe scheint ihr Verderben gewesen zu sein, denn auf sie hat vermutlich Hammermann gebaut, um durch sie seine Zwecke zu erreichen. Er hat angenommen, die Frau werde alles in Grund und Boden schwatzen, was ihr in den Weg trete.
Helene ist jetzt noch, obwohl sie bald das sechzehnte Lebensjahr erreicht, ein wenig entwickeltes Kind; sie ist nicht hübsch und nicht häßlich, sie hat die schlechte Gesichtsfarbe der Kinder aus Kellerwohnungen, sie ist blutleer, ihre fahlen Ohren sind durchsichtig. Das berufsmäßige völlige Entkleiden in den Ateliers, die geschäftliche Enthüllung ihres Körpers vor Künstlern hat auf die moralischen Eigenschaften des Kindes sehr ungünstig eingewirkt; sie besitzt eine Dreistigkeit, die Staunen und Schrecken erregt. Der feierliche Apparat des Gerichtshofes schüchtert sie nicht ein. Es bedarf nicht der Mahnung des Präsidenten, alles frei herauszusagen, sie sagt es unaufgefordert, ohne den geringsten Zwang. Sie sagt die widerwärtigsten Dinge, deren Widerwärtigkeit sie sehr wohl begreift, mit schauderhafter Ruhe. Sie lügt mit einer geradezu unbegreiflichen Frechheit. Ihre Lügen sind wenigstens in einem Falle augenscheinlich erwiesen – wir werden darauf zurückkommen; es handelt sich um die ihr von ihrem Vater diktierten Briefe, deren Urheberschaft sie trotz aller Mahnungen des Vorsitzenden, die Wahrheit zu sagen, für sich allein in Anspruch nimmt. Helene Hammermann ist das echte Erzeugnis häßlicher großstädtischer Frühreife.
Das also ist die Familie, die im Winter 1883 in der Franseckistraße ihr Quartier aufgeschlagen hat.
Im November 1883 meldete sich nun Helene Hammermann bei Professor Hermann Kretzschmer, dem bekannten Maler. Er prüfte Helene auf ihre Brauchbarkeit als Modell und ließ sie dann noch ein zweites Mal kommen. Dieses zweite Mal zeichnete er etwa zwei Stunden nach ihr.
Unmittelbar darauf erhielt der Professor den Besuch der Stiefmutter seines Modells, der beredten Frau Antonie Hammermann, die behauptete, daß Helene in großer Erregung unter heftigem Weinen nach Hause gekommen sei und erzählt habe, sie sei von dem damals 72jährigen Maler in schändlicher Weise behandelt worden: sowohl das erste als auch das zweite Mal habe sich Professor Kretzschmer in einer nicht zu beschreibenden Weise an dem Kinde vergriffen. Der alte Künstler hat uns erzählt, wie ihn diese Beschuldigung überrascht hat. Auf ihn hat das Auftreten der Frau Hammermann den Eindruck gemacht, als ob sie aus der Sache Geld herausschlagen wolle, wenn sie auch einstweilen mit einem solchen Ansinnen noch nicht hervorgetreten sei. Kretzschmer wurde schließlich grob und wies der vorgeblich in der Ehre ihrer Stieftochter beleidigten Frau Hammermann die Tür.
Hammermanns beruhigten sich dabei natürlich nicht, sie suchten einen jener bekannten Wohltäter der leidenden Menschheit auf, einen Volksanwalt, wie man jetzt sagt, einen Winkeladvokaten, wie man früher sagte, und gerieten dabei zufällig an die Adresse des Herrn Krischen, der sich zwar energisch dagegen verwahrt, Volksanwalt zu sein, aber die Geschäfte des Volksanwalts mit allen Schikanen besorgt hat; der Biedermann ist "Kaufmann". Er wohnte nicht weit von Hammermanns, in der Fehrbelliner Straße Nr. 3. Er hat ausgesagt, daß er eine Blattgold- und Schlagmetallhandlung besessen habe. Diese Angabe ist, wie manche andere des Herrn Krischen, nicht ganz unanfechtbar. Das Adreßbuch (1883) verzeichnet allerdings den genannten Herrn Krischen als Kaufmann, seine Ehefrau aber als selbständige Inhaberin des genannten Geschäftes. Wenn man sich die Mühe gäbe nachzuforschen, so würden sich gewiß manche Gläubiger des Herrn Krischen auffinden lassen, die an die Firma der Frau Krischen keinerlei Ansprüche hätten. Aber der unliebsamen Aufgabe, in dem Vorleben dieses Mannes herumzusuchen, sind wir enthoben; wir wissen nur die eine Tatsache, daß er wegen Unterschlagung bereits zu neun Monaten Gefängnis verurteilt worden ist. Das genügt allenfalls. Trotz alledem ist Herr Krischen vielleicht ein ehrenwerter Mann. Wenn aber ein Charakterdarsteller sich die Maske eines ausgesuchten Halsabschneiders machen wollte, so könnte er kein besseres Vorbild wählen als diese merkwürdige Erscheinung. Er trägt das spärliche graue Haar mit einem Querscheitel tief im Nacken in einer künstlichen Anordnung, die es ihm ermöglicht, durch geschicktes Vorkämmen die Höhe des Schädels ungefähr mit Haaren zu bedecken. Der graue Backenbart ist kurz geschoren, die schmalen Lippen sind rasiert, die Augen haben einen unsicheren Ausdruck und werden von den müden Lidern halb bedeckt, die großen Ohrmuscheln sitzen hoch; am merkwürdigsten wirken aber die schrägstehenden sehr schwarzen Brauen, die, hoch über den Augen anfangend, sich zur Nasenwurzel senken und, wenn sie zusammenwüchsen, einen rechten Winkel bilden würden. Er ist mit peinlicher Sauberkeit gekleidet. Er hält in der Hand seinen tadellosen Zylinder und einen großen Stock mit Elfenbeinkrücke. Man kann sich sehr leicht vorstellen, daß es einem ruhigen Menschen, der an nichts Arges denkt, etwas unheimlich zumute werden muß, wenn er diese Gestalt in sein Zimmer hereintreten sieht.
Zu diesem feinen Herrn Krischen in der Fehrbelliner Straße begab sich also der Modellsteher Hammermann, erzählte ihm, was Frau Hammermann dem Professor Kretzschmer erzählt hatte, und Herr Krischen, der eigentlich mit Blattgold handelte, merkte sofort, daß auch aus der Sache vielleicht etwas Goldiges herauszuschlagen war. Er erbot sich also, die Denunziation aufzusetzen. Der feine Herr verlangte dafür von dem weniger feinen Modellsteher drei Mark, erhielt aber bloß zwei Mark und fünfzig Pfennige. Mit diesem Schriftstück, das einen Kostenaufwand von zwei Mark und fünfzig Pfennigen verursacht hatte, hat das bürgerliche Trauerspiel begonnen!
Nach einiger Zeit begab sich nun Herr Krischen zu Kretzschmer, "aus reiner Menschenliebe", wie er uns versichert, bloß um ihn von der Gefahr, die ihm drohte, zu benachrichtigen und um ihm aus Mitgefühl den guten Rat zu geben, sich einen Rechtsbeistand zu nehmen. Geld wurde nicht verlangt, behauptet Herr Krischen, Hammermanns begehrten keinen schnöden Mammon, es war ihnen nur darum zu tun, Professor Kretzschmer moralisch abzustrafen. Kretzschmer gibt nun allerdings über diesen Besuch des "freiwilligen Volksanwalts aus Mitgefühl" eine andere Darstellung. Er sagt, Krischen habe ihm geraten, sich mit den Leuten zu verständigen – sie "abzufinden", wollen wir lieber sagen. Aber auch ihm hat der Künstler die Tür gewiesen. Darauf wurde die Anzeige losgelassen. Frau Hammermann machte indessen noch einmal einen Besuch bei Professor Kretzschmer, und bei diesem erneuten Besuch soll sie ihm vorgeschlagen haben, gegen ein Opfer von tausend Mark die Sache totzumachen. Darauf erstattete der Professor Anzeige an die Staatsanwaltschaft wegen Erpressung.
Es ereignete sich nun etwas Sonderbares. Helene Hammermann, die seit zwei Jahren Modell stand und niemals irgendwie belästigt worden war, kam, wie die Eltern erzählen, wenige Tage, nachdem die Erfolglosigkeit ihres Bemühens bei Professor Kretzschmer feststand, von Professor Graef, dem sie sich ebenfalls als Modell angeboten hatte, mit dem ebenso auffälligen wie traurigen Bericht nach Hause, daß sie auch hier dieselben schmählichen Angriffe zu erleiden gehabt habe wie bei Professor Kretzschmer. Ich sage: auffällig, denn es ist in der Tat verwunderlich, daß das Mädchen zwei Jahre lang keinerlei Klagen über ungebührliche Behandlung von Seiten der Künstler geäußert hat und daß sie nun auf einmal – an der Schwelle des gesetzlich bedeutsamen vierzehnten Lebensjahres – in wenigen Wochen zweimal hintereinander denselben häßlichen Widerwärtigkeiten anheimgefallen sein will. Es ist auffällig, daß diejenigen, denen die Übeltat vorgeworfen wird, nicht etwa junge, leichtsinnige, leidenschaftliche Menschen sind, sondern zwei sehr bekannte Künstler in vorgerückten Lebensjahren, in hoher gesellschaftlicher Stellung. Beide Professoren hatten in der Tat auf ihr öffentliches Ansehen und das ihrer Familie Rücksicht zu nehmen und ein sehr ernsthaftes Interesse daran, jeden Skandal, der sich um ihre Namen erheben würde, zu unterdrücken. Sie besaßen also gerade die Eigenschaften, die bei den Opfern von Erpressern als die wesentlichen zu betrachten sind.
Dieses wunderliche Zusammentreffen fiel selbst Herrn Krischen, der sich doch sonst nicht leicht wundert, auf; und als Hammermann ihn wiederum aufsuchte und wiederum bat, eine Anzeige – nunmehr gegen Professor Graef – aufzusetzen, weigerte sich sogar Herr Krischen und fragte: "Sie machen doch nicht etwa ein Geschäft daraus?" So hat er uns selbst erzählt. Aber der Argwohn, der in ihm aufstieg, war doch nicht stark genug, um ihn seinem Klienten Hammermann gänzlich zu entfremden; vielmehr begab er sich – wiederum aus reiner Menschenliebe und aus uneigennütziger Teilnahme – nun zu Professor Graef und sagte ihm dasselbe, was er früher Kretzschmer gesagt hatte, daß Helene Hammermann ihren entrüsteten Eltern erzählt habe, sie sei am 17. Dezember von Seiten des Professors Graef in abscheulicher Weise angegriffen worden, sie habe sich zur Wehr gesetzt und laut geschrien. Professor Graef war diese Mitteilung keine neue mehr, denn er hatte bereits den Besuch der Frau Hammermann empfangen, die ihm dieselbe Geschichte erzählt hatte. Er hatte darauf ruhig erwidert, daß kein wahres Wort an der Sache sei, daß er Helene allerdings als Modell geprüft, ihr verschiedene Stellungen gegeben, aber durchaus nichts Unerlaubtes mit ihr vorgenommen habe. Sie habe deshalb auch keine Veranlassung gehabt zu schreien, und wenn sie geschrien hätte, so würde man sie im Nebenzimmer jedenfalls gehört haben, in dem seine Tochter zur selben Zeit sich aufhielt und beschäftigt war.
Am Abend desselben Tages notierte Graef in sein Tagebuch, in dem er alle bemerkenswerten Kleinigkeiten verzeichnete, folgendes: "Helene Hammermann hat sich heute einer wahnsinnigen Verdächtigung gegen mich schuldig gemacht, ich muß meinen Rechtsbeistand darüber befragen."
Frau Hammermann hatte zur Beschwichtigung ihrer verletzten Mutterwürde nach der Versicherung des Professors Graef auch von diesem tausend Mark gefordert. Er hatte selbstverständlich sich auf nichts eingelassen, der Frau jedoch endlich, um die unermüdliche und nervös machende Schwätzerin loszuwerden und da er Helene noch nicht bezahlt hatte, zehn Mark – er hatte just kein kleineres Geld bei sich – gegeben. Krischen machte Professor Graef darauf aufmerksam, daß diese großzügige Geste argen Mißdeutungen ausgesetzt und gewissermaßen als ein Zugeständnis zu der von Frau Hammermann behaupteten Tatsache aufgefaßt werden könne. Ob Herr Krischen wirklich geglaubt hat, Professor Graef könne so töricht sein zu meinen, daß er einer Erpresserin, die tausend Mark forderte, mit zehn Mark den Mund stopfen werde? Ob er diesem Künstler, der mit dem Geld überhaupt sehr leichtsinnig umging, der allen möglichen Personen, die sich an ihn gewandt, zwanzig, vierzig, fünfzig Mark und mehr gegeben hat und sich der verausgabten Summen nicht einmal mehr erinnert, nicht zutraut, daß er einer lästigen Person zehn Mark in die Hand drücken könne, um sich erst einmal von ihr zu befreien? Auch Professor Graef schickte also Herrn Krischen unverrichtetersache heim. Krischen forderte auch hier kein Geld, er drohte auch nicht, aber er erzählte, so wie er es bei Professor Kretzschmer getan hatte, ganz nebenbei schaurige Geschichten von all den schrecklichen Unannehmlichkeiten, die bei derartigen Prozessen immer mit unterliefen. Er ließ sogar die unvorsichtige Äußerung fallen: "Wenn Sie auch freigesprochen werden, die Welt glaubt doch, daß an der Geschichte etwas ist."
Durch die von Krischen aufgesetzte Anzeige Hammermanns sowie durch die Gegenanzeige des Professors Kretzschmer war die Sache zur Kenntnis der Gerichte gekommen. Die Untersuchung des Falles führte dazu, daß gegen Frau Hammermann und Krischen von der Staatsanwaltschaft Anklage wegen Erpressungsversuchs erhoben wurde.
In dem jungen, noch nicht dreißigjährigen Rechtsanwalt Bernstein fand Hammermann den gesuchten Rechtsbeistand. Es mochte den noch ganz unbekannten Advokaten reizen, einen Prozeß zu führen, in dem zwei sehr bekannte Namen eine entscheidende Rolle spielten. Im Interesse seines Klienten war es seine Pflicht, was zur Belastung der entscheidenden Zeugen dienen konnte, zusammenzutragen, und Hammermann sorgte dafür, daß in der Tat in bezug auf den Professor Graef eine Angabe gemacht wurde, die, wenn sie sich bewahrheitete, allerdings die Glaubwürdigkeit Helenes erheblich verstärkt und gelinde Zweifel an der Ableugnung ihrer Darstellung durch Professor Graef wachgerufen hätte.
Hammermann war überall herumgelaufen, um auszukundschaften, ob sich über die Sittlichkeit des Professors nichts Nachteiliges feststellen lasse. Da hatte er denn beim Glas Schnaps in der Destillation von einem gewissen Lehmann, der früher ebenfalls Modell gestanden hatte und jetzt Bierkutscher ist, gehört, daß Professor Graef mit der Tochter eines Freundes von Lehmann, dem Töpfergesellen Rother, ein offenkundiges Verhältnis habe. Lehmann hatte das vom alten Rother selbst gehört, und zwar im Atelier des Professors Brunow, in dem Lehmann Modell gestanden hatte, während Rother bei dem genannten Bildhauer zeitweilig als Atelierdiener beschäftigt war. Durch diesen Bierfahrer Lehmann, einen kräftigen Menschen mit hellgelbem Schnurrbart und einem Stiernacken, mit einem nicht eben feinen, aber energischen Gesicht – durch diesen Lehmann wird also die Brücke geschlagen, welche von der Gruppe Hammermann zur Gruppe Rother hinüberführt.
Hammermann verfehlte nicht, die interessante Nachricht seinem Rechtsbeistand zu übermitteln, und dieser legte derselben eine genügende Bedeutung bei, um noch im letzten Augenblick die Vorladung des Kutschers Lehmann und der Tochter des Töpfergesellen Rother, Anna, zu bewerkstelligen. Es war ihm darum zu tun, nachzuweisen, daß dem unbequemen Zeugen Graef eine für dessen Alter überraschende Sinnlichkeit zu eigen sei und daß deshalb der Professor ein Zeuge sei, bei dem man sich der ihm von der Familie Hammermann zur Last gelegten Tat "wohl versehen könne". Die vorgeladene Zeugin Anna Rother wurde am 3. Juni 1884 polizeilich verhört.
Was sich in den drei Tagen vom 3. bis zum 6. Juni, dem Tag des offiziellen Verhandlungsbeginns, zugetragen hat, ist bei den widersprechenden Angaben nicht zu entwirren. Die Anklage behauptet, daß die ältere Schwester der Anna, Bertha Rother, und Professor Graef diese Zeit benutzt hätten, um die geistig etwas schwache und lenkbare Anna zu einem Meineid zu überreden. Professor Graef und Bertha Rother stellen dies natürlich vollkommen in Abrede. Anna selbst, die derartiges einmal zu Protokoll gegeben hat, hat es seitdem beharrlich widerrufen und erklärt, daß sie sich zu dieser Lüge habe hinreißen lassen, aus Wut darüber, in die Angelegenheit hineingezogen worden zu sein, und aus Haß gegen den Professor Graef, der sie aus dem väterlichen Hause getrieben habe. Die Dinge sind so wenig aufgeklärt und die Anhaltspunkte für die Berechtigung einer Anklage wegen Anstiftung zum Meineid so gering, daß schließlich der Staatsanwalt selbst die Freisprechung der Bertha Rother beantragt hat.
Am 6. Juni 1884 war nun also die entscheidende Verhandlung des Falles Hammermann, welche die Grundlage für den späteren Prozeß Graef geschaffen hat und als dessen Prolog zu betrachten ist.
Vor der Ersten Strafkammer des Berliner Landgerichts I wurde unter Vorsitz des Herrn Landgerichtsdirektors Bachmann der Prozeß gegen Frau Hammermann und den Agenten Krischen wegen Erpressungsversuchs verhandelt. Als Zeugen waren verschiedene Maler geladen: Professor Graef, Professor Kretzschmer, Professor Thumann, Konrad Dielitz.
Außerdem natürlich Helene Hammermann. In der Sitzung selbst meldete der Rechtsanwalt der Frau Hammermann, Herr Bernstein, noch zwei Zeugen an: den Bierfahrer Lehmann und die unverehelichte Anna Rother, die darüber aussagen sollten, daß Professor Graef mit der Anna Rother ein intimes Verhältnis habe, sie aushalte und ihr erhebliche Zuwendungen an Geld und Geschenken mache.
Die Beweisaufnahme machte auf den Gerichtshof einen für die Angeklagten durchaus ungünstigen Eindruck. Alle hatten die Empfindung, daß es sich um ein heimtückisch angelegtes Bubenstück handle. Alle Richter, ohne Ausnahme, empfingen von der Helene Hammermann den denkbar schlechtesten Eindruck, sie hielten die Geschichte, die sie vortrug, für eine eingelernte Lüge.
Nun wurde Anna Rother nach ihren Beziehungen zu Professor Graef gefragt, und sie sagte auf ihren Eid aus, daß sie ihm nur Modell gestanden, aber niemals andere Beziehungen zu ihm gehabt habe; und Professor Graef antwortete auf die ihm vorgelegte Frage des Vorsitzenden Bachmann bezüglich des intimen Verhältnisses mit der Anna Rother und der an sie gemachten Geschenke mit der ebenfalls auf seinen Zeugeneid genommenen Verneinung. Landgerichtsdirektor Bachmann machte den Professor ausdrücklich darauf aufmerksam, daß er die Aussage verweigern könne, da er verheiratet sei, daß die Bejahung der vorgelegten Frage aber für ihn die strafrechtliche Konsequenz einer Verfolgung wegen Ehebruchs haben könnte. Professor Graef machte von diesem Recht der Aussageverweigerung aber keinen Gebrauch.
Soweit waren die Verhandlungen gediehen, als der Verteidiger der Frau Hammermann, Herr Bernstein, bemerkte, daß die Ladung der Anna Rother auf einem Irrtum beruhe. Nicht Anna, sondern die ältere Schwester Bertha sei gemeint gewesen! Damit sind wir bei einem entscheidenden Punkt angelangt. Denn als nun Professor Graef erneut vorgerufen und gefragt wurde, ob ein "derartiges" Verhältnis, wie es nach der Behauptung der Verteidigung zwischen ihm und Anna Rother bestanden haben solle, ein Verhältnis intimster Art, zwischen ihm und Bertha Rother bestehe beziehungsweise bestanden habe, antwortete Professor Graef, nach neuerlichem Hinweis auf sein Recht zur Zeugnisverweigerung, wiederum mit einem entschiedenen Nein. Der Zeit vorausgreifend, bemerken wir schon an dieser Stelle, daß diese Aussage die Grundlage für die spätere Anklage gegen den Professor, einen Meineid begangen zu haben, darstellt.
In der Sitzung der Ersten Strafkammer am 6. Juni 1884 wurden nun aber zunächst die beiden Angeklagten, Frau Hammermann und Herr Krischen, wegen Erpressungsversuchs verurteilt, da die Beweisaufnahme den Gerichtshof von der Schuld der beiden überzeugt hatte. Entgegen der ungewöhnlich hohen Strafe von fünf Jahren Freiheitsentzug, die der Staatsanwalt beantragt hatte, erhielt Frau Hammermann jedoch nur eine Strafe von zwei Jahren und Herr Krischen eine Verurteilung zu achtzehn Monaten Gefängnis.
Die Maler, die Zeugen jener Verhandlung gewesen, waren über die eidliche Ableugnung des Verhältnisses zwischen Professor Graef und Bertha Rother aufs höchste überrascht. In Künstlerkreisen wurde nämlich ziemlich allgemein angenommen, daß zwischen Graef und Bertha, die er seit einigen Jahren als Modell benutzt und für die er, wie man wußte und wie er auch in der Verhandlung angegeben, Geldopfer von ungewöhnlichem Betrage gebracht hatte, allerdings ein Verhältnis ungewöhnlicher Vertraulichkeit und Zärtlichkeit bestände. Das erzählten die Künstler, und die Modelle erzählten es. Und dies als notorisch angesehene Verhältnis wurde, wie das ganz natürlich ist, eben als eines der allerintimsten Art, mit einem Wort als ein geschlechtliches, angesehen. Da aber Professor Graef in Ehren ergraut war und sich in seinem langen Leben niemals die geringste Handlung, die seine Ehrenhaftigkeit auch nur im entferntesten hätte in Frage stellen können, hatte zuschulden kommen lassen, da dieser liebenswürdige und verehrte Mann die diesbezügliche Frage in der feierlichsten Weise verneint hatte, so sagten sich die Künstler, daß sie sich also in ihren früheren Auffassungen getäuscht haben müßten und auch in diesem Falle wieder einmal der Schein getrogen habe. An einen Meineid wollte natürlich kein Mensch denken.
Damit hat das Vorspiel zum Prozeß Graef sein Ende erreicht. Wir treten nun in eine Phase, in der Professor Graef und Bertha Rother die Hauptrollen haben, die restliche Familie Rother einen wichtigen Platz einnimmt, die Familie Hammermann im Hintergrund agiert und Professor Kretzschmer ausscheidet.
II. Hammermanns Bemühungen zur Befreiung seiner Frau
(Juni bis November 1884)
Krischen und Frau Hammermann saßen nun hinter Schloß und Riegel. Das Urteil wirkte auf Hammermann erschütternd, und es zeigte sich nun jener menschlich freundliche Zug in dem sonst antipathischen Charakter dieses Mannes: das leidenschaftliche Verlangen, seiner Frau zu helfen, die, durch ihn angestachelt, die verhängnisvollen, zu ihrer Freiheitsberaubung führenden Schritte getan hatte. Er will seine Frau befreien, das ist das Ziel, das er von nun an nicht aus den Augen läßt, und jedes Mittel, das sich ihm dazu darbietet, ist ihm recht, keines verwerflich genug. Er versucht es durch Bitten und Drohen, durch Wahrheit, durch Lug und Trug.
Die Sache läßt ihm keine Ruhe. Inmitten der Nacht weckt er Helene aus dem Schlafe und diktiert ihr in seinem schwülstigen, bilderreichen Stil eine Erklärung, in der sie behauptet, daß alles, was sie über die Auftritte in den Ateliers der Künstler gesagt habe", von ihr erlogen sei. Sie habe diese schändlichen Lügen ausgeheckt, um von ihrem Vater nicht mehr zum Modellstehen gezwungen zu werden. Sie werde von ihren Freundinnen verhöhnt, daß sie dies Geschäft betreibe. Sie habe gehofft, daß ihre Eltern, wenn sie ihnen erzählte, welchen Gefahren sie von Seiten der Künstler beim Modellstehen ausgesetzt sei, sich bewogen finden würden, ihr die Erlaubnis zu erteilen, ein anderes Handwerk, die Schneiderei, zu erlernen. Durch diese reumütige Erklärung hoffe sie, die hochverehrten Herren Professoren milder zu stimmen, hoffe sie, ihrer armen Mutter, die unschuldig in der Gefangenschaft schmachte, nützlich zu sein. – Man denke sich diese nächtliche Szene in der kleinen Stube der Franseckistraße. Der Vater, der seinem halbverschlafenen Kinde bei der Petroleumlampe mitten in der Nacht einen bombastischen Brief in die Feder diktiert, um seiner Frau, die seinethalben aus der Familie herausgerissen ist, zu Hilfe zu kommen. Man vergegenwärtige sich, welche Empfindungen dabei mitspielen, und man wird zugeben, daß der kühnste dichterische Naturalismus an diese Wahrheit nicht heranreicht.
Die Erklärung Helenes übersandte Hammermann in zwei gleichlautenden Exemplaren an die beiden Professoren. Er schickte seine Tochter auch zum Rechtsanwalt Bernstein und ließ sie die schriftlich abgegebene Erklärung, daß sie ihre Eltern belogen habe, wiederholen. Sie fragte gleichzeitig, ob dieses Geständnis zur Entlassung ihrer Mutter aus der Strafhaft führen werde.
Anfang Juli 1884 erkrankte eines der jüngeren, bisher nicht erwähnten Kinder der Frau Hammermann schwer, und sie wurde daher zeitweilig aus dem Gefängnis beurlaubt. In dieser Zeit verdoppelt sich der ungestüme Befreiungseifer Hammermanns. Er macht unzählige Versuche, um ein Wiederaufnahmeverfahren zu erlangen, später, um die Unterstützung der Meistbeteiligten zu einem Gnadengesuch durchzusetzen. Er verhandelt mit dem Vertreter des Rechtsanwalts Dr. Sello, weint ihm bittere Tränen über seine ungeratene Tochter vor, die ihn hinters Licht geführt und die ganze Geschichte erlogen habe, um nicht mehr Modell stehen zu brauchen. Er diktiert seiner fünfzehnjährigen Nichte Franziska Lehmann eine "eidesstattliche Erklärung" des Inhalts, daß Helene ihr oft ihr Leid darüber geklagt habe, als Modell arbeiten zu müssen, und sie die Geschichten mit Kretzschmer und Graef erfunden habe. Hammermann schrieb sodann fast gleichlautende Briefe an die beiden "lieben, guten Herren, die hochverehrten, hochgestellten, hoffähigen Herren Professoren", in denen er den Jammer der Familie Hammermann schildert, wenn die Mutter den Kindern wiederum entzogen werden sollte, und bittet in jener überpoetischen Schwülstigkeit, die alle seine schriftlichen Aufzeichnungen auszeichnen, ein Gnadengesuch an "unseren allverehrten lieben greisen Kaiser" zu unterstützen. Frau Hammermann schreibt ihrerseits an Professor Graef einen Brief, in dem sie die furchtbaren Leiden des Kerkers in glühenden Farben schildert, und benutzt die Gelegenheit, ihn um Geld zu bitten, damit sie nach Amerika auswandern könnten.
Professor Graef, dessen Gutmütigkeit auch von seinen unerbittlichsten Feinden nicht in Abrede gestellt werden wird, entgegnete darauf, daß er das Unglück der Familie nicht wolle und nicht abgeneigt sei, ein Gnadengesuch zu unterstützen. Zur Zahlung von Geldmitteln für eine Auswanderung zeigte er sich jedoch nicht bereit, auch nicht, als Frau Hammermann ihn aufsuchte und um eine Summe von tausend Mark bat, die sie ihm gewiß auf Heller und Pfennig zurückerstatten wollte. Ebenso verhielt sich Professor Thumann, bei dem Helene öfters Modell gestanden hatte und den Frau Hammermann um das Reisegeld nach Amerika anging. Obgleich die Familie Hammermann die beiden Professoren in einer Komödie der Täuschungen gegeneinander auszuspielen versuchte, hatten diese Bemühungen keinen Erfolg, und da die Geschichte sich zu lange hinzog und der Zeitpunkt der Wiedereinsperrung der Frau Hammermann immer mehr herannahte, ließ Herr Hammermann nun zur Abwechslung wieder einmal andere Töne erklingen: er drohte. Er schrieb einen gar nicht mißverständlichen Brief an Professor Graef, der mit den Worten schloß: "Sie wollen mein Unglück nicht, ich will das Ihrige auch nicht." Gleichzeitig suchte er Graef durch flehentliche Bitten Helenes zu erschüttern. Er diktierte ihr einen Brief in dem bekannten Stil, in dem die Vierzehnjährige schreibt: "Wer trocknet die heißen Tränen, wer heilt den großen Seelenschmerz meiner lieben, lieben Eltern? Bald hätte ich meinen herrlichen Glauben an den lieben, lieben Gott verloren. Wenn Sie diesen Brief verbrennen, verbrennen Sie meine Tränen mit!" So schreibt Helene und versichert vor Gericht, daß sie den Brief aus eigenem Antrieb, ohne fremde Hilfe geschrieben habe! Herr Hammermann, der auch Professor Kretzschmer um ein Darlehen von einigen hundert Mark bittet und den rief mit den Worten schließt: "Bitte, bitte, lassen Sie uns nicht den Wermutsbecher bis zur Neige leeren, sondern füllen Sie uns einen kühlen Pokal mit erfrischenden Lebensgeistern" (und der Satz gefällt ihm so wohl, daß er ihn gleich noch einmal in dem Bittbrief an Professor Graef verwendet) – dieser ehrenwerte Herr Hammermann versichert ebenfalls auf seinen Eid, daß er Helene bei der Abfassung jenes Briefes nicht geholfen habe.
Auch die Drohungen verfangen nicht, und nun fällt Hammermann, nachdem seine Frau wiederum eingezogen ist, aufs neue in den flehentlichen Ton zurück, greift dann wieder zur Unverschämtheit, bis endlich Professor Graef endgültig die Geduld verliert und die Verhandlungen mit Hammermann, der ihn mit Besuchen bestürmt und mit Briefen überschüttet, abbricht, das heißt seine Briefe nicht mehr annimmt und ihn nicht mehr empfängt.
Diese Aktionen Hammermanns, in denen er alles zur Befreiung seiner Frau unternimmt, in der Hoffnung, die Professoren würden ihn auf die eine oder andere Weise bei seinen Bemühungen unterstützen, umfassen etwa die Zeit vom 6. Juni bis zum Oktober oder November 1884.
Nun tritt die entscheidende Wendung ein. Hammermann hofft jetzt die Befreiung seiner Frau dadurch zu erreichen, daß er Graef zugrunde richtet, und auch an dieses Vernichtungswerk geht er mit all der ihm eigenen Unermüdlichkeit heran.
Was Professor Graef in den Künstlerkreisen nachgesagt wurde: er habe ein unerlaubtes Verhältnis mit Bertha Rother, er unterhalte sie und gebe sehr bedeutende Summen für sie und ihre Familie aus – das konnte Hammermann ebensowenig verborgen bleiben wie jedem anderen, der sich für die Sache interessierte. Für einen Mann wie beispielsweise Professor Thumann genügte die Tatsache des von Graef geleisteten Eides, um fürder an das Gerede nicht mehr zu glauben. Für Leute vom Schlage Hammermanns aber war es naheliegender, anzunehmen, daß das allgemeine Gerede doch berechtigt sei und daß also Professor Graef einen Meineid geleistet hätte. Hatte er aber einen Meineid geleistet, so konnten die Richter zu der Überzeugung gelangen, daß sie seine Frau zu Unrecht verurteilt hätten, und der Nachweis dieses Meineides sollte also der Schlüssel sein, mit dem er hoffte, die Tür ihres Gefängnisses zu öffnen.
Die Tatsache, daß Professor Graef viel im Hause der Rothers verkehrte, daß er für die Familie erhebliche Geldopfer brachte, daß er der Mutter Berthas ein kostspieliges Geschäft eingerichtet hatte, daß Bertha verhältnismäßig gut wohnte und Toiletten machte, die von ihrem Erwerb als Modell sicherlich nicht zu bestreiten waren, daß sie sich verschiedentlich von Berlin entfernt und Professor Graef in anderen Städten aufgesucht hatte, daß sie auf seine Veranlassung dramatischen Unterricht empfing – alles das vermochte er sich nur dahingehend zu erklären, daß Bertha Graefs Geliebte sein müsse; und das hatten ja auch viele andere geglaubt.
Von Graef abgewiesen, machte er sich nun an die Familie Rother heran, nicht direkt, denn er durfte voraussetzen, daß man ihm dort unfreundlich begegnen würde. Aber mit der Familie Rother verkehrten allerhand Leute, unter denen er hoffte, den einen oder anderen zu finden, der ihm bei seinem Vorhaben zur Seite stehen würde. Wir müssen also, um den weiteren Gang der Ereignisse zu verstehen, diese Familie Rother etwas näher kennenlernen.
III. Familie Rother und Zugehörige
Die Schilderung der Familie Rother wäre die eines Zola würdige Aufgabe.
Vor zweiundzwanzig Jahren soll Auguste Jahnke ein zartes und sehr hübsches Mädchen gewesen sein; und dem von den Stürmen des Lebens verwitterten Gesicht sieht man auch heute noch die Spuren der vergangenen Schönheit an. Die zarte Figur ist allerdings durch die Jahre in grausamer Weise mißhandelt worden: der Rücken ist gekrümmt, die eine Seite der Schulter hat sich vorgeschoben. Jetzt sieht Auguste widerwärtig aus und unheimlich, aber, wie gesagt, vor zweiundzwanzig Jahren soll es anders gewesen sein, und ihre jugendlichen Reize sind zu damaliger Zeit nicht unbemerkt geblieben.
Am 10. Januar 1864 ist sie Mutter einer unehelichen Tochter geworden, die den Namen Bertha führt und die weibliche Hauptperson unseres Prozesses geworden ist. Bald darauf hat sich Auguste Jahnke mit dem Töpfergesellen Rother vermählt, der das uneheliche Kind legitimiert hat. In der Ehe mit Rother wurden dann noch zwei Mädchen geboren, Anna Rother, geboren 1867, die wir aus dem Prozeß Hammermann schon kennen, und Elisabeth Rother, genannt Lieschen, geboren 1871.
Das Familienhaupt, der Töpfergeselle Rother, ein Mann mit schlecht gepflegtem, üppigem schwarzem Haar und Bart, eingequetschter Nase, gelblicher Gesichtsfarbe und im Auge jenen Ausdruck von Müdigkeit und Wohlwollen, wie man ihn so oft bei gewohnheitsmäßigen Trinkern sieht, hat seine Stellung nicht gerade mit besonderer Würdigkeit bekleidet. Er arbeitete wenig oder gar nichts, trieb sich in Destillationen und Kellerschenken herum und war meist betrunken.
Für die Wirtschaft ließ er seine Frau sorgen. Seine Kinder ließ er aufwachsen, wie sie eben wachsen wollten.
Die Mutter verschaffte sich zunächst durch den in Berlin so gewöhnlichen Nebenerwerb des Zimmervermietens die notwendigsten Mittel zu ihrem Unterhalt. Auf besondere moralische Qualifikation ihrer Mieterinnen wurde nicht weiter gesehen, sie gab jungen Mädchen, um deren Verhältnisse sie sich nicht zu kümmern brauchte, und anderen, schlimmeren, polizeilich gebuchten und numerierten Personen Kost und Unterhalt. Ihre Wohnungen hatten gewöhnlich drei bis vier Zimmer außer der Küche. Daß die Hauswirte besondere Anstrengungen gemacht hätten, sich diese Mieterin zu erhalten, ist nicht wahrscheinlich, denn die polizeilichen Ermittlungen haben ergeben, daß Auguste Rother in den letzten sieben Jahren nicht weniger denn acht verschiedene Wohnungen innegehabt hat. Sie hat die Peripherie der ganzen Hauptstadt, vornehmlich aber die Gegend vor dem Halleschen Tore, unsicher gemacht. 1877 wohnte sie in der Johanniterstraße, von da zog sie nach der Nostiz-, dann nach der Acker-, der Linden-, der Mariendorfer Straße, dann nach dem Platz am Neuen Tor, nach der Schleiermacher-, der Mittenwalder und endlich nach der Fürbringerstraße, wo sie im Jahre 1885 verhaftet worden ist.
Die Fürsorge für das Wohl ihrer Mieterinnen scheint recht nachteilig auf die Erziehung ihrer Kinder eingewirkt zu haben. Die älteste, Bertha Rother, hat im ganzen sechs Wochen die Schule besucht. Annas Schulbildung ist nicht anders gewesen, sie schreibt vollkommen unorthographisch und mit lächerlichen Buchstaben, sie liest schlecht, die Geheimnisse des Einmaleins sind ihr nicht erschlossen; auf Veranlassung Dritter ist sie einmal in das Johannisstift gebracht worden, von dort jedoch nach drei Tagen entlaufen. Von Lieschens Bildungsgang wissen wir zwar nicht viel, aber wir haben Grund zu der Vermutung, daß es auch um sie nicht besser beschaffen sei.
Wenn Frau Rother nun für die geistige Bildung ihrer Töchter recht wenig getan, so hat sie sich doch eifrig bemüht, deren körperliche Vorzüge zu gewinnbringenden zu machen und ihr spärliches Einkommen durch das ihrer Töchter zu vermehren. Die kleinen Mädchen wurden also zu den Künstlern geschickt, um für Aktbilder Modell zu stehen, Bertha im Alter von sechs Jahren, Anna wohl nicht viel später. Anna verließ bereits im Alter von dreizehn Jahren das elterliche Haus und nährte sich seitdem vom Modellstehen, und mag nebenbei auch wohl andere Einkommen gehabt haben. Im Jahre 1880 war sie die "Braut" und Geliebte eines Lackierers Labisch, der sie für eine Siebzehnjährige hielt. Im selben Jahr wurde sie von der Polizei in schlechtester Gesellschaft allabendlich zu vorgerückten Stunden auf den Straßen in der Nähe der Kasernen bemerkt. Sie war damals, wie wir wiederholen, ein Mädchen von dreizehn Jahren. Die Ihrigen besuchte sie nur, um von ihnen Geld zu holen, wenn es ihr schlecht ging. Mutter Rother scheint sich über das Alleinleben ihres Kindes keine besonderen Sorgen gemacht zu haben.
Bertha, die ältere, blieb länger im Hause. Dieses hübsche, mit einem ungewöhnlich schönen Körper begabte Mädchen führte ein recht tolles Leben, was jedoch ihrer Mutter auch keinerlei Veranlassung zur Beunruhigung bot. Sie wurde zunächst 1878, also mit vierzehn Jahren, in der Friedrichstraße nach 12 Uhr nachts von der Polizei aufgegriffen und erklärte bei ihrer ersten Vernehmung, daß ihr in ihrem dreizehnten Jahr Gewalt angetan worden sei. Einige Zeit später wurde festgestellt, daß Bertha sich mit polizeilich überwachten Mädchen nächtlich Unter den Linden und in der Friedrichstraße umhertreibe, daß sie aus öffentlichen Lokalen wegen auffälligen Benehmens gewiesen sei usw. Im Juni 1880 wurde die indessen Sechzehnjährige in Begleitung der sittenpolizeilich gemeldeten Amanda Reuter aufgegriffen, und die gefürchtete amtliche Überwachung wurde nun über sie verhängt. Sie wurde dadurch also amtlich zu einer Zugehörigen des gewerbsmäßigen Lasters gestempelt. Auf wiederholte Anträge ihrer Eltern wurde dieser Überwachungszustand nach drei Monaten wieder aufgehoben; es muß jedoch erwähnt werden, daß es genügend Anhaltspunkte gab, um sie auch später wieder mit der Polizei in Berührung zu bringen.
Alle diese fatalen Tatsachen haben Frau Rother seelisch wenig angegriffen. Bertha hat bis Ende 1883, abgesehen von kürzeren Abwesenheiten, dauernd bei ihrer Mutter gelebt, und diese hat gewiß nichts auf ihre Bertha kommen lassen, hat sie doch in der Tat den ganzen Hausstand ernährt. Sie ist die Schraube gewesen, die die brave Mutter angesetzt hat, um aus Professor Graef die bedeutenden Summen, die der Haushalt mit der verschwenderischen Bertha und der schlecht wirtschaftenden Frau Rother verschlang, herauszudrücken.
Lieschen, die jüngste Tochter, war noch ein Kind, ziemlich groß, hager, unentwickelt, mit großen ausdrucksvollen blauen Augen, kränklich. Bei einem Kind der Mutter Rother muß die gewöhnlich selbstverständliche Tatsache, daß sich das Kind bis zu seinem vierzehnten Lebensjahr seine anatomische Reinheit bewahrt hat, doch besonders verzeichnet werden. Trotz der unliebsamen Erfahrungen, die Frau Rother mit ihren beiden ältesten Kindern gemacht hatte, war sie doch eifrig beflissen, auch Lieschen genau auf dieselben Wege zu drängen; auch sie mußte sich als Modell anbieten, und es wurden Briefe aufgesetzt, bestimmt für bekannte Persönlichkeiten, von denen Frau Rother glaubte, daß sie für mädchenhafte Frühreize einen empfänglichen Sinn besäßen. Lieschen sollte diese Briefe abschreiben und hat das vielleicht auch in dem einen oder anderen Fall getan und die Herren in verlockender, viel andeutender Weise um Unterstützung gebeten.
So die Mutter und die Kinder.
Der gesetzliche Vater und Töpfergeselle trank inzwischen unbekümmert seine Schnäpse weiter, und da er nichts weiter tat, Frau Rother aber trotz ihrer vorgerückten Lebensjahre in ihrem mageren Körper noch ein fühlendes Herz trug, warf sie ihn eines Tages zur Türe hinaus. Das war Ende des Jahres 1880.
Zu jener Zeit war in dem Rotherschen Haus nämlich eine neue Erscheinung aufgetaucht: Herr Ihlow. Mit dem Zimmervermieten allein, mit dem Modellstehen der Töchter und deren sonstigen Nebenverdiensten war Frau Rother noch immer nicht auf einen grünen Zweig gekommen. Sie hatte also ein Geschäft eröffnet, und der großmütige Beschützer des Hauses, Professor Graef, der seinem Modell zuliebe alles tat, war auch hier der hilfsbereite Wohltäter gewesen. Er hatte Frau Rother die Mittel zur Eröffnung eines Handels zur Verfügung gestellt, in der törichten Hoffnung, daß sie nun selbst Geld verdienen und somit weniger Ansprüche an seinen Geldbeutel stellen werde. Frau Rother versuchte es zunächst mit einem Handel mit Federvieh, danach eröffnete sie eine Butter-, Milch- und Käsehandlung – beide Geschäfte gingen zugrunde. Danach wurde sie Inhaberin eines Fuhrgeschäftes, das zwar bedeutendere Kapitalien erforderte, das aber auch, wenn es gut ging, einen bedeutenderen Gewinn abwerfen konnte; und wiederum brachte Professor Graef dafür erhebliche Opfer. Frau Rother schaffte, wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, zwei Droschken erster Klasse, einen Möbelwagen und acht Pferde an. Der Leiter dieses Geschäfts war eben jener Herr Ihlow, ein strammer junger Mensch, damals sechsundzwanzig Jahre alt, der soeben mit guten Militärpapieren aus der Armee entlassen war und nun bei Frau Rother eine lohnende Beschäftigung fand. Ihlow ist vom Äußeren gar nicht übel. Er ist gut gebaut, volles blondes Haar und ein leichter blonder Bart umrahmen das runde, frische Gesicht; seiner straffen Haltung und dem Ton, in dem er seine Antworten gibt, merkt man sofort den gewesenen Soldaten an. Er ist dem Alkohol zwar auch nicht gänzlich abgetan, aber ein gewohnheitsmäßiger Säufer wie Rother ist er nicht. Ihlow schlief zunächst im Keller. Frau Rother betrachtete aber den jugendlichen Mann mit Wohlgefallen, sein Anblick erweckte schöne Erinnerungen an ihre Jugend, und die beiden fanden sich. Daß Frau Rother dreizehn Jahre älter war, machte auf Ihlow geringen Eindruck: sie war ja die Inhaberin des Fuhrgeschäftes. Sobald das Liebesverhältnis zwischen den beiden perfekt geworden war, wurde die Überflüssigkeit des Töpfergesellen Rother immer deutlicher erkannt, und diese Erkenntnis führte dazu, daß Rother aus dem Hause flog.
Aber auch für ihn, den so schnöde behandelten Ehemann, fand sich noch ein liebendes Herz: die alte gutmütige Plätterin Beeskow, eine Frau von wahrhaft entsetzlichem Äußeren, einäugig, mit einem eingesetzten Glasauge, dessen leblose Starrheit dem alten, faltigen Gesicht einen wahrhaft entsetzenerregenden Ausdruck gibt, nahm den herausgeworfenen Töpfergesellen freundlich auf, und auch zwischen diesen beiden wurde ein zarter Bund gestiftet.
So gewährt das Rothersche Haus zu Anfang der achtziger Jahre folgendes anmutige Bild. Der Vater, ein Säufer, ist an die Luft gesetzt und lebt mit einer gutmütigen alten Frau von erschreckendem Aussehen. Die Mutter lebt mit einem dreizehn Jahre jüngeren Manne in ehebrecherischem Verhältnis, das nicht einmal vor ihren Kindern verborgen wird. Die zweite Tochter Anna ist entlaufen und verdient ihr Geld als Modell und Gott weiß was. Die älteste Tochter führt das lustige Leben von Damen, die der Sittenpolizei eben entronnen sind und immer in Gefahr schweben, aufs neue mit der gefürchteten Behörde in unliebsame Berührung zu kommen. Sie steht Modell und treibt sich in den Lokalen herum, die vorzugsweise von ihresgleichen besucht werden. Die Jüngste, damals noch ein Kind, wird allmählich in derselben Schule zum Laster herangezogen.
Das Bild ist indes noch nicht vollständig. Um es in seiner ganzen Anschaulichkeit vor sich zu sehen, muß man auch die Staffage, die Mieterinnen, noch etwas näher kennenlernen.
Es sind fast ohne Ausnahme junge und zum Teil sehr hübsche Mädchen. Um ganz von unten zu beginnen, nennen wir zunächst Amanda Reuter, auf die die Bezeichnung hübsch allerdings nicht zutrifft. Sie ist ein großes, plumpes Frauenzimmer mit groben, törichten Zügen, mit dicker Nase, geschminkten Brauen und Wimpern, stark gepudert, im auffälligsten Anzuge, mit dem bekannten, sich wiegenden, schwankenden Gange, den jedermann, der zwischen 12 und 2 Uhr nachts einmal durch die Friedrichstraße gegangen ist, als ein besonderes Merkmal dieser Gattung von Damen kennt. Amanda Reuter ist als polizeilich überwachte Person ein wöchentlich regelmäßiger Gast des Molkenmarktes. Mit ihr ist Bertha Rother aufgegriffen worden.
Ungleich höher stehen die anderen Mieterinnen, die nach und nach bei Frau Rother gewohnt haben: Schneiderinnen, Putzmacherinnen, Konfektionösen und dergleichen, die von den Behörden ungeschoren gelassen sind, die vielleicht diesen oder jenen, vielleicht auch diesen und jenen Freund haben, aber doch zu öffentlichem Ärgernis keine Veranlassung bieten. Sie sind samt und sonders mit großer Sauberkeit gekleidet, oft sogar mit einer gewissen Eleganz. Die Anhänglichkeit, die alle diese jungen Mädchen an das Rothersche Haus haben, hat etwas Rührendes; alle treten vor Gericht mit dem unverkennbaren Willen, die Wahrheit zu sagen, aber auch alle mit dem ebenso unverkennbaren Bestreben, die Wahrheit in die schonendste Form zu kleiden. Alle Mädchen rühmen die unglaubliche Gutmütigkeit der alten Frau Rother und zeigen eine freundschaftliche Ergebenheit für Bertha.
Von anderer Art als diese Hausbewohner sind die beiden, mit denen wir uns nun zu beschäftigen haben und die im Gegensatz zu der Gesinnung, welche all diese Mädchen für die Familie Rother an den Tag legten, dem Hause feindselig und gehässig gegenüberstehen.