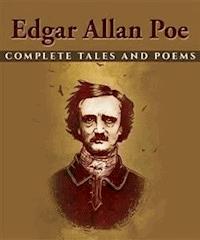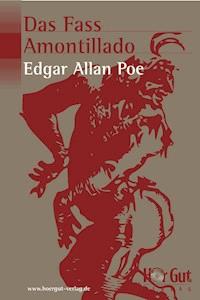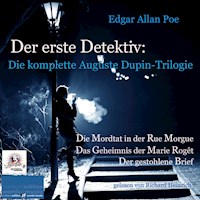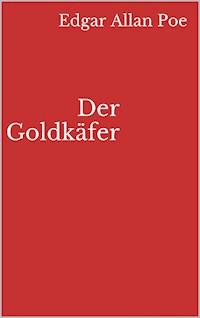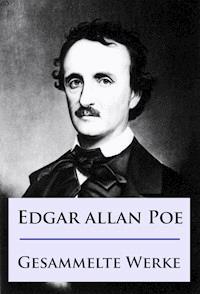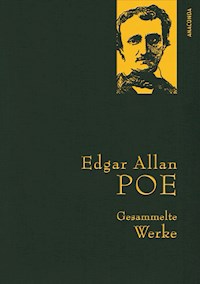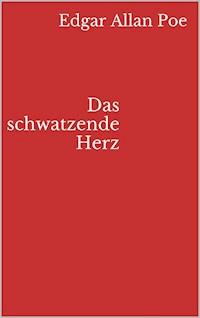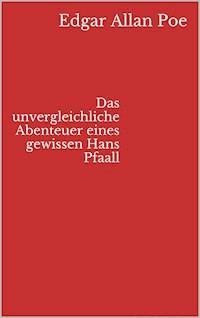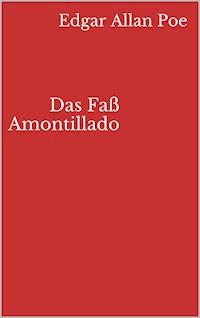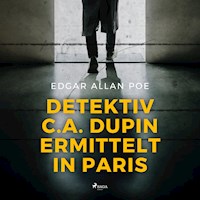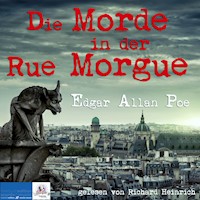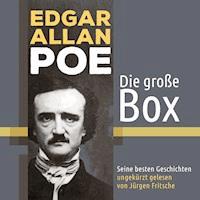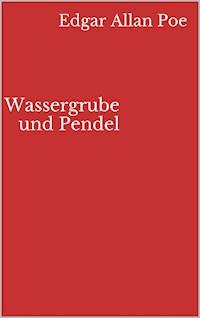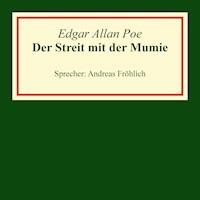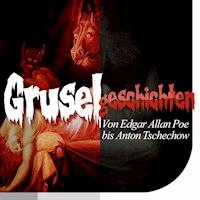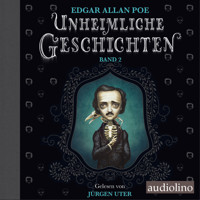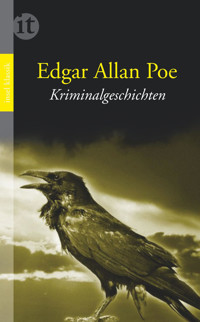
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Edgar Allan Poe gilt als Begründer der modernen Kriminalgeschichte. Mit C. Auguste Dupin schuf er eine der bekanntesten Detektivfiguren der Literatur, die u.a. zum Vorbild für Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes wurde. C. Auguste Dupin verfügt nicht nur über einen messerscharfen Verstand und einen analytischen Blick, er besitzt auch die seltene Gabe, Gedankengänge anderer Menschen nachvollziehen zu können – dank dieser Fähigkeiten vermag er die schwierigsten Fälle aufzuklären. Kein Wunder also, daß sogar die Pariser Polizeipräfektur seine Hilfe benötigt! Die unheimlichen Morde in der Rue Morgue, das Geheimnis der ermordeten Marie Rogêt und der Diebstahl eines Briefes mit weitreichenden Folgen – drei scheinbar unlösbare Fälle, die die Polizei vor Rätsel stellen, doch Dupin ist den Tätern schon bald auf der Spur … . Dieser Band versammelt die spannendsten Kriminalgeschichten vom Meister des Unheimlichen:Die Morde in der Rue Morgue, Der entwendete Brief, Das Geheimnis um Marie Rogêt, Der Mann in der Menge, Der Goldkäfer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Edgar Allan Poe gilt als Begründer der modernen Kriminalgeschichte. Mit C. Auguste Dupin schuf er eine der bekanntesten Detektivfiguren der Literatur, die u. a. zum Vorbild für Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes wurde.
C. Auguste Dupin verfügt nicht nur über einen messerscharfen Verstand und einen analytischen Blick, er besitzt auch die seltene Gabe, Gedankengänge anderer Menschen nachvollziehen zu können – dank dieser Fähigkeiten vermag er die schwierigsten Fälle aufzuklären. Kein Wunder also, daß sogar die Pariser Polizeipräfektur seine Hilfe benötigt!
Die unheimlichen Morde in der Rue Morgue, das Geheimnis der ermordeten Marie Rogêt und der Diebstahl eines Briefes mit weitreichenden Folgen – drei scheinbar unlösbare Fälle, die die Polizei vor Rätsel stellen, doch Dupin ist den Tätern schon bald auf der Spur …
Dieser Band versammelt die spannendsten Kriminalgeschichten vom Meister des Unheimlichen: Die Morde in der Rue Morgue, Der entwendete Brief, Das Geheimnis um Marie Rogêt, Der Mann in der Menge, Der Goldkäfer.
E. A. Poe, geboren am 19. Januar 1809 in Boston, erlangte Weltruhm durch seine Schauer- und Gruselgeschichten, mit denen er seit je den Nerv des lesenden Publikums traf. Er ist einer der meistgelesenen Autoren der Weltliteratur; seine Kurzgeschichten zählen zu den Meisterwerken des Genres. Er starb am 7. Oktober 1849 unter ungeklärten Umständen.
Von ihm sind im insel taschenbuch zuletzt erschienen: Shadow/Schatten (it 3168), Sämtliche Erzählungen in vier Bänden (it 3376), Horrorgeschichten (it 4531).
Edgar Allan Poe
Kriminalgeschichten
Das Beste vom Meister des Unheimlichen
Umschlagfoto: Ron Bouwhuis/Corbis
eBook Insel Verlag Berlin 2012
Für diese Ausgabe © Insel Verlag Berlin 2012
Für die Übersetzung © 1989 Insel-Verlag Anton Kippenberg, Leipzig
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Hinweise zu dieser Ausgabe am Schluß des Bandes
Satz: Hümmer GmbH, Waldbüttelbrunn
eISBN 978-3-458-78790-7
www.insel-verlag.de
Inhalt
Die Morde in der Rue Morgue
Der entwendete Brief
Das Geheimnis um Marie Rogêt
Der Mann in der Menge
Der Goldkäfer
Die Morde in der Rue Morgue
Welches Lied die Sirenen sangen oder welchen Namen Achill sich gab, als er sich bei den Frauen barg, das sind wohl verwirrende Fragen, doch sie entziehen sich nicht ganz aller Mutmaßung.
Sir Thomas Browne
Die Geisteskräfte, die man die analytischen nennt, sind in sich selbst kaum analysierbar. Nur in ihren Auswirkungen vermögen wir sie zu fassen. Wir wissen von ihnen unter anderem, daß sie für ihren Eigner, wenn er sie im Übermaß besitzt, stets eine Quelle lebhaftesten Vergnügens sind. So wie der Starke über seine Körperkraft frohlockt und in Übungen schwelgt, die seine Muskeln in Aktion treten lassen, so erfreut sich der Analytiker jener geistigen Behendigkeit, welche Verworrenes entwirrt. Selbst die trivialsten Beschäftigungen, wenn sie nur sein Talent ins Spiel bringen, ergötzen ihn. Er ist versessen auf Rätsel, auf Vexierfragen, auf Hieroglyphen; und bei einer jeden Lösung legt er einen Grad von Scharfsinn an den Tag, der den Durchschnittsverstand geradezu übernatürlich anmutet. Seine Lösungen, allein und einzig durch die rechte Methode zuwege gebracht, wirken gleichwohl wie pure Intuition.
Mag sein, daß die Fähigkeit zum Ent-wirren durch mathematische Studien erheblich gefördert wird, Studien vor allem in jenem wichtigsten Zweig, den man zu Unrecht und nur wegen seiner rückläufigen Operationen analytisch genannt hat – gleichsam analytisch par excellence. Doch ist Berechnen an sich noch nicht Analysieren. Ein Schachspieler zum Beispiel tut das eine, ohne sich um das andere auch nur zu bemühen. Daraus folgt, daß man das Schachspiel in seiner Wirkung auf die Geistesanlagen gröblich mißverstanden hat. Doch will ich hier keine Abhandlung schreiben, sondern nur einer ziemlich eigenartigen Erzählung ein paar ganz zufällige Bemerkungen vorausschicken; so möchte ich die Gelegenheit ergreifen, zu behaupten, daß die sublimeren Kräfte des denkenden Verstandes entschiedener und zweckdienlicher von dem bescheidenen Damespiel beansprucht werden als von aller ausgeklügelten Oberflächlichkeit des Schachspiels. Bei letzterem, wo den Figuren verschiedenartige und bizarre Züge mit unterschiedlichen und variablen Werten eignen, wird (ein nicht ungewöhnlicher Irrtum) das, was nur kompliziert ist, fälschlich für tiefgründig gehalten. Die Aufmerksamkeit wird hier mit allem Nachdruck auf den Plan gerufen. Erlahmt sie für einen Augenblick, so unterläuft auch schon ein Versehen, das Schaden oder Niederlage zur Folge hat. Da die möglichen Züge nicht nur mannigfaltig, sondern auch verworren sind, vervielfacht sich die Gefahr solchen Versehens; und in neun von zehn Fällen ist es eher der konzentriertere als der scharfsinnigere Spieler, der gewinnt. Beim Damespiel hingegen, wo die Züge einheitlich sind und kaum voneinander abweichen, ist eine Unachtsamkeit weniger wahrscheinlich, und da die pure Aufmerksamkeit verhältnismäßig unbeschäftigt bleibt, sind die Vorteile, die die eine oder andere Partei erringt, allein überlegenem Scharfsinn zuzuschreiben. Um mich weniger abstrakt auszudrücken: Stellen wir uns ein Damespiel vor, wo die Steine sich auf vier Damen reduziert haben und wo ein Versehen natürlich nicht zu erwarten ist. Es leuchtet ein, daß der Sieg (gleichrangig, wie die Spieler sind) hier nur durch irgendeinen ausgeklügelten Zug errungen werden kann, das Ergebnis einer entschiedenen Anstrengung des Verstandes. Gängiger Hilfsmittel beraubt, versetzt sich der Analytiker in den Geist seines Gegenspielers, identifiziert sich damit und erkennt so nicht selten auf den ersten Blick, auf welchem Wege allein (mitunter wirklich einem lächerlich einfachen) er den anderen in eine Falle locken oder zu einer Fehlrechnung verleiten kann.
Seit langem rühmt man dem Whistspiel nach, daß es das sogenannte Berechnungsvermögen schule; und Geister von höchstem Rang haben, wie man weiß, ein scheinbar unerklärliches Vergnügen daran gefunden, während sie das Schachspiel als oberflächlich verwarfen. Zweifellos gibt es nichts Vergleichbares, was derart hohe Ansprüche an die Fähigkeit zum Analysieren stellt. Der beste Schachspieler der Christenheit mag kaum mehr sein als nur eben der beste Schachmeister; Fertigkeit im Whist dagegen begreift in sich die Befähigung, in all jenen gewichtigeren Unternehmen erfolgreich zu sein, wo Geist gegen Geist streitet. Wenn ich Fertigkeit sage, so meine ich jene Vollkommenheit im Spiel, die ein Erfassen aller Möglichkeiten einschließt, aus denen sich rechtens Vorteil ziehen läßt. Diese sind nicht nur mannigfaltig, sondern auch vielgestaltig und liegen oft in Schlupfwinkeln des Denkens verborgen, die dem gewöhnlichen Verstand ganz und gar unzugänglich sind. Aufmerksam beobachten heißt deutlich im Gedächtnis behalten; und insofern wird der konzentrierte Schachspieler auch beim Whist bestehen, zumal die Regeln von Hoyle (die auf dem reinen Mechanismus des Spiels basieren) hinlänglich und allgemein verständlich sind. So sind ein gutes Gedächtnis und ein Vorgehen streng ›nach dem Buche‹ Kernpunkte, die allgemein als die Summe guten Spielens gelten. Das Geschick des Analytikers aber zeigt sich auf Gebieten, die jenseits der Grenzen purer Regeln liegen. Stillschweigend stellt er zahllose Beobachtungen an und zieht seine Schlüsse. Das gleiche tun vielleicht auch seine Mitspieler; doch die unterschiedliche Spannweite der gewonnenen Information liegt nicht so sehr in der Stichhaltigkeit der Schlüsse wie in der Qualität der Beobachtung. Wissen muß man vor allem, was es zu beobachten gilt. Unser Spieler legt sich da keinerlei Beschränkungen auf; und sein Hauptanliegen, das Spiel, hindert ihn nicht, Schlüsse aus Dingen zu ziehen, die außerhalb des Spiels liegen. Er prüft die Miene seines Partners und vergleicht sie sorgfältig mit der seiner beiden Gegenspieler. Er beachtet, auf welche Art und Weise ein jeder die Karten in der Hand gruppiert, und liest an den Blicken, die ihre Eigentümer auf jede Karte werfen, oft Trumpf um Trumpf und Bildkarte um Bildkarte ab. Er bemerkt jede Veränderung des Gesichtsausdrucks im Verlauf des Spiels und erschließt eine Fülle von Gedanken aus den Schattierungen von Gewißheit, Bestürzung, Triumph oder Verdruß. Aus der Art, wie jemand einen Stich aufnimmt, folgert er, ob derselbe Spieler einen zweiten Stich in der Farbe gewinnen kann. Er erkennt eine Finte an der Gebärde, mit der die Karte auf den Tisch geworfen wird. Ein beiläufiges oder unachtsames Wort; das versehentliche Fallenlassen oder Aufdecken einer Karte, begleitet von dem ängstlichen oder unbekümmerten Bemühen, sie zu verbergen; das Zählen der Stiche und ihre Anordnung; Verlegenheit, Zögern, Eifer oder Zagen – alles bietet seiner scheinbar intuitiven Wahrnehmung Hinweise auf den wahren Stand der Dinge. Nachdem die ersten zwei oder drei Runden gespielt sind, weiß er genau, was jeder in Händen hält, und von nun an spielt er seine Karten mit so entschiedener Zielsicherheit aus, als hätte die übrige Gesellschaft die Bildseiten ihrer Karten nach außen gekehrt.
Die analytische Begabung sollte nicht mit einfachem Scharfsinn verwechselt werden; denn während der Analytiker notwendigerweise auch scharfsinnig ist, ist der Scharfsinnige oft erstaunlich unfähig zu analysieren. Die konstruktive Begabung oder Kombinationsfähigkeit, durch die Scharfsinn sich gewöhnlich manifestiert und der die Phrenologen (ich glaube zu Unrecht) ein gesondertes Organ zugeordnet haben, weil sie sie für ein Urvermögen hielten, ist so oft bei Menschen beobachtet worden, deren Denkvermögen im übrigen geradezu an Schwachsinn grenzte, daß es bei den Sittenlehrern allgemeine Aufmerksamkeit erregt hat. Zwischen Scharfsinn und analytischer Begabung besteht tatsächlich ein weitaus größerer Unterschied als zwischen Phantasie und Vorstellungskraft, wiewohl er seiner Natur nach durchaus analog ist. In der Tat wird man gewahren, daß scharfsinnige Leute immer phantasiereich sind, daß echte Vorstellungskraft hingegen stets mit analytischer Begabung einhergeht.
Die folgende Erzählung wird den Leser gewissermaßen wie ein Kommentar zu den eben vorgebrachten Behauptungen anmuten.
Als ich mich während des Frühjahrs und eines Teils des Sommers 18. . in Paris aufhielt, machte ich dort die Bekanntschaft eines Monsieur C. Auguste Dupin. Dieser junge Herr war von bester – ja von illustrer Familie, aber durch eine Reihe widriger Umstände in so große Armut geraten, daß seine tatkräftige Natur ihr unterlag und er aufhörte, sich in der Welt zu tummeln oder sich um die Wiedergewinnung seines Vermögens zu kümmern. Dank der Gefälligkeit seiner Gläubiger war ihm noch ein kleiner Rest seines väterlichen Erbteils verblieben, und mit den Einkünften, die ihm daraus zuflossen, gelang es ihm durch rigorose Sparsamkeit, seinen puren Lebensunterhalt zu bestreiten, ohne sich um die Entbehrlichkeiten des Lebens zu scheren. Bücher allerdings waren sein einziger Luxus, und die sind in Paris wohlfeil zu erwerben.
Zum ersten Mal begegneten wir uns in einer obskuren Bücherei in der Rue Montmartre, wo der Umstand, daß wir beide auf der Suche nach demselben sehr seltenen und merkwürdigen Buche waren, uns in engere Verbindung brachte. Wir sahen uns ein ums andere Mal. Ich nahm tiefen Anteil an der kleinen Familiengeschichte, die er mit all der Offenheit vor mir ausbreitete, welche dem Franzosen eigen ist, wo immer es um die eigene Person geht. Zudem erstaunte mich das Ausmaß seiner Belesenheit; und vor allem entflammten mich das lodernde Feuer und die lebhafte Frische seiner Vorstellungskraft. Da ich in Paris das zu finden hoffte, wonach ich damals trachtete, glaubte ich, daß die Gesellschaft eines solchen Mannes ein unschätzbarer Gewinn für mich sein werde, und freimütig bekannte ich ihm diese meine Meinung. Schließlich vereinbarten wir, für die Dauer meines Aufenthalts in der Stadt zusammen zu wohnen, und da meine Lebensumstände etwas weniger verworren waren als die seinen, überließ er es mir, auf meine Kosten ein altersschwaches wunderliches Haus zu mieten und in einem Stil einzurichten, welcher der recht phantastischen Düsternis unserer beider Gemütsverfassung angemessen war; ein Haus, das lange schon leergestanden hatte, abergläubischer Vorstellungen wegen, denen wir nicht nachforschten, und das in einem abgelegenen, einsamen Viertel des Faubourg St. Germain nun seinem Einsturz entgegenschwankte.
Wären der Welt unsere Lebensgewohnheiten an diesem Ort bekannt geworden, so hätte man uns für Verrückte gehalten – wenn auch vielleicht für Verrückte harmloser Natur. Unsere Zurückgezogenheit war vollkommen. Wir empfingen keinen Besuch. Freilich hatte ich unseren Zufluchtsort sorgfältig vor meinen früheren Freunden geheimgehalten; und Dupin hatte schon seit vielen Jahren jeden Umgang gemieden und war selbst ein Unbekannter in Paris. Wir lebten ganz auf uns selbst bezogen.
Es war eine merkwürdige Marotte meines Freundes (denn wie sonst soll ich es nennen?), in die Nacht, ganz um ihrer selbst willen, verliebt zu sein; und gelassen schickte ich mich in diese bizarrerie, wie in all seine anderen; ja, ich überließ mich seinen wilden Anwandlungen mit schrankenloser Hingabe. Die finstere Gottheit selbst wollte nicht immer bei uns verweilen; aber wir konnten ihre Gegenwart vortäuschen. Beim ersten Morgengrauen schlossen wir alle wuchtigen Fensterläden unseres alten Gebäudes und entzündeten ein paar stark duftende Wachskerzen, die nur einen ganz matten geisterbleichen Schein verbreiteten. Bei diesem Lichtschimmer tummelten wir unsere Seelen nun in Träumen – lasen, schrieben oder führten Gespräche, bis die Uhr uns den Anbruch der echten Dunkelheit kündete. Dann wanderten wir Arm in Arm hinaus auf die Straßen, setzten die Gespräche des Tages fort oder streiften bis in die tiefe Nacht weit umher und suchten inmitten der schwankenden Lichter und Schatten der volkreichen Stadt jenes Übermaß geistig-seelischer Erregung, das ruhige Betrachtung gewähren kann.
Bei solchen Gelegenheiten konnte ich nicht umhin, eine eigentümliche analytische Fähigkeit (die ich freilich bei seiner reichen Vorstellungskraft hätte erwarten können) an Dupin zu gewahren und zu bewundern. Auch schien er lebhaftes Vergnügen daran zu finden, diese Gabe zu betätigen – wo nicht gar zur Schau zu stellen –, und bekannte mir ohne Zögern, welch großen Genuß ihm das bereite. Er rühmte sich mir gegenüber mit verhaltenem, kicherndem Lachen, daß für ihn die meisten Menschen Fenster in der Brust trügen, und pflegte solchen Behauptungen eindeutige und geradezu bestürzende Proben folgen zu lassen, die seine gründliche Kenntnis meines eigenen Innenlebens bekundeten. In solchen Augenblicken gab er sich kühl und abwesend; seine Augen waren ausdruckslos, während seine Stimme, gewöhnlich ein volltönender Tenor, sich zu einem schrillen Diskant erhob, der wohl mißlaunig geklungen haben würde, wäre dieser Eindruck nicht von der bedachtsamen und völlig deutlichen Ausdrucksweise widerlegt worden. Beobachtete ich ihn in solchen Anwandlungen, so hing ich oft gedankenvoll der alten Lehre von der zweigeteilten Seele nach und ergötzte mich an der Vorstellung von einem doppelten Dupin – dem schöpferischen und dem zergliedernden.
Aus dem soeben Gesagten möge man nicht schließen, daß ich hier irgendein Geheimnis preisgeben oder eine phantastische Geschichte erdichten will. Was ich an dem Franzosen geschildert habe, war nur die Auswirkung eines erregten oder vielleicht auch krankhaften Erkenntnisvermögens. Doch wird ein Beispiel am besten erhellen, welcher Natur seine Bemerkungen bei solchen Gelegenheiten waren.
Wir schlenderten eines Nachts durch eine lange schmutzige Straße in der Nähe des Palais Royal. Beide hatten wir, offenbar tief in Gedanken versunken, seit mindestens fünfzehn Minuten keine Silbe gesprochen. Mit einem Mal brach Dupin das Schweigen mit folgenden Worten:
»Er ist wirklich sehr klein geraten und würde sich viel besser für das Théâtre des Variétés eignen.«
»Daran ist nicht zu zweifeln«, erwiderte ich arglos und bemerkte zunächst gar nicht (so sehr war ich in meinen Gedanken befangen), auf welch außergewöhnliche Weise der Sprecher sich in meine Überlegungen eingedrängt hatte. Im nächsten Augenblick besann ich mich, und meine Verwunderung war grenzenlos.
»Dupin«, sagte ich ernst, »dies geht über meinen Horizont. Ohne Zögern gebe ich zu, daß ich bestürzt bin und kaum meinen Sinnen trauen kann. Wie in aller Welt konnten Sie wissen, daß meine Gedanken gerade bei …« Hier hielt ich inne, um mit absoluter Sicherheit herauszubringen, ob er wirklich wußte, an wen ich dachte.
»… bei Chantilly waren«, sagte er, »warum halten Sie inne? Sie stellten fest, daß seine winzige Gestalt ihn für die Tragödie ungeeignet macht.«
Haargenau dies war der Gegenstand meiner Überlegungen gewesen. Chantilly war ein ehemaliger Flickschuster aus der Rue St. Denis, der sich, von plötzlicher Leidenschaft für die Bühne ergriffen, in der Rolle des Xerxes in Crébillons gleichnamiger Tragödie versucht hatte und für seine Bemühungen sattsam verspottet worden war.
»Verraten Sie mir um des Himmels willen«, rief ich aus, »die Methode – wenn es eine Methode gibt –, die es Ihnen erlaubt, auf diese Weise mein Inneres auszuloten.« In Wahrheit war ich noch viel bestürzter, als ich mir wollte anmerken lassen.
»Es war der Obsthändler«, erwiderte mein Freund, »der Sie zu dem Schluß kommen ließ, daß der Sohlenflicker für Xerxes et id genus omne nicht die ausreichende Körpergröße habe.«
»Der Obsthändler! – Sie setzen mich in Erstaunen – ich kenne überhaupt keinen Obsthändler.«
»Der Mann, der mit Ihnen zusammenstieß, als wir in diese Straße einbogen – es mag fünfzehn Minuten her sein.«
Jetzt erinnerte ich mich, daß wirklich ein Obsthändler, der einen großen Korb Äpfel auf dem Kopf trug, mich versehentlich fast umgerissen hätte, als wir aus der Rue C … in die große Durchgangsstraße einbogen, in der wir jetzt standen; was aber dies mit Chantilly zu tun hatte, war mir schlechterdings unverständlich.
An Dupin war auch kein Fünkchen von Scharlatanerie. »Ich will es Ihnen erklären«, sagte er, »und damit Sie alles lückenlos begreifen können, wollen wir zunächst den Gang Ihrer Betrachtungen zurückverfolgen, von dem Augenblick an, da ich das Wort an Sie richtete, bis zu dem der rencontre mit besagtem Obsthändler. Die größeren Glieder der Kette sind folgende: Chantilly, Orion, Dr. Nichol, Epikur, Stereotomie, die Pflastersteine, der Obsthändler.«
Es gibt wohl nur wenige Menschen, die sich nicht zu irgendeiner Zeit ihres Lebens damit vergnügt hätten, die Schritte zurückzuverfolgen, durch die sie zu bestimmten Schlußfolgerungen gelangt sind. Diese Beschäftigung ist oft überaus reizvoll, und wer sich zum ersten Mal darauf einläßt, ist erstaunt über den scheinbar unermeßlichen Abstand und das Fehlen jeden Zusammenhangs zwischen dem Ausgangspunkt und dem Ziel. Wie groß mußte also meine Verblüffung gewesen sein, als ich den Franzosen die eben angeführten Worte sprechen hörte und nicht umhin konnte, zuzugeben, daß er die reine Wahrheit gesagt hatte. Er fuhr fort:
»Wir hatten, kurz bevor wir die Rue C … verließen, von Pferden gesprochen, wenn ich mich recht erinnere. Das war das letzte Thema, das wir erörterten. Als wir in diese Straße einbogen, fegte ein Obsthändler mit einem großen Korb auf dem Kopf eilig an uns vorüber und drängte Sie ab auf einen Haufen Pflastersteine, die an einer Stelle lagen, wo der Damm instand gesetzt wird. Sie traten auf einen der losen Bruchsteine, glitten aus, verstauchten sich leicht den Knöchel, schienen verärgert oder mißgestimmt, murmelten ein paar Worte, wandten sich um, den Steinhaufen zu betrachten, und setzten dann schweigend Ihren Weg fort. Ich gab nicht sonderlich acht auf Ihr Tun; doch ist exaktes Beobachten bei mir in letzter Zeit zu einer Art Zwang geworden.
Sie hefteten den Blick auf den Boden – sahen mit verdrossener Miene auf die Löcher und Furchen im Pflaster (so daß ich merkte, daß Sie noch immer an die Steine dachten), bis wir die kleine, ›Lamartine‹ genannte Gasse erreichten, die man probehalber mit lückenlos aneinandergefügten Blöcken gepflastert hat. Hier hellten Ihre Züge sich auf, und als ich gewahrte, daß sich Ihre Lippen bewegten, konnte ich gar nicht daran zweifeln, daß Sie das Wort ›Stereotomie‹ murmelten, eine Bezeichnung, die man recht gespreizt auf diese Art von Pflasterung anwendet. Ich wußte, daß Sie den Ausdruck ›Stereotomie‹ nicht formen konnten, ohne an Atome erinnert zu werden und somit an die Lehren von Epikur; und da ich Sie vor noch nicht langer Zeit, als wir über diesen Gegenstand sprachen, darauf hinwies, wie einzigartig – und dabei kaum bemerkt – die vagen Vermutungen jenes erlauchten Griechen von der jüngsten Nebularkosmogonie bestätigt worden sind, glaubte ich, daß Sie nun zwangsläufig Ihre Augen zu dem großen Nebel im Orion aufheben müßten, ja, ich rechnete mit Sicherheit darauf. Sie schauten wirklich hinauf; und jetzt war ich überzeugt, daß ich Ihren Schritten richtig gefolgt war. Nun machte in jener bissigen Tirade gegen Chantilly, die im gestrigen ›Musée‹ erschien, der Krittler ein paar zynische Anspielungen auf des Flickschusters Namenswechsel beim Anlegen des Kothurns und zitierte dabei eine lateinische Verszeile, über die wir oft gesprochen haben. Ich meine die Worte:
Perdidit antiquum litera prima sonum.
Ich hatte Ihnen erklärt, daß sich dies auf Orion beziehe, den man früher Urion schrieb; und wegen gewisser Sarkasmen, die mit dieser Erklärung einhergingen, wußte ich wohl, daß Sie sie nicht vergessen haben konnten. Es lag deshalb auf der Hand, daß Sie nicht verfehlen würden, die beiden Gedanken – an Orion und an Chantilly – zu koppeln. Daß Sie es wirklich taten, sah ich an der Art des Lächelns, das über Ihre Lippen huschte. Sie dachten an des armen Flickschusters Opferung. Bis dahin waren Sie leicht gebeugt gegangen; nun aber sah ich, daß Sie sich zu voller Höhe emporrichteten. Da war ich denn sicher, daß Sie über das winzige Format von Chantilly nachdachten. An dieser Stelle unterbrach ich Ihre Betrachtungen, um zu bemerken, daß er – da er in der Tat sehr klein geraten sei, dieser Chantilly – sich viel besser für das Théâtre des Variétés eignen würde.«
Nicht lange darauf durchblätterten wir eine Abendausgabe der ›Gazette des Tribunaux‹, als plötzlich die folgenden Abschnitte unsere Aufmerksamkeit bannten:
›Ungeheuerliche Mordfälle. – Heute morgen gegen drei Uhr wurden die Bewohner des Quartier St. Roch durch eine Reihe entsetzlicher Schreie aus dem Schlaf gerissen, die allem Anschein nach aus dem vierten Stockwerk eines Hauses in der Rue Morgue drangen, das, wie man wußte, nur von einer Madame L'Espanaye und ihrer Tochter, Mademoiselle Camille L'Espanaye, bewohnt wurde. Nach einiger Verzögerung durch den vergeblichen Versuch, sich auf die übliche Weise Einlaß zu verschaffen, wurde mit einem Brecheisen das Haustor aufgebrochen, und acht oder zehn Leute aus der Nachbarschaft betraten in Begleitung von zwei Gendarmen das Haus. Um diese Zeit waren die Schreie verstummt; doch als die Gesellschaft die erste Treppe hinaufstürmte, waren zwei oder mehr rauhe Stimmen in zornigem Streit zu vernehmen, die aus dem oberen Teil des Hauses herzukommen schienen. Als man den zweiten Treppenabsatz erreicht hatte, waren auch diese Laute verstummt, und alles blieb völlig ruhig. Die Gruppe verteilte sich und eilte von Zimmer zu Zimmer. Beim Betreten eines geräumigen Hinterzimmers im vierten Stock (dessen Tür aufgebrochen wurde, da sie verschlossen war und der Schlüssel innen steckte) bot sich ein Anblick, der alle Anwesenden mit Bestürzung, ja mit Grausen erfüllte.
Das Zimmer war in einem chaotischen Zustand – das Mobiliar zertrümmert und in alle Richtungen wüst umhergeworfen. Nur eine einzige Bettstatt war zu sehen; und aus dieser war das Bettzeug herausgerissen und mitten auf den Fußboden geworfen worden. Auf einem Stuhl lag ein Rasiermesser, mit Blut beschmiert. Auf dem Feuerrost fanden sich zwei oder drei lange dicke Strähnen grauen Menschenhaars, blutbesudelt auch sie und allem Anschein nach mit den Wurzeln ausgerissen. Auf dem Fußboden fand man vier Napoleondors, einen Topasohrring, drei große Silberlöffel, drei kleinere aus Neusilber und zwei Beutel, die an die viertausend Franc in Gold enthielten. Die Schubladen einer Kommode, die in einer Ecke stand, waren aufgezogen und offensichtlich ausgeraubt worden, wiewohl noch viele Gegenstände darin verblieben waren. Einen kleinen eisernen Safe entdeckte man unter dem Bettzeug (nicht unter der Bettstatt). Er war offen, und der Schlüssel steckte noch im Schloß. Es war nichts weiter darin als ein paar alte Briefe und andere Papiere von geringer Bedeutung.
Von Madame L'Espanaye fehlte jede Spur; da man aber eine ungewöhnliche Menge Ruß auf der Feuerstelle entdeckte, untersuchte man den Rauchfang und zerrte (entsetzlich zu sagen!) die Leiche der Tochter, mit dem Kopf nach unten, daraus hervor, die in dieser Haltung ein beträchtliches Stück den engen Schacht hinaufgezwängt worden war. Der Körper war noch warm. Bei näherem Hinsehen entdeckte man zahlreiche Hautabschürfungen, die zweifellos von dem gewaltsamen Hinaufstoßen und Herausziehen herrührten. Auf dem Gesicht fanden sich viele schlimme Kratzwunden und auf dem Hals dunkle Quetschungen und tiefe Einschnitte von Fingernägeln, als sei die Verstorbene erdrosselt worden.
Nach einer gründlichen Durchsuchung aller Teile des Hauses, die aber keinen weiteren Aufschluß brachte, begab sich die Gesellschaft in einen kleinen gepflasterten Hof hinter dem Gebäude, wo die Leiche der alten Dame lag, deren Hals fast völlig durchtrennt war, so daß bei dem Versuch, sie aufzuheben, der Kopf abfiel. Der Körper wie auch der Kopf waren grauenhaft zugerichtet – jener so schlimm, daß er kaum mehr etwas Menschenähnliches hatte.
Bisher gibt es, soviel wir wissen, nicht den geringsten Anhaltspunkt, dieses schreckliche Rätsel zu lösen.‹
Die Zeitung des nächsten Tages brachte folgende ergänzende Einzelheiten:
›Die Tragödie in der Rue Morgue. Viele Personen sind im Hinblick auf diese ungeheuerliche und gräßliche Affäre befragt worden‹ (das Wort affaire hat in Frankreich noch nicht jenen Hauch von Leichtfertigkeit, der ihm bei uns anhaftet), ›aber nichts, was irgend Licht darauf werfen könnte, ist dabei verlautbart. Wir geben im Folgenden alle wesentlichen Zeugenaussagen wieder, die sich beibringen ließen.
Pauline Dubourg, Wäscherin, sagt aus, daß sie die beiden Verstorbenen seit drei Jahren gekannt hat, da sie in diesem Zeitraum für sie gewaschen hat. Die alte Dame und ihre Tochter schienen sich gut zu verstehen – gingen sehr zärtlich miteinander um. Sie waren vorbildliche Zahler. Konnte nichts über ihre Lebensweise oder ihre Erwerbsquellen sagen. Glaubte, daß Madame L. ihren Unterhalt mit Kartenlegen verdiente. Es hieß, sie habe Ersparnisse. Traf nie eine Menschenseele im Haus, wenn sie die Wäsche abholte oder zurückbrachte. War sicher, daß sie keinen Dienstboten beschäftigten. Das ganze Haus schien völlig unmöbliert zu sein, mit Ausnahme des vierten Stockwerks.
Pierre Moreau, Tabakhändler, sagt aus, daß er etwa vier Jahre lang kleine Mengen von Tabak und Schnupftabak an Madame L'Espanaye zu verkaufen pflegte. Ist in dem Viertel geboren und war immer dort ansässig. Die Verstorbene und ihre Tochter lebten seit über sechs Jahren in dem Haus, in welchem die Leichen gefunden wurden. Vorher wurde es von einem Juwelier bewohnt, der die oberen Räume an verschiedene Personen untervermietete. Das Haus gehörte Madame L. Sie wurde ungehalten über den Mißbrauch des Gebäudes durch ihren Mieter und zog selbst hinein, lehnte es aber ab, irgendeinen Teil davon zu vermieten. Die alte Dame war kindisch. Zeuge hatte die Tochter nur etwa fünf- oder sechsmal in den sechs Jahren gesehen. Die beiden lebten äußerst zurückgezogen – es hieß, sie hätten Geld. Hatte unter den Nachbarn sagen hören, daß Madame L. wahrsage – glaubte es aber nicht. Hatte nie einen Menschen das Haus betreten sehen, außer der alten Dame selbst und ihrer Tochter, ein- oder zweimal einen Dienstmann und etwa acht- oder zehnmal einen Arzt.
Viele andere Personen, Nachbarn, machten Aussagen gleichen Inhalts. Nicht einem einzigen Menschen wurde nachgesagt, er habe das Haus öfter besucht. Niemand wußte, ob es irgendwelche lebenden Verwandten von Madame L. und ihrer Tochter gab. Die Läden der Frontfenster wurden selten geöffnet. Die auf der Rückseite waren immer geschlossen, bis auf die des großen Hinterzimmers im vierten Stock. Das Haus war in gutem Zustand – nicht sehr alt.
Isidore Musèt, Gendarm, sagt aus, daß er etwa um drei Uhr morgens zu dem Haus gerufen wurde und einige zwanzig oder dreißig Personen vor der Haustür antraf, die sich bemühten, hineinzugelangen. Brach die Tür schließlich mit einem Bajonett auf – nicht mit einem Brecheisen. Hatte nicht viel Mühe damit, weil es eine Doppel- oder Flügeltür war, weder unten noch oben durch einen Riegel gesichert. Die Schreie dauerten an, bis die Tür aufgebrochen war – und verstummten dann plötzlich. Es schienen die Wehlaute eines Menschen (oder mehrerer Menschen) in höchster Todesnot zu sein – sie waren laut und langgedehnt – nicht kurz und rasch aufeinanderfolgend. Zeuge stieg den anderen voran die Treppe hinauf. Hörte, auf dem ersten Absatz angekommen, zwei Stimmen in lautem und zornigem Wortwechsel – rauh die eine, die andere viel schriller – eine sehr merkwürdige Stimme. Konnte einige Wörter der ersteren unterscheiden, welche zu einem Franzosen gehörte. War überzeugt, daß es keine Frauenstimme war. Konnte die Wörter ›sacré‹ und ›diable‹ unterscheiden. Die schrille Stimme war die eines Ausländers. War sich nicht im klaren, ob es eine Männer- oder eine Frauenstimme war. Konnte nicht ausmachen, was gesagt wurde, glaubte aber, daß es Spanisch war. Der Zustand des Zimmers und der Leichen wurde von diesem Zeugen genauso beschrieben, wie wir es gestern schilderten.
Henri Duval, ein Nachbar und von Beruf Silberschmied, sagt aus, daß er zu der Gruppe von Leuten gehörte, die als erste das Haus betraten. Bestätigt im großen und ganzen die Aussage von Musèt. Sobald sie sich den Zutritt erzwungen hatten, schlossen sie die Tür wieder ab, um die Menge fernzuhalten, die trotz der späten Stunde sehr rasch zusammenströmte. Die schrille Stimme war nach Meinung dieses Zeugen die eines Italieners. War sicher, daß es kein Französisch war. War sich nicht klar darüber, ob es eine Männerstimme war. Es könnte auch eine Frauenstimme gewesen sein. Ist nicht vertraut mit der italienischen Sprache. Konnte die Wörter nicht ausmachen, war aber wegen des Tonfalls überzeugt, daß der Sprecher ein Italiener war. Kannte Madame L. und ihre Tochter. Hatte des öfteren mit beiden gesprochen. War sicher, daß die schrille Stimme keiner der beiden Verstorbenen gehörte.
… Odenheimer, restaurateur. Dieser Zeuge erbot sich freiwillig, eine Aussage zu machen. Wurde, da er nicht Französisch spricht, durch einen Dolmetsch befragt. Stammt aus Amsterdam. Ging um die Zeit der Schreie am Haus vorüber. Sie dauerten etliche Minuten an – schätzungsweise zehn. Sie waren langgedehnt und laut – überaus schrecklich und beklemmend. War einer von denen, die in das Gebäude eindrangen. Bestätigte die vorhergehenden Aussagen in allen Punkten bis auf einen. War sicher, daß die schrille Stimme die eines Mannes war – eines Franzosen. Konnte die ausgestoßenen Wörter nicht unterscheiden. Sie waren laut und hastig – abgerissen – offenbar in Furcht wie auch in Wut gesprochen. Die Stimme war krächzend – nicht so sehr schrill wie krächzend. Konnte sie nicht eigentlich eine schrille Stimme nennen. Die rauhe Stimme sagte wiederholt ›sacré‹, ›diable‹ und einmal ›mon Dieu‹.
Jules Mignaud, Bankier vom Bankhaus Mignaud et Fils, Rue Deloraine. Ist Mignaud senior. Madame L'Espanaye besaß etwas Vermögen. Hatte im Frühjahr … (vor acht Jahren) ein Konto bei seiner Bank eröffnet. Zahlte häufig kleine Summen ein. Hatte nie etwas abgehoben, bis sie sich drei Tage vor ihrem Tod persönlich die Summe von viertausend Franc abholte. Diese Summe wurde in Gold ausgezahlt, und ein Angestellter mußte ihr das Geld nach Hause tragen.
Adolphe Le Bon, Angestellter bei Mignaud et Fils, sagt aus, daß er an dem fraglichen Tage um Mittag mit den in zwei Beuteln verwahrten viertausend Franc Madame L'Espanaye zu ihrer Wohnung begleitete. Nach dem Öffnen der Haustür erschien Mademoiselle L. und nahm ihm den einen Beutel ab, während die alte Dame sich den anderen aushändigen ließ. Dann verbeugte er sich und ging. Sah um diese Zeit nicht einen einzigen Menschen auf der Straße. Es ist eine Nebenstraße – sehr einsam.
William Bird, Schneider, sagt aus, daß er zu der Gruppe gehörte, die in das Haus eindrang. Ist Engländer. Lebt seit zwei Jahren in Paris. War einer der ersten, die die Treppe hinaufeilten. Hörte die streitenden Stimmen. Die rauhe Stimme war die eines Franzosen. Konnte verschiedene Wörter ausmachen, kann sich aber nicht mehr an alle erinnern. Vernahm deutlich ›sacré‹ und ›mon Dieu‹. Zu gleicher Zeit war ein Geräusch zu hören, als wenn mehrere Personen miteinander rängen – ein scharrendes, schlurfendes Geräusch. Die schrille Stimme war sehr laut – lauter als die rauhe. Ist sicher, daß es nicht die Stimme eines Engländers war. Schien die eines Deutschen zu sein. Hätte eine Frauenstimme sein können. Versteht kein Deutsch.
Vier der obengenannten Zeugen sagten bei nochmaliger Befragung aus, daß die Tür des Zimmers, in dem die Leiche von Mademoiselle L. gefunden wurde, von innen verschlossen war, als die Gruppe dort anlangte. Alles war völlig still – kein Stöhnen, keinerlei Geräusche irgendwelcher Art. Nach dem Aufbrechen der Tür war niemand zu sehen. Die Schiebefenster sowohl des hinteren wie des vorderen Zimmers waren heruntergelassen und von innen fest verriegelt. Eine Tür zwischen den beiden Räumen war zugeklinkt, aber nicht verschlossen. Die Tür, die vom vorderen Zimmer in den Korridor führt, war abgeschlossen, und der Schlüssel steckte innen. Ein kleiner Raum im vierten Stockwerk, an der Frontseite des Hauses und am oberen Ende des Korridors, stand offen; das heißt, die Tür war nur angelehnt. Dieser Raum war vollgestopft mit alten Betten, Kisten und Kasten und dergleichen. Diese wurden sorgfältig auseinandergerückt und durchsucht. Es gab nicht einen Zollbreit im ganzen Hause, der nicht sorgfältig durchsucht wurde. Stoßbesen wurden die Kamine hinauf- und heruntergeschoben. Das Haus war vierstöckig, mit Bodenkammern (Mansarden). Eine Klapptür am Dach war fest zugenagelt – schien seit Jahren nicht geöffnet worden zu sein. Die Zeit zwischen dem Gewahrwerden der streitenden Stimmen und dem Aufbrechen der Zimmertür wurde von den Zeugen unterschiedlich angegeben. Bei einigen waren es nicht mehr als drei Minuten – bei anderen nicht weniger als fünf. Die Tür ließ sich nur mit Mühe öffnen.
Alfonzo Garcio, Leichenbestatter, sagt aus, daß er in der Rue Morgue ansässig ist. Stammt aus Spanien. Gehörte zu der Gruppe, die in das Haus eindrang. Stieg nicht mit die Treppe hinauf. Ist nervös und fürchtete die Folgen der Aufregung. Hörte die streitenden Stimmen. Die rauhe Stimme war die eines Franzosen. Konnte nicht ausmachen, was gesagt wurde. Die schrille Stimme war die eines Engländers – ist dessen sicher. Versteht zwar kein Englisch, urteilt aber nach dem Tonfall.
Alberto Montani, Zuckerbäcker, sagt aus, daß er unter den ersten war, die die Treppe hinaufstiegen. Hörte die fraglichen Stimmen. Die rauhe Stimme war die eines Franzosen. Unterschied mehrere Wörter. Der Sprecher schien jemanden zur Rede zu stellen. Konnte nicht ausmachen, was die schrille Stimme sagte. Sprach schnell und abgehackt. Hält sie für die Stimme eines Russen. Bestätigt im ganzen die übrigen Aussagen. Ist Italiener. Hat nie mit einem gebürtigen Russen gesprochen.
Mehrere Zeugen erklärten hier auf neuerliche Befragung, daß die Rauchabzüge aller Zimmer im vierten Stock zu eng seien, um einen Menschen hindurchzulassen. Mit ›Stoßbesen‹ waren zylindrische Kehrbürsten gemeint, wie sie zum Reinigen der Schornsteine gebraucht werden. Diese Bürsten wurden, auf und nieder, durch jede Esse im Haus geschoben. Es gibt keinen hinteren Treppenaufgang, durch den irgend jemand hätte entweichen können, während die Gesellschaft treppauf stieg. Die Leiche der Mademoiselle L'Espanaye war so fest in den Abzug hineingezwängt worden, daß es erst der vereinten Kraft von vier oder fünf Männern gelang, sie herauszuziehen.
Paul Dumas, Arzt, sagt aus, daß er gegen Tagesanbruch herbeigeholt wurde, um die Leichen in Augenschein zu nehmen. Sie lagen zu dem Zeitpunkt beide auf dem Sackleinen der Bettstelle, in dem Zimmer, wo Mademoiselle L. gefunden worden war. Der Leichnam der jungen Dame war voller blauer Flecke und Schürfwunden. Die Tatsache, daß er den Kamin hinaufgezwängt worden war, würde diesen Befund hinlänglich erklären. Der Hals war arg zerschunden. Dicht unterm Kinn fanden sich mehrere tiefe Kratzwunden, außerdem eine Reihe bläulicher Flecke, die offenbar von Fingereindrücken herrührten. Das Gesicht war entsetzlich verfärbt, die Augäpfel quollen aus den Höhlen. Die Zunge war zum Teil zerbissen. Eine große Quetschung, die offensichtlich vom Eindruck eines Knies herrührte, fand sich über der Magengrube. Nach Ansicht von Monsieur Dumas ist Mademoiselle L'Espanaye von einer oder mehreren unbekannten Personen erdrosselt worden. Die Leiche der Mutter war gräßlich verstümmelt. Alle Knochen des rechten Beines und Armes waren mehr oder weniger zertrümmert. Die linke tibia erheblich zersplittert, desgleichen alle Rippen auf der linken Seite. Der ganze Körper furchtbar zerschunden und verfärbt. Es ließ sich nicht feststellen, wodurch die Verletzungen verursacht worden sind. Eine schwere Holzkeule oder eine breite Eisenstange – ein Stuhl – jede große, schwere und stumpfe Waffe, von einem sehr starken Mann gehandhabt, könnte solche Folgen gezeitigt haben. Niemals hätte eine Frau mit irgendeiner Waffe die Schläge führen können. Der Kopf der Verstorbenen war, als der Zeuge ihn sah, völlig vom Rumpf abgetrennt und ebenfalls schlimm zugerichtet. Der Hals war zweifellos mit einem sehr scharfen Instrument durchschnitten worden – vermutlich einem Rasiermesser.
Alexandre Etienne, Wundarzt, wurde zusammen mit Monsieur Dumas herbeigeholt, um die Leichen in Augenschein zu nehmen. Bestätigte die Aussage und die Ansichten von Monsieur Dumas.
Sonst wurde nichts Bedeutsames herausgebracht, obwohl noch verschiedene andere Personen vernommen wurden. Ein so rätselhafter Mord – sofern es sich hier überhaupt um einen Mord handelt –, so bestürzend in allen Einzelheiten, ist nie zuvor in Paris begangen worden. Die Polizei ist in der größten Verlegenheit – ein ungewöhnliches Vorkommnis bei derartigen Begebenheiten. Doch ist auch nicht der geringste Anhaltspunkt zu sehen.‹
Die Abendausgabe der Zeitung meldete, daß im Quartier St. Roch noch immer die größte Aufregung herrsche – daß das fragliche Grundstück noch einmal sorgfältig durchsucht und neuerlich Zeugen vernommen worden seien, doch alles ohne Erfolg. Ein Nachtrag indessen berichtete, daß Adolphe Le Bon verhaftet und gefangengesetzt worden sei – obschon außer den bereits angeführten Tatsachen offenbar nichts Belastendes gegen ihn vorliege.
Dupin schien außerordentlich interessiert am Fortgang dieser Angelegenheit – jedenfalls schloß ich das aus seinem Verhalten, denn er äußerte sich nicht. Erst nachdem wir die Notiz gelesen, daß man Le Bon festgenommen habe, fragte er mich nach meiner Meinung über die Mordfälle.
Ich konnte nur der Ansicht von ganz Paris beipflichten und sie für ein unlösbares Rätsel halten. Ich sah keinen Weg, der dazu führen könnte, den Mörder aufzuspüren.
»Wir dürfen uns«, sagte Dupin, »nach diesem bloßen Gerippe von einer Untersuchung kein Urteil über den Weg bilden. Die Pariser Polizei, so hoch gepriesen wegen ihres Scharfsinns, ist gewitzt, aber nicht mehr. Es ist keine Methode in ihrem Verfahren, außer der Methode, die der Augenblick eingibt. Sie paradieren mit großspurigen Maßnahmen; doch nicht selten sind diese den jeweiligen Zwecken so wenig angepaßt, daß wir an Monsieur Jourdain erinnert werden, der nach seiner robe-de-chambre verlangte – pour mieux entendre la musique. Die so erzielten Ergebnisse sind oft überraschend, werden aber meistenteils durch puren Eifer und Geschäftigkeit zuwege gebracht. Sind diese Eigenschaften unzulänglich, so schlagen die Pläne fehl. Vidocq zum Beispiel konnte gut raten und war ein beharrlicher Mann. Aber ungeschult im Denken, ging er gerade durch den Übereifer seiner Nachforschungen ständig fehl. Er schmälerte sein Sehvermögen, indem er sich den Gegenstand allzu dicht an die Augen hielt. Er mochte vielleicht das eine oder andere Teilstück mit ungewöhnlicher Deutlichkeit sehen, aber dabei verlor er notwendigerweise die Sache als Ganzes aus den Augen. So ergeht es auch dem allzu Tiefgründigen. Die Wahrheit liegt nicht immer in einem Brunnen. Ja, was die wichtigeren Aufschlüsse betrifft, so glaube ich fest, daß sie sich immer an der Oberfläche befindet. Dunkel ist in den Tälern, wo wir sie suchen, nicht aber auf den Berggipfeln, wo sie zu finden ist. Für Art und Ursprung solchen Irrtums bietet die Betrachtung der Himmelskörper ein gutes Beispiel. Einen Stern nur eben streifen mit den Blicken – ihn aus halbem Auge anschauen, indem man ihm nur die äußeren Teile der retina zukehrt (die empfänglicher sind für schwache Lichteindrücke als die inneren) – das heißt, den Stern deutlich sehen – heißt, seines Glanzes am besten gewahr werden – eines Glanzes, der in ebendem Maße trüb wird, wie wir ihm den vollen