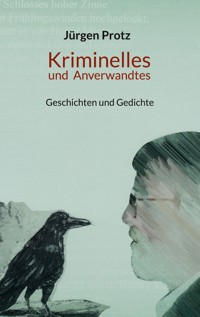
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
In 11 Geschichten und über 20 Gedichten spannt sich der Bogen von kleinen, alltäglichen Missetaten, wie sie jeder begeht, nicht rechtsrelevant, über die man sich schämt, oder wenigstens schämen sollte, bis hin zu unglaublichen Großkriminalitäten, die unsere Gesellschaften schon immer geprägt haben und bis heute weiter bestimmen. Auch die sind keinesfalls rechtsrelevant (oder nur in ganz seltenen Ausnahmen). Das Unglaubliche an ihnen ist, dass sie zumeist gar nicht als kriminell wahrgenommen werden, oft sogar als historisch bedeutsam verehrt und geachtet werden. Zwischen diesen Extremen gibt es selbstverständlich auch Kriminelles, wie wir es jeden Abend vorm Bildschirm konsumieren, sprich Mord und Totschlag, aber auch Irrwege in Bereichen der Kunst, Musik, Sprache, Unterhaltung, deren Verderbtheit vielleicht weniger harmlos ist, als man uns glauben machen möchte, und die als kriminell zu bezeichnen, sich der Autor eben erlaubt. Verpackt ist diese Mischung in witziger und anekdotenreicher Sprache, denn: Spaß soll's schon machen, das Lesen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In 11 Geschichten und über 20 Gedichten spannt sich der Bogen von kleinen, alltäglichen Missetaten, wie sie jeder begeht, nicht rechtsrelevant, über die man sich schämt, oder wenigstens schämen sollte, bis hin zu unglaublichen Großkriminalitäten, die unsere Gesellschaften schon immer geprägt haben und bis heute weiter bestimmen. Auch die sind keinesfalls rechtsrelevant (oder nur in ganz seltenen Ausnahmen). Das Unglaubliche an ihnen ist, daß sie zumeist gar nicht als kriminell wahrgenommen werden, oft sogar als historisch bedeutsam verehrt und geachtet werden.
Zwischen diesen Extremen gibt es selbstverständlich auch Kriminelles, wie wir es jeden Abend vorm Bildschirm konsumieren, sprich Mord und Totschlag, aber auch Irrwege in Bereichen der Kunst, Musik, Sprache, Unterhaltung, deren Verderbtheit vielleicht weniger harmlos ist, als man uns glauben machen möchte, und die als kriminell zu bezeichnen, sich der Autor eben erlaubt.
Verpackt ist diese Mischung in witziger und anekdotenreicher Sprache, denn: Spaß soll’s schon machen, das Lesen.
Inhalt
Die Prügelei vor der Mehrzweckhalle
Fragen in se wind
Wege zum Glück
Ein Familienausflug
Vom Guten im Bösen
Besuch im Vatikan
Der Terrorist
Manchmal (Eleanor Rigby)
Hommage
Der Rabe
Bückeburger Tetralogie I - Der Komplize
Verbrüderung
Liebe geht durch den Magen
Küchenfreuden
Bückeburger Tetralogie II - Nackte Weiber
Von der Asymmetrie
Dedikation an die dicken Damen
Der alte Rabe
Bückeburger Tetralogie III - Julia, oder der Fluch Des Gemäldes
Ein Märchen
So ist die Welt
Bückeburger Tetralogie IV - Über Kriminalität
Seltsam!
Der Eskapist
Über Balladen
Schwabing, der „Winter“, die „7“, das „Occam-Pils“– und ein blaues Auge
An Papa Dada
Techno, Hiphop, Drums‘n‘Bass und die Emanzipation der Frau
modern times
Versuch in moderner Lyrik
Tucholsky und das Baumeln
„Kind of Blue“
Der Aufstand der Konsonanten
Der Zwischenraum und das Laster
Political Correctness
D‘r Hägl
Lullaby
Die Prügelei vor der Mehrzweckhalle
Wer als Deutscher durch den Südwesten Frankreichs reist, sollte die Landessprache beherrschen, wenigstens einigermaßen, sonst steht er auf verlorenem Posten. Denn Deutsch können die Franzosen nicht. Im Elsass vielleicht, und in Paris mit viel Glück, da trifft man schon mal auf einen polyglotten Nachbarn, aber in der Aquitaine? Englisch können sie auch nicht. Das heißt, einige glauben schon, sie sprächen Englisch, aber deren Englisch versteht, wenn überhaupt jemand, dann nur ein anderer Franzose, der ebenfalls Englisch zu sprechen behauptet. Einem Engländer jedoch dürfte das französische Englisch wie einer jener 475 chinesischen Dialekte in den Ohren klingen. Deutsch, wie gesagt, spricht hier nur ein Deutscher. Dieses typisch französische Handicap („andicap“) im Umgang mit anderen Sprachen liegt daran, daß ein Franzose zutiefst davon überzeugt ist, sprechen, miteinander kommunizieren, also menschlichen Umgang pflegen, das ginge nur in ihrer Sprache, auf Französisch; das sei ein Naturgesetz.
Meine französische Schwiegermutter zum Beispiel war vor Jahren, anlässlich ihres ersten Besuches in Deutschland ehrlich überrascht und erstaunt, feststellen zu müssen, daß bei uns sogar die kleinen Kinder schon Deutsch sprechen. Das hätte sie nicht für möglich gehalten.
Deren Tochter, meine Gefährtin seit mehreren Jahrzehnten, ma Dame also, wie ein anderer sie nennen würde, und Mutter unserer Kinder, stammt aus Bordeaux, dem Zentrum des Südwestens, und ihre weit verzweigte Familie siedelt außer in Bordeaux in der ganzen Aquitaine, vom
Béarn über das Entre-deux-Mers bis in die Charente. Als Deutscher wirst du in diesem teils ländlichbäuerlich strukturierten, teils bürgerlich-intellektuellen Clan als Exot bestaunt – und fallen gelassen, links, ganz links liegen gelassen, wenn, ja wenn du nicht französisch sprichst.
Moi, je me débrouille, ich wurschtele mich so durch, heißt das; ich kann mich verständigen, zur Not sogar einen Witz erzählen, wenn’s sein muß, wenn auch nicht grammatikalisch fehlerfrei. Damit bin ich akzeptiert, gehöre zur Familie und werde immer wieder mal von einem der Cousins mit einem freundlich bemühten „Aschtunk!“ begrüßt.
Es geschieht wohl auch, beispielsweise auf den Zuschauerrängen des Stade Lescure in Bordeaux, daß du einen von einer Schiedsrichterentscheidung enttäuschten Anhänger der Bordelaiser Girondins laut rufen hörst „Arbitre: Aschloch! Arbitre: Aschloch!“, wonach sich der Rufer stolz nach allen Seiten umschaut, zu sehen, ob auch jeder der Umstehenden seine polyglotte Raffinesse verstanden habe. Aschloch übrigens mit immerhin korrektem Rachenlaut am Ende des Wortes. Was umso beachtlicher ist, als doch bis heute zum Beispiel die französischen Kenner klassischer Musik – und derer sind nicht wenige! – darüber uneins sind, ob der große Leipziger Thomaskantor nun „Basch“ oder „Back“ heiße.
Die bereits erwähnten bäuerlich-ländlichen Zweige der Familie finden ihr Bordelaiser Pendant in einer mehr bürgerlich intellektuellen Richtung. Ma Dames Bordelaiser Lieblingscousins zum Beispiel sind hoch belesene und politisch informierte Leute, mit denen du stundenlang darüber diskutieren kannst, wieviel und ob überhaupt die deutsche Sozialdemokratie noch mit dem französischen Sozialismus gemeinsam habe, Fragen, welche die bäuerlichen Cousins nicht mal beim täglichen apéro und schon gar nicht beim sonntäglichen vin d’honneur mit lokalen Politikern bereden würden. Auch ob das Kunststück, das die Bordelaiser Cousins fertigbringen, nämlich zugleich gläubige Katholiken wie auch kämpferische Kommunisten zu sein, wirklich ein Kunststück sei, ließe die ländlichen Zweige kalt. Möglich übrigens, aber dies nur nebenbei, daß diese Summe aus Kommunismus und Katholizismus zu jenem Gutmenschentum führt, welches unleugbar den Bordelaiser Cousins eignet und sie dazu verleitet, der Deutschen Sozial-Demokratie, um einiges mehr an Sozialismus zu unterstellen, als es diese verdient.
Der Weg von diesen Beobachtungen hin zur Mehrzweckhalle, der salle polyvalente des Örtchens St. Clément auf der Insel Ré ist gar nicht so weit, wie man vielleicht glaubt. Er führt über die erfreuliche Tatsache, daß die Kinder des deutsch-französischen Paares, auch ihrerseits des Französischen mächtig, nicht nur etwa im gleichen Alter wie diejenigen aus dem Béarn und der Charente sind, sondern sich untereinander so gut verstehen, daß ohne Übertreibung von Freundschaft zwischen ihnen gesprochen werden kann. Was zu einer Tradition geführt hat, die von allen Beteiligten alljährlich mit Ungeduld erwartet und herbeigesehnt, wenn auch von den deutschen Freunden unserer Kinder nur mit befremdetem Kopfschütteln kommentiert wird, nämlich der, daß sich die Familien um den 15. August für eine Woche oder 10 Tage zu einem großen gemeinsamen Zeltgelage auf der Insel Ré treffen. Wer es irgend ermöglichen kann, nimmt daran teil, auch wenn er bereits älterer Jugendlicher oder sogar junger Erwachsener ist, in einem Alter also, in dem ein normaler Mensch kaum noch gemeinsam mit den Eltern verreisen möchte.
Die Insel Ré liegt, auf der Höhe von La Rochelle, dicht vor der Atlantikküste, und rühmt sich, das heißt natürlich, ihr Fremdenverkehrsbüro rühmt sie, diejenige Region Frankreichs zu sein, die übers Jahr hin die meisten Sonnenstunden zu verzeichnen habe. Das mag stimmen oder nicht, zutreffen tut sicherlich das Schlagwort „familienfreundlich“, mit dem außerdem geworben wird. Denn durch die 30 km lange und in ihrem vorderen, bauchigen Teil etwa 8 km breite Insel führt nur eine einzige richtige Autostraße, wenn man von den schmalen Zufahrtsstraßen zu den 8 oder 10 Ortschaften der Insel absieht. Wer sich auf der Insel aufhält, fährt mit dem Fahrrad, und zwar über das Netz zahlreicher Fahrradpisten, die zu den Stränden führen, durch Kiefernwälder, durch Weinfelder und Kartoffeläcker, und besonders malerisch durch die ausgedehnten Anlagen von Salzgewinnungsteichen. Für Salz und Kartoffeln sind die bäuerlichen Produkte der Insel nennenswert, sogar berühmt, was man leider von ihrem Wein nicht sagen kann.
Getrunken wird er freilich trotzdem.
Auch auf den Deichen, welche die Insel gegen die vom Westen her anrennende Brandung schützen, wird geradelt, ein ganz spezielles Vergnügen. Freilich schäumt das Meer hier nur selten zu bedenklichem Tosen auf, denn die Hauptrichtung der Dünung verläuft nahezu parallel zur Küste, sodaß man an den Stränden Rés kaum einmal durch hohen Wellengang beunruhigt wird. Auch deshalb sei Ré „familienfreundlich“, denn besorgte Mütter können ihre kleinen Kinder ungefährdet am Ufer plantschen lassen, und nichts, gar nichts lockt jene von Jahr zu Jahr an Menge zunehmende Bande schmuddelig bunter Kiffer und Wellenreiter an, die sämtliche anderen Atlantikküsten Frankreichs mit Hiphop, Skating, Surfing, Kiting und ihrer unbedarften Coolness verschandeln.
Noch eines weiteren Vorzugs darf sich die Bewohnerschaft der Insel rühmen, haben es ihre Verantwortlichen doch verstanden, rechtzeitig der allgegenwärtig lauernden Mafia von Immobilien- und Bauspekulanten Grenzen zu setzen. Es gibt auf Ré keine jener monströsen Hochhausblocks, die in Plattenbauweise ihre betonierte Hässlichkeit nur notdürftig mit hundertfach sich wiederholenden Freizeitbalkons kaschieren und darin Hotels und Ferienwohnungen aneinanderreihen, wie sie überall sonst in Europa die Küsten verbauen. Die Häuser auf Ré sind weiß gekalkt, ebenerdig oder allenfalls einstöckig, innerhalb der Ortschaften in engen Gassen dicht an dicht gebaut; Neubauten, die ohnehin nur wenig die Ortsränder zersiedeln, müssen in diesem Stil gehalten sein.
So schön das ist, so schwer, das muß nun leider auch gesagt werden, wiegt der Nachteil dieser Bau- und Immobiliengesetze, sowohl für die Feriengäste als auch besonders für die Rétaiser Bevölkerung: Ré ist teuer. Die Touristen können das verschmerzen, begrüßen es vielleicht sogar, denn somit ist garantiert, daß sich fast ausschließlich Angehörige gesellschaftlicher Schichten zum Urlaub auf Ré einfinden, die man in Frankreich als aisées, wenn nicht gar mit leichtem Spott als BCBG (bon chic, bon genre)bezeichnet, Repräsentanten also des – mindestens – gehobenen Mittelstandes. Für die Rétaiser Bevölkerung dagegen ist das schlimm, denn sie können ihren Haus- und Grundbesitz nur dann vererben, wenn sie die Erbschaftssteuer aufbringen können – und die wird nach dem aktuellen Wert berechnet. Wer mithin sein Haus auf Ré an Kinder oder Enkel weitergeben will, muß Millionär sein, um derartige Summen zahlen zu können. Zwar wird er Millionär, wenn er sein Haus verkauft – und das tun viele – aber Hausbesitzer sein auf der Insel heißt heute mehr und mehr, zur reichen, überwiegend aus Paris stammenden Oberschicht Frankreichs zu gehören. Was das für den eigentlich bäuerlichen Charakter der sozialen Struktur auf der Insel bedeutet, ist leicht zu sehen an der zunehmenden Anzahl brach liegender Felder. Hat auch wieder seinen Reiz, dieser Wildwuchs, der sich alsbald darauf auf den Feldern einstellt.
Während im vorderen, dem bauchigen Teil der Insel der Wohlstand von Hausbesitzern und Touristen noch wohlwollend als „nur“ gediegen genannt werden kann, steigert sich diese Gediegenheit, je mehr man dem Verlauf der Insel nach Nordwesten folgt, bis hin zum blanken Reichtum. Nach etwa 20 km verjüngt sich die Insel beim Martray auf gewissermaßen nur noch den Deich, der hier den Ozean von den landseits liegenden Salzteichen trennt. Die Insel knickt an dieser Stelle scharf nach rechts ab und verbreitert sich erneut um die Ortschaften Ars, St. Clément und Les Portes herum.
Hier wohnen die Reichen, die richtig Reichen. Sowie, oft als deren Gäste, Persönlichkeiten aus der Schlager-, Film-und Fernsehbranche, die es hier nur wenig zu befürchten haben, von zudringlichen Gaffern bedrängt, geknipst und um Autogramme angegangen zu werden. Hier ist man unter sich und seinesgleichen. Freilich, ein paar Autochthone, zwecks diverser Dienstleistungen, braucht man schon noch. Es gehören diese Reichen zumeist jener Kategorie braun gebrannter und gepflegt frisierter Herren an, die, selbst gekleidet in freizeitlichen T-Shirts und Bermudahosen, derart distinguiert sich zu bewegen wissen, als schlenderten sie elegant gewandet, mit Gleichgestellten plaudernd, während einer Opernpause durchs Foyer, das Champagnerglas in der Rechten. Im Gegensatz zu den deutschen Reichen, ihrer, wie es Joachim Kaiser einst nannte, „teigigen Wirtschaftswunderphysiognomie“, sind diese Herrschaften meist schlank, von sportlich straffer Statur und ihren markant gefalteten Gesichtszügen ist bereits kurze Zeit nach der Rasur erneut schwarzviriler Bartwuchs anzusehen. Auf Caféterrassen oder am Strand kann man hören, daß sie nicht etwa nur auf die Namen Jean oder Philippe getauft wurden, wie sonst die Franzosen, sondern auf Charles-Hubert oder Pierre-Maurice. Ihren Damen eignet, trotz aller Besuche bei Instituten zur Pflege ihres ästhetischen Erscheinungsbildes, allerdings und bedauernswerter Weise oft etwas vertrocknet Unerotisches an, etwas nahezu Zickenhaftes – auch wenn sie Églantine heißen, oder gar Marie-Paule – sodaß es nicht sehr erstaunen kann, wenn die Herren sich in eleganten Zweitwohnungen die eine oder andere Nebendame zur Befriedigung handfesterer Bedürfnisse halten. Damen, deren Auftreten, versteht sich, angesichts des familiären Erholungsklimas auf der Insel vergleichsweise im Hintergrund bleiben muß.
Daß die Kinder dieser Familien selbst am Strand so aussehen wie jene lieben Kleinen, die man von den Werbefotos der Kindermodenfirma „Petit Bâteau“ kennt, muß wohl nicht eigens erwähnt werden. Lediglich die Halbwüchsigen dieser Familien scheren etwas aus dem erwarteten Bild aus. Zerrissene Jeans und Zottelhaare im Rasta-Schnitt tragen sie, fast genau wie die Sprösslinge von Kreti und Pleti. Nun ja, la puberté, vous comprenez!?
Ein paar Einbrüche in ihr elitäres Paradies muß allerdings auch diese Gesellschaft der Reichen und Schönen, der people, wie die Presse sie nennt, „piepoll“, wie der Franzose es ausspricht, hinnehmen, nämlich die Existenz von zwei Campingplätzen, beide in der Nähe von St. Clément gelegen.
Und auf einem dieser Zeltplätze nun trifft sich jährlich um den 15. August von unserem großen Clan jeder, der Zeit und Lust dazu hat. Da werden dann unter aneinander gestellten Sonnendächern wackelige Campingtische aufgereiht, sodaß jeder der mindestens 20, manchmal gar 30 Personen mit seinem Campingstuhl oder -sessel, welche zumeist von fragwürdiger Stabilität sind, für apéro und repas seinen Platz findet. Die Speisefolge dieser Mahlzeiten kann natürlich, angesichts der nur eben behelfsmäßigen Kochgelegenheiten beim Camping, nicht jene Opulenz erreichen, die man eigentlich von einem Menü im Südwesten erwarten sollte. Das wird in Kauf genommen. Umso größer aber Bewunderung und Lob, welche den improvisatorischen Künsten unserer Köchinnen gezollt werden. Solch abendliches Menü ist gewissermaßen Höhepunkt eines jeden Tages, denn Gelächter, Gespräch und Diskussionen ersterben nie unter Zechen und Schmausen. Alles wird ausgehandelt, die Pläne für den nächsten Tag, Fragen des Fußballs, des Kinos, der Musik bis hin zu so wichtigen Grundfragen, ob nun der Katholizismus oder der Sozialismus uns menschlich weiterbringen werde. Inhaltlich wird man sich da nie einig, wohl aber im gemeinsamen Genuß dessen, was in Frankreich unter convivialité verstanden wird. Es bezeichnet dieser Begriff ein Phänomen, das mit der schunkelnden deutschen „Geselligkeit“ oder gar „Gemütlichkeit“ nur unzureichend erfaßt ist.
Zwangsläufig gereicht eine solche, sich convivial gebärdende Bande nicht immer zur Freude der jeweiligen Zeltnachbarn, aber wir übertreiben’s nicht; spätestens nach 23 Uhr wird die Tafel jeden Abend aufgehoben, und es herrscht Ruhe.
Nur am 15. August nicht. Da ziehen wir, mit umfangreicher Picknickausrüstung bepackt, auf eine im nahen Wald gelegene Dünenanhöhe, um dort zu feiern.
Der 15. August nämlich darf neben Weihnachten, Ostern und vielleicht noch dem 14. Juli, zu den allerwichtigsten Feiertagen der französischen Nation gezählt werden. Obwohl die französische Nation sich bekanntlich als konfessionslos definiert. Die Katholiken feiern an diesem Tag die Wiederkehr von Mariens Himmelfahrt. In Deutschland tun dies die Katholiken ebenfalls, aber nur in den südlichen, überwiegend katholischen Bundesländern. Den norddeutschen Protestanten dagegen gilt die Jungfrau weder als Jungfrau noch als aufgefahren gen Himmel, und deshalb müssen sie auf den Vorzug dieses hochsommerlichen arbeitsfreien Tages verzichten. Auch den Franzosen ist, genau beobachtet, das Bewusstsein sakramentaler Glaubensinhalte im Hinblick auf diesen Tag überwiegend entschwunden. So wurde eine damals 16-oder 17jährige Nichte ma Dames am Strand von deutschen, wohl norddeutsch protestantischen Jünglingen beflirtet, welche folglich des Französischen einigermaßen mächtig gewesen sein müssen, und gefragt, was es denn mit diesem 15. August auf sich habe. „Ben, chais pas!“ habe die kleine Französin mit den Achseln gezuckt, „Un armistice peut-être?“ („Weiß nicht! – Ein Waffenstillstand vielleicht?“)
Die Franzosen feiern diesen Tag als Höhepunkt und Abschluß der Feriensaison. Und sie tun dies im ganzen Land mit Feuerwerken, Kostümfesten und öffentlichen Bällen an den Stränden, in Parkanlagen und auf den Marktplätzen.
Wir, unser ganzer großer Familienclan, feiert diesen Tag auf unserer Waldlichtung. Von dort aus können wir bei beginnender Dunkelheit in allen Richtungen die bunten Glitzerbälle bewundern, die sich näher und ferner über den Baumkronen aufblähen, lange bevor ihr dumpfes Krachen und Böllern uns erreicht. Und wir brauchen unsere Feier-, Gesangs- und Gelächterlaune weder zeitlich noch hinsichtlich ihrer Lautstärke mit jener Rücksichtnahme zu begrenzen, die sonst abends unseren Zeltnachbarn geschuldet ist.
An jenem 15. August jedoch, von dem diese Geschichte erzählen will, war Anderes geplant, womit der Erzähler sich endlich der Mehrzweckhalle nähert. Unsere jungen Leute wollten diesmal tanzen. Und zwar auf dem Ball, den die Gemeinde von St. Clément in ihrer neu erbauten salle polyvalente angekündigt und vorbereitet hatte.
Es hatten deshalb unser apéro und das repas wie üblich, wenn auch etwas luxuriöser, in unserem Zeltlager stattgefunden, bevor wir mit unseren Rädern nach St. Clément aufgebrochen waren, zur salle polyvalente.
Une salle polyvalente hört sich auf Französisch nicht schöner an als ihr deutsches Pendant, die Mehrzweckhalle. Und genau so hässlich wie ihr Name klingt, sehen diese Gebäude denn auch aus. In der Regel sind es große Turnhallen aus Beton, mit flachem Dach, manchmal sogar mit Tribünen an ihren Längsseiten, alle mit einem Anbau versehen, in welchem die Geräteräume, die Sanitär- und Umkleideräume, oft sogar eine große Küche untergebracht sind. Überall in Europa wuchsen während der 70er und 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts diese grauen architektonischen Monstren an den Ortsrändern kleinerer Gemeinden und Dörfer aus den Wiesen. Und man muß sagen, frankophilerseits leider sagen, daß die bauliche Hässlichkeit einer salle polyvalente diejenige einer durchschnittlichen Mehrzweckhalle in der Regel sogar noch übertrifft, ein Phänomen, das man angesichts unserer Mehrzweckhallen kaum für möglich halten sollte.
Ein solches graues Betonungetüm gibt es nun auch in St. Clément. Nicht innerhalb des Ortes, versteht sich, oder auch nur an seinem Rande, sondern etwa 500 Meter außerhalb. Mitten im freien Feld, umgeben von bereits abgeernteten Maisfeldern, ragt es aus dem Stoppelacker auf, das heißt, wenigstens ragt es nicht, denn viel höher als die Dachgiebel des Ortes bläht sich sein flach asymmetrisch gekurvtes Dach nicht auf. Von Weitem und bei Dämmerlicht könnte man’s für einen riesigen vorzeitlichen Dolmen halten oder einen Findling aus geologischen Urzeiten. Aber sobald man genauer hinblickt, kann man der neuzeitlichen Widrigkeit des Monstrums nicht entgehen.
Wenn Architekturästheten sagen, Häuser hätten ein Gesicht, so müssten sie diesem Gebäude seine physiognomische Unverschämtheit bescheinigen. Der Himmel weiß – oder besser, er weiß es nicht – wie die Gemeinde an die Baugenehmigung gekommen sein mag. Wie auch immer, nun steht sie da, die klotzige Schachtel, und der große Ball des 15. August sollte erstmals darin stattfinden.
Nachdem wir das für Campingverhältnisse vergleichsweise erlesene Menü zu uns genommen hatten, nebst einigen ausnahmsweise gepflegteren Weinen, hatten wir, ein Cognac-, Whisky- oder Likörglas in der Hand, die Farberuptionen bestaunt, die ringsum am Nachthimmel aufplatzten und gebührend mit „Aaah!“ und „Oooh!“ kommentiert, und hatten uns dann, nachdem der letzte Funkenball erloschen war, auf den Weg gemacht. Natürlich per Fahrrad, denn unser Zeltplatz liegt doch an die 3 Kilometer von St. Clément und seiner salle polyvalente entfernt. Diese von einem Garagisten verliehenen Stahlrosse sind einfachster Bauart und verfügen weder über eine Gangschaltung noch eine Beleuchtung. Auf erstere war leicht zu verzichten, aber ohne Licht über nächtlich schwarze Pisten? Nach doch schon reichlichem Genuß animierender Getränke?
Aber unbesorgt, unser Trupp erreichte ohne größere Unfälle das freie Feld, von wo aus bereits die Scheinwerfer vom Vorplatz des Betonmonstrums für Orientierung sorgten. Schon von weitem sah man das im Rhythmus dumpfer Bässe synchrone Auf und Ab der Schattenrisse zahlreicher junger Leute. Auf dem Vorplatz des Betonhangars standen, nickten und wippten sie in kleinen und größeren Gruppen, Schwaden weißen Zigarettenrauchs über den Köpfen, viele mit weißen Plastikbechern in der Hand. Das Wummta-Bummta aus der Lautsprecheranlage dröhnte aus den weitgeöffneten Türen der Halle und durchmischte sich mit Gelächter und Stimmengewirr, immer wieder mal übertönt von unverständlichen Ansagen, welche offenbar die allgemeine Laune anheizen sollten. „Tout le monde va bien?“ brüllt der Vorturner in sein Mikrophon („Sind alle gut drauf?“), und die Menge brüllt lauthals „Ouais!“ zurück („Jaaa!“); „Je vous entends pas!“ schreit daraufhin das Mikrophon („Ich höre Euch nicht!“), und die Menge antwortet mit gesteigerter Lautstärke „Ouais!“, ein Vorgang, der beliebig oft wiederholt wird. Die Franzosen kennen diese Litanei von zahlreichen Fernsehshows, und für jedes Fest, an dem – sagen wir – mehr als 30 Personen teilnehmen, wird heutzutage so ein Zeremonienmeister engagiert, der sie „Ouais!“ brüllen lässt. Das muß sein. Ohne kollektives „Ouais!“ keine gute Laune, ergo kein gelungenes Fest.
Etwas abseits unsere Räder miteinander verschließen, Vorsicht empfiehlt sich, auch in Frankreich, und dann schlängelten wir uns durch die Gruppen der Jugendlichen auf den Eingang der Halle zu. Erwartungsvoll, denn wenn hier draußen schon solch Rummel herrschte, wie mochte dann erst drinnen die Stimmung kochen?
Ernüchterung. Grell weißes Neonlicht links vor Bühne und Theke, nach rechts hin verliert sich der kahle Raum im grauen Halbdunkel. Zwar herrscht vor der Theke noch Gedränge, Getränkenachschub in Plastikbechern wird geholt, doch in der weiten Halle gähnt Leere. Drei oder vier bunte Papiergirlanden hängen schlapp von der Betondecke herab, sind wohl dem Bestreben des Veranstalters zu danken, festlichen Frohsinn in der Halle zu erzeugen, erzielen aber leider gegenteiligen Effekt, weil sie nämlich die graue Betonwüstenei eher noch unterstreichen, deutlicher fühlbar werden lassen. Auf erhöhtem Podest hinter der Theke das Pult mit elektrischen Gerätschaften, bedient von einem nicht mehr ganz jungen Burschen, der nach verspätetem Hippie aussieht. Der sorgt für den rhythmischen Lärm, nach dessen Takt sie draußen wippen, und schreit immer mal wieder seine liturgischen Fragen ins Mikrophon. Die Mitte des riesigen Raums leer, vor den Längswänden sitzen an Biertischen einige Gruppen fortgeschrittenerer Jahrgänge, Touristen oder insulares Landvolk? Warum sie hier ihre Zeit verschwenden, fragen sie sich. Vereinzelte Bier- oder Schnapsleichen gibt es auch schon, vornüber gesunken, Kopf und Schultern auf dem Holztisch gebettet.
Unsere Jugend hatte sich bereits mit gefüllten Plastikbechern versorgt und die Tristesse dieser Tanzhalle wieder verlassen. Sie mischten sich unters Jungvolk auf dem Vorplatz. Auch wir, ma Dame und ich, hätten uns gerne sogleich wieder zurückgezogen, aber die Cousine, mit unverwüstlicher Frohnatur gesegnet, gab nicht so schnell auf. Es müsste doch getanzt werden können; wäre doch gelacht, wenn man hier nicht Stimmung hineinbrächte. Und so drehten wir ein paar hüpfende, armschlenkernde Runden auf dem Betonboden. Sogar zwei oder drei der sich in der hinteren Halle langweilenden Paare fassten Mut und folgten unserem Beispiel. Der späte Jugendliche hinterm Musikpult, blökte Beifall durchs Mikrophon. Dieser Ansporn trug jedoch unsere um Laune bemühte Tanzbereitschaft nur für kurze Zeit, dann senkte sich Ernüchterung lastend in Hirne und Glieder. Schon bald brachen wir unsere Tanzverrenkungen wieder ab und folgten unserer Jugend auf den Vorplatz hinaus.
Hier draußen, auf dem Vorplatz der Mehrzweckhalle, hatte sich inzwischen die Stimmung dramatisch verändert. Die bei unserer Ankunft noch vorherrschende, im Rhythmus wippende, unbekümmerte und gelassene Heiterkeit all der Mädchen und Jungen war bedrohlicher Anspannung gewichen. Zwei einander gegenüberstehende Gruppen strahlten Feindseligkeit, ja Wut aus. Niemand wippte mehr im Bummbumm von Baß und Schlagzeug, kein Gelächter war mehr zu hören, und statt der verworrenen Vielstimmigkeit der Festlaune lastete Schweigen über den beiden Gruppen, ein Schweigen, das nur durch einzelne, rau heisere oder schrill kreischende Schimpfworte durchbrochen wurde.Und noch ehe wir uns der veränderten Stimmungslage recht bewusst geworden waren, platzte auch schon die Spannung. Zwei Burschen, aus jeder Gruppe einer, stürmten aufeinander los und verkeilten sich unter wild rudernden Boxhieben ineinander. Beider Anhängergruppen rückten näher heran, sodaß sie einen Kreis um die Kämpfenden bildeten; statt des Schweigens füllten nun anfeuernde Schimpfworte die Luft. Weitere Schlägerpaare begannen, sich zu finden, rüsteten sich ihrerseits, tauschten erste Abtastschläge aus.
Ich hatte mich inzwischen mit raschem Blick vergewissert, daß unsere Jugend sich am Rande zurückhielt, außerhalb der feindlichen Lager, offensichtlich nicht gewillt, sich in die Schlägereien einzumischen, und begann zu überlegen, wie wir am besten zu unseren Fahrrädern gelangen könnten, ohne ins Getümmel zu geraten, als es auch schon geschah:
Noch ehe sich der Kreis um die beiden Hauptkontrahenten ganz geschlossen hatte, stürmte wer auf die Streithähne zu? Ma Dame! Laut schreiend und wild mit ihren Armen fuchtelnd rannte sie ins Gewühl und drängte sich zwischen die beiden Kämpfer. „Arrêtez!“ schrie sie, „Arrêtez! Vous êtes fous!“ („Aufhören! Ihr seid verrückt!“) Und wer meine temperamentvolle Dame kennt, weiß, in welches Extrem sie ihr gellendes Schreien steigern kann, sodaß man sich fragen muß, warum mit Stentor ausgerechnet ein Mann zum Symbol stimmlicher Gewalt werden konnte.
Bei mir indessen ereignete sich etwas, das jeder kennt, der sich einmal unvermittelt und überraschend in einer sehr hitzigen und kniffligen Situation erleben musste. Mein Hirn nämlich arbeitete und verarbeitete im minimalen Bruchteil einer Sekunde eine Fülle von Wahrnehmungen sowie die daraus folgenden Gedanken und Erwägungen. Ich sah meine Frau ins Kampfgewühl stürzen, sah ihre Gefährdung und überlegte glasklar, was für mich daraus zu folgen hatte. Niemals, nicht im Traum, hätte ich so spontan eingegriffen, wie meine Frau es tat. Sollen sie sich nur ihre Visagen polieren, dumme französische Gockel, hätte ich gedacht, was geht’s mich an? Nun aber, wie stand ich da, wenn ich ma Dame alleine ins Gefecht ziehen ließ? Konnte ich ihr, unseren Kindern und den Verwandten, auch mir selbst im Spiegel, anschließend noch in die Augen schauen? Was war schlimmer, diese Schande oder möglicherweise ein schmerzendes blaues Auge und ein paar Schrammen? Resultat dieser Gedankengänge: Keine Frage, ich musste hinterdrein, musste mich, wenn auch schweren Herzens, ebenfalls ins Getümmel stürzen.
Daran, daß alle diese Überlegung bereits abgeschlossen war, noch ehe ma Dame vollends die zwei Gockel erreicht hatte, sieht man, mit welch atemberaubendem Tempo unser Gehirn arbeiten kann, wenn’s darauf ankommt.
Der tatkräftige Einsatz ma Dames übrigens, verbunden mit ihrem wahrhaft stentorialen Geschrei, hatte die gesamte Lage blitzartig verändert. Verblüfft durch den Auftritt einer dritten Partei in Form einer rüstigen Matrone hielten die verfeindeten Gruppen inne, und die nicht wenigen weiteren Kampfpaare, die bereits ihren Schlagabtausch begonnen hatten, erstarrten buchstäblich in ihren Bewegungen, sahen ihre Impulse blockiert.
Nicht so die zwei Hauptkontrahenten, die sich schon zu intensiv in ihre Hitzigkeit verbissen hatten und um sich herum nichts mehr bemerkten. Meine Frau erwischte den ersten bei den Schultern und riß ihn zurück; ich gleich darauf den zweiten, den ich nun meinerseits abdrängte. Schon sah ich auch, nicht wenig erleichtert, wie einige der umstehenden Mädchen meiner Frau beisprangen und ihr halfen, „ihren“ Kampfhahn festzuhalten, während ich noch eine Art Ringkampf mit „meinem“ Recken ausübte. Nun darf ich mich nicht rühmen, der allersportlichste, kräftigste Mann zu sein, etwa gar über den eisenharten Griff eines Old Shatterhand zu verfügen. Dennoch wand und schlängelte sich der junge Mann vergeblich unter meinen Armen. Unbedingt wollte er sich wieder auf seinen Gegner werfen. Mir wurde – erneutes Beispiel für das hohe Wahrnehmungs- und Reflexionstempo unseres Hirns – zugleich bewusst, daß mein Jüngling gar nicht so sehr begierig auf eine Wiederaufnahme der Tätlichkeiten war, wie er tat, sondern daß er vielmehr im Grunde ganz froh war, auf diese Weise glimpflich und ohne Gesichtsverlust weiteres brutales Kräftemessen vermeiden zu können; denn eigentlich hätte es ihm ein Leichtes sein müssen, mich älteren Herrn abzuschütteln. Umso mehr allerdings glaubte er wohl, seinem Kampfesmut verbalen Ausdruck verleihen zu müssen. „Je vais le tuer, ce con!“ („Ich werde ihn töten, den Schweinehund!“) keuchte er ein übers andere Mal, während wir miteinander rangen wie Laokoon mit seinen Söhnen, nur daß deren Schlangen für uns lediglich imaginär blieben. Die Antwort, die mir auf seine Vernichtungsschwüre einfiel, gab endlich der allgemeinen Streitlust den Rest. Die Spannung unter den jungen Leuten löste sich in Gelächter auf, wonach allerdings zu befürchten steht, daß „mein“ junger Krieger den Abend nur gesegnet mit einem neuen Spitznamen überstanden haben wird. „Non!“ hatte ich nämlich zurückgeschrien, „Tu vas tuer personne! Et heureusement, andouille!“ („Nein! Du wirst niemanden töten! Und zwar zum Glück! Andouille!“).
Es muß dieses andouille gewesen sein, dieses Wort, komisch und gänzlich unerwartet aus dem Munde eines ausländischen Touristen, obendrein mit teutonischem Akzent gesprochen, das für die allgemeine Erheiterung gesorgt und der Streitlust sozusagen die Spitze gebrochen hatte.
Und was ist eine andouille? Das ist eine Art Blutwurst, eine der ländlich deftigen Spezialitäten im Nordwesten Frankreichs, ein sehr beliebtes Alltagsgericht, und vielleicht eben deshalb im bäuerlichen Umfeld auch gebraucht als liebevoll tadelnde Ermahnung, wenn sich etwa ein trotzköpfig tollpatschiges Kleinkind weh getan hat. Die Schlacht war so rasch beendet, wie sie begonnen hatte. Wir aber, wir Älteren jedenfalls, verließen alsbald den Kampfplatz, ohne uns noch weiter um die Streithähne zu kümmern. Die sahen wir in der Obhut etlicher junger Mädchen, die ermahnend und beruhigend auf sie einredeten. Unsere Jugend blieb ebenfalls am Ort des Geschehens, der Walstatt, zu der die Mehrzweckhalle, die salle polyvalente geworden war. Sie berichteten anderntags, doch noch ein sehr fröhliches Fest erlebt zu haben.
Für uns Senioren klang die Nacht auf dem stimmungsvollen Deich hinter dem Zeltplatz aus, wo wir bei dem einen oder anderen Getränk, welches die Franzosen als Bier bezeichnen, auf die Ebbewatten hinausschauten, die Sterne am Himmel und in den Wattpfützen schimmern sahen und träge darüber sinnierten, was vorgefallen war. Es bestand Einigkeit darüber, wie eindrucksvoll ma Dame in ihrer spontanen Empörung reagieren könne; was mich betraf, so blieb die Frage ungeklärt, ob ich mich als Held sehen dürfe oder nicht vielmehr als eigentlich verkappten Feigling.
Fragen in se wind
Wann wird im Kino der Fraß untersagt
von Popcorn aus knisternden Tüten?
Wann wird man, ha’m sich schon viele gefragt,
Westernhagen das Texten verbieten?
Wieviel Jahre ergibt wohl die Lebenszeit,
die Dieter Bohlen gestohlen?
Und wo ist der Mann, wehrhaft, rüstig bereit,
den hannoverschen Prinz zu versohlen?
Frag nicht, wo die Blumen sind,
wo der Schnee von gestern,
wo man 7 Brücken find,
wo den alten Western.
Se anser nämlich, mein Kind,
ise blowing in se wind,
se anser ise blowing in se wind.
Wer hat als erster prosecco bestellt,
wer vin primeur gesoffen?
Wer zahlt für Werbelogos noch Geld?
Wie oft ist Kerner betroffen?
Wer macht den Sinn, wenn es keinen gibt?
Wann rechnet das Geld sich selber?
Warum war Joschka Fischer beliebt?
Wen wählen die schlachtreifen Kälber?
Frag nicht, wo die Blumen sind,
wo der Schnee von gestern,
wie die Jahre flieh’n geschwind,
nicht nach Brüdern, Schwestern.
Se anser nämlich, mein Kind,
ise blowing in se wind,
se anser ise blowing in se wind.
Wann wurden Lohnnebenkosten erfunden?
Was braucht Herr Schrempp zum Leben?
Welche Rendite ergibt sich aus Stunden,
die Tausende lohnlos geben?
Was unterscheidet den Terroristen
mit erfolgreichen Opferquoten
vom gewinngeilen Großkonzernsprokuristen
mit zahllosen sozial Toten?
Frag nicht nach den Blumen, Kind,
nicht nach 7 Brücken.
Frag nicht, wieviel Sternlein sind,
frag nicht che sera.
Wär‘ selbst Dylan da,
säng‘ er nur aus alten Stücken.





























