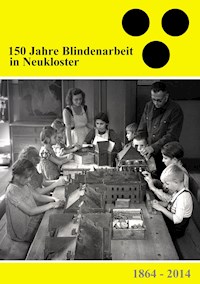29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Jura - Strafprozessrecht, Kriminologie, Strafvollzug, Note: 2, Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt Aschersleben, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Polizei schützt andere und sichert sich selbst. Dieser Grundsatz ist in Polizeidienstvorschriften verankert und bezieht sich auf die für die Polizeipraxis wichtigen, taktischen Maßnahmen der Eigensicherung und der Schutz- und Präventionsmaßnahmen. Aus kriminologisch-wissenschaftlicher Sicht stellt sich jedoch die Frage, wie der Schutz der anderen, namentlich der Bevölkerung, gewährleistet werden kann. Originär ist dabei der Punkt der vorbeugenden Verbrechensverhütung betroffen. Im Laufe der Geschichte gab es viele Theorien, Modelle und Erklärungsansätze, die aus kriminologischer Sicht Maßnahmen und Methoden der präventiven Kri-minalitätsverhütung zur Aufrechterhaltung der Sicherheit der Bevölkerung vorstellten. Dabei erschien unter anderem das Konzept einer Kriminologischen Regionalana-lyse (KRA) als geeignetes Mittel zur Erforschung der Kriminalitätsbelastung einer Kommune. Ziel dieser soll die Ableitung von Präventionsmaßnahmen zur Stär-kung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung sein. Im Kern einer KRA steht die Betrachtung des Hell- und des Dunkelfeldes von kriminellem Verhalten, wodurch die nicht-registrierte Kriminalität des Dunkelfeldes aufgedeckt werden soll. Die vorliegende Arbeit orientiert sich an dem theoriegeleiteten Aufbau einer KRA. Beginnend mit dem theoretischen Teil, welcher die geschichtliche Entwicklung der Kriminalitätsbekämpfungsansätze bis hin zur KRA und deren Aufbau darstellen soll, wird im methodischen Teil die KRA an sich behandelt. In diesem Abschnitt werden die Untersuchungsregion, die Analyse der Daten der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) und die Durchführung der Befragung thematisiert. Die Auswertung der Fragebögen wird im Kapitel Ergebnisse erfolgen. Daran schließen sich eine Zusammenfassung und ein kurzer Ausblick an
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Vorwort zur kommunalen Erwartungshaltung
Liebe Leserinnen und Leser,
Sicherheit und Ordnung sind für die Bürgerinnen und Bürger und den gesamten Staat ein hohes Gut und für die Kommunen außerdem ein wichtiger Imagefaktor. Dabei kommt es nicht nur auf die objektive Sicherheitslage an, also auf die an Zahlen und Fakten messbare Sicherheit, sondern auch auf die "gefühlte" Sicherheit der Menschen. Denn nur, wenn sich die Bürgerinnen und Bürger in der Kommune auch sicher fühlen, wird ihre Erwartungshaltung auch erfüllt. Dieses subjektive Sicherheitsgefühl ist allein vom Menschen, hier unserem Einwohner, bewertbar. Dazu wurde eine umfangreiche repräsentative Befragung der Zeitzer Einwohner durchgeführt und ausgewertet.
Die folgende Analyse, die das Revierkommissariat Zeitz gemeinsam mit der Stadt Zeitz unter Federführung von den beiden Polizeikommissaren Tom Clauß und Stefan Maywald erarbeiten konnte, soll zunächst relevante Daten und Fakten sammeln. Dabei wurde sowohl auf objektive Daten als auch auf Ergebnisse der Befragung von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Zeitz zurückgegriffen. Anhand der Resonanz auf die Durchführung dieser Analyse und der regen Beteiligung wurde schnell deutlich, dass ein Bedarf der Menschen besteht, sich mit diesem Thema intensiver auseinanderzusetzen.
Ich erwarte, dass die Analyse das vorhandene Bild über die Sicherheitslage vertieft, das Verhältnis von objektiver und subjektiver Lage wiedergibt und zu prüfende Handlungsschwerpunkte benennt.
Das Ziel der Stadt Zeitz ist es, dass die Polizei und die Ordnungsbehörden in Stadt und Landkreis noch zielgerichteter vorgehen können und ein noch besseres gemeinsames Handeln erreicht wird. Dabei sind wir auf die Mitarbeit und die Aufmerksamkeit unserer Bürgerinnen und Bürgern dringend angewiesen.
Ich bin mir sicher, dass die Analyse allen Einwohnern und allen zuständigen Behörden ein wichtiges Instrument gibt, um unser gemeinsames Ziel der Erhaltung und Verbesserung der Sicherheit und Ordnung noch effektiver zu erreichen.
Vorwort zur polizeilichen Erwartungshaltung
Was erwartet die Polizei von der KRA in der Stadt Zeitz?
Gespannt erwarten wir die Auswertung der Fragebögen und den damit geführten direkten Dialog mit den Bürgern der Stadt Zeitz. Häufig werden Missstände durch die Einwohner genau wahr genommen, Meinungen oder Feststellungen aber nur im engsten sozialen Raum getätigt, die die Verantwortlichen nicht oder nur bruchstückhaft erreichen. Wichtig sind hierbei die Erkenntnisse aus den einzelnen Stadtteilen, die Auswertung der statistischen Daten und die Entwicklung gezielter Maßnahmen, um Kriminalitätsfurcht abzubauen und die tatsächliche Kriminalitätsbelastung zu senken. Viele Probleme können nur in Zusammenarbeit von kommunalen Einrichtungen, der Polizei und weiteren Verantwortlichen einer Lösung zugeführt werden, die im Rahmen eines Sicherheitsgremiums unter Vorsitz der Stadt Zeitz koordiniert werden sollten. Hierfür bietet die KRA eine gute Datengrundlage.
Durch die zeitgleiche Erstellung von Regionalanalysen in den Städten Weißenfels und Naumburg erhoffen wir uns, dass unter Nutzung der Daten weitere Auswertungen möglich sind, die die regionalen Besonderheiten darstellen, so dass ein Gesamtbild für den Bereich des Burgenlandkreises entsteht. Auch wäre die Fortschreibung der KRA durch weitere Absolventen der FH ASL wünschenswert.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur kommunalen Erwartungshaltung
Vorwort zur polizeilichen Erwartungshaltung
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Einleitung
2 Kriminologische Regionalanalyse
2.1 Entwicklung der Kriminologischen Regionalanalyse
2.1.1 Kriminalgeographie
2.1.2 Kommunale Kriminalprävention
2.2 Aufbau einer Kriminologischen Regionalanalyse
2.2.1 Aufbau einer KRA im Allgemeinen
2.2.2 Eigener Aufbau der KRA
3 Methodik
3.1 Untersuchungsregion
3.1.1 Regionale Gliederung
3.1.2 Geschichte
3.1.3 Bebauung/Nutzung
3.1.4 Sozio-ökonomische Faktoren
3.1.5 Bevölkerungsdaten
3.1.6 Stadtbauliche Aspekte
3.2 Kriminalität
3.2.1 Registrierte Kriminalität
3.2.2 Dunkelfelduntersuchungen
3.2.3 Der Fragebogen
3.2.4 Repräsentativität der Befragung
4. Ergebnisse der Bürgerbefragung
4.1 Staatsangehörigkeit
4.2 Stadtteile
4.3 Opfer von Straftaten
4.3.1 Opfer einer Körperverletzung
4.3.2 Opfer einer gefährlichen Körperverletzung
4.3.3 Opfer einer Bedrohung
4.3.4 Opfer einer Beleidigung
4.3.5 Opfer eines Betrugs
4.3.6 Opfer eines Kraftfahrzeugdiebstahls
4.3.7 Opfer des Diebstahls eines Fahrrads
4.3.8 Sachbeschädigung des Kraftfahrzeugs
4.3.9 Opfer einer Sachbeschädigung
4.3.10 Aufgefallene Beschädigungen in der Öffentlichkeit
4.3.11 Zwischenfazit und Zusammenfassung der einzelnen Delikte
4.4 Zufriedenheit mit der Polizei in Zeitz
4.4.1 Bewertung der Polizei im Allgemeinen
4.4.2 Bewertung der Polizeiarbeit in Zeitz
4.4.3 Bewertung der Schnelligkeit der Polizei
4.4.4 Bewertung der rechtlichen Mittel der Polizei
4.4.5 Bewertung der Ausrüstung der Polizei
4.4.6 Bewertung der Anzahl des Personals der Polizei in Zeitz
4.4.7 Bewertung der Arbeitsbelastung der Polizei in Zeitz
4.4.8 Zwischenfazit
4.5 Subjektives Sicherheitsempfinden der Bevölkerung
4.5.1 Sicherheitsgefühl bei Dunkelheit im eigenen Stadtteil
4.5.2 Häufigkeit des Unterwegsseins im Dunkeln
4.5.3 Meidung bestimmter Örtlichkeiten
4.5.4 Zwischenfazit
4.6 Kriminalitätsfurcht
4.6.1 Meidung bestimmter Orte
4.6.2 Gründe für Furcht in der eigenen Wohngegend
4.6.3 Häufigkeiten von Polizeistreifen
4.6.4 Zwischenfazit
4.7 Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit in Zeitz
4.8 Zwischenfazit
5. Resümee
Literaturverzeichnis
Anlagenverzeichnis
Danksagung
Anmerkung:
Die Gliederungspunkte 1 bis einschließlich 3.2.2 und Gliederungspunkt 5 wurden von Polizeikommissar Stefan Maywald bearbeitet.
Die Gliederungspunkte 3.2.3 bis einschließlich 4.8 wurden von Polizeikommissar Tom Clauß bearbeitet.
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Flächenaufteilung
Abbildung 2: Altersstruktur Tatverdächtige
Abbildung 3: Übersicht der im Fragebogen angesprochenen Delikte
Abbildung 4: Bevölkerungsverteilung Zeitz
Abbildung 5: Bevölkerungsverteilung Bürgerbefragung
Abbildung 6: Verteilung auf die Stadtteile - Balkendiagramm
Abbildung 7: Opfer einer KV verteilt auf die Stadtteile
Abbildung 8: KV in Bezug auf Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Alter
Abbildung 9: Tatmittel der gefährlichen Körperverletzung
Abbildung 10: Gef. KV in Bezug auf Geschlecht, Staatsangehörigkeit und Alter
Abbildung 11: Beleidigung verteilt auf die Stadtteile
Abbildung 12: Beleidigung verteilt auf die Altersgruppen
Abbildung 13: Betrug verteilt auf die Stadtteile
Abbildung 14: Verteilung der Fahrraddiebstähle auf die Stadtteile
Abbildung 15: Verteilung der KFZ-Beschädigungen auf die Stadtteile
Abbildung 16: Verteilung der KFZ-Beschädigungen auf die Altersgruppen
Abbildung 17: Verteilung der Sachbeschädigungen (privat) auf die Stadtteile
Abbildung 18: Verteilung der Beschädigungen auf die Stadtteile
Abbildung 19: Verteilung der Delikte und das zugehörige Anzeigeverhalten
Abbildung 20: Verteilung der Straftaten auf die Stadtteile
Abbildung 21: Bewertung der Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft von Polizisten
Abbildung 22: Bewertung der Arbeitsleistung der Polizei in Zeitz
Abbildung 23: Bewertung der Schnelligkeit der Polizei
Abbildung 24: Bewertung der rechtlichen Mittel der Polizei
Abbildung 25: Bewertung der Ausrüstung der Polizei
Abbildung 26: Bewertung des Personalbestands der Polizei in Zeitz
Abbildung 27: Bewertung der Arbeitsbelastung der Polizei in Zeitz
Abbildung 28: Angaben zum Unterwegssein im Dunkeln im eigenen Stadtteil
Abbildung 29: Geschlechtsspezifische Aufteilung des Unterwegsseins im Dunkeln
Abbildung 30: Unterwegssein im Dunkeln bezogen auf den Rücklauf der Stadtteile
Abbildung 31: Häufigkeit des Unterwegsseins im Dunkeln
Abbildung 32: Häufigkeit des Unterwegsseins im Dunkeln nach Geschlecht
Abbildung 33: Häufigkeit des Unterwegsseins im Dunkeln nach Altersgruppen
Abbildung 34: Meidung von Örtlichkeiten nach Einbruch der Dunkelheit
Abbildung 35: Meidung von Örtlichkeiten nach Einbruch der Dunkelheit in Bezug auf das Geschlecht
Abbildung 36: Meidung von Örtlichkeiten nach Einbruch der Dunkelheit in Bezug auf den Rücklauf der Stadtteile
Abbildung 37: Gemiedene Orte in Zeitz
Abbildung 38: Meidung von Stadtteilen nach Altersgruppen
Abbildung 39: Gründe für Furcht nach erstellten Gruppen
Abbildung 40: Häufigkeit einer Polizeistreife in der Wohngegend des Befragten
Abbildung 41: Streifen bezogen auf die Stadtteile
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Altersklassifizierung der Arbeitslosen
Tabelle 2: Altersverteilung
Tabelle 3: Überregionaler Kriminalitätsvergleich
Tabelle 4: Übersicht Deliktgruppen
Tabelle 5: Zeitlicher Ablauf der Bürgerbefragung
Tabelle 6: Staatsangehörigkeit und deren Häufigkeit
Tabelle 7: Verteilung der anderen Staatsangehörigkeiten
Tabelle 8: Verteilung auf die Stadtteile
1 Einleitung
Die Polizei schützt andere und sichert sich selbst.
Dieser Grundsatz ist in Polizeidienstvorschriften verankert und bezieht sich auf die für die Polizeipraxis wichtigen, taktischen Maßnahmen der Eigensicherung und der Schutz- und Präventionsmaßnahmen.
Aus kriminologisch-wissenschaftlicher Sicht stellt sich jedoch die Frage, wie der Schutz der anderen, namentlich der Bevölkerung, gewährleistet werden kann. Originär ist dabei der Punkt der vorbeugenden Verbrechensverhütung betroffen. Im Laufe der Geschichte gab es viele Theorien, Modelle und Erklärungsansätze, die aus kriminologischer Sicht Maßnahmen und Methoden der präventiven Kriminalitätsverhütung zur Aufrechterhaltung der Sicherheit der Bevölkerung vorstellten.
Dabei erschien unter anderem das Konzept einer Kriminologischen Regionalanalyse (KRA) als geeignetes Mittel zur Erforschung der Kriminalitätsbelastung einer Kommune. Ziel dieser soll die Ableitung von Präventionsmaßnahmen zur Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung sein. Im Kern einer KRA steht die Betrachtung des Hell- und des Dunkelfeldes von kriminellem Verhalten, wodurch die nicht-registrierte Kriminalität des Dunkelfeldes aufgedeckt werden soll.[1]
Die Verfasser dieser Arbeit absolvierten im Rahmen ihres Studiums zum Polizeidienst der Laufbahngruppe II, erstes Einstiegsamt, zwei Praktika im Revierkommissariat (RK) in Zeitz. Nach Gesprächen mit der Dienststellenleiterin wurde bekannt, dass für die Stadt Zeitz noch keine derartige Analyse durchgeführt wurde. Für die Erhebung notwendiger Daten und die Entwicklung erforderlicher Maßnahmen zur Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung ist eine solche IST-Analyse von Bedeutung. Somit sollte im Rahmen dieser Diplomarbeit eine KRA, unter Betreuung der Dienststellenleiterin des RK Zeitz und eines Dozenten der Fachhochschule der Polizei des Landes Sachsen-Anhalt, erstellt werden. Auf Grund des enormen Aufwandes und einer zielgerichteten Ressourcenkalkulation, den die Erstellung einer KRA in sich birgt, soll sich diese Arbeit auf die Ersterhebung erforderlicher Daten der Untersuchungsregion und des Sicherheitsempfindens der Bevölkerung beziehen. Als konkrete Zielstellung unter Berücksichtigung der Erwartungen des Oberbürgermeisters der Stadt Zeitz und der Leiterin des RK Zeitz wurde somit die primäre Erhebung der registrierten Kriminalitätsdaten der Stadt Zeitz sowie des Kriminalitätsempfindens der Bevölkerung in Betracht gezogen. Für die Basis von Maßnahmen zur präventiven Bekämpfung von Straftaten seitens der Polizei und der Kommune sollen unter anderem die Ergebnisse dieser Untersuchung herangezogen werden.
Das Resultat der Analyse wird sich voraussichtlich zwischen zwei sinnbildlichen Polen eingliedern lassen. Einer dieser Pole wird die durch die Bevölkerung subjektiv wahrgenommene Kriminalität in einem starken Missverhältnis zu der registrierten objektiven Kriminalität seitens der Strafverfolgungsbehörden darstellen. Das starke Missverhältnis bezeichnet dabei die höhere Fallzahl der subjektiven Kriminalität im Gegensatz zur registrierten. Der andere Pol wird die Fallzahlen der subjektiven Kriminalität im gleichen Verhältnis zur objektiven darstellen. Wird ein gleiches Verhältnis festgestellt, so sollten abgeleitete Präventionsmaßnahmen auf die Verhinderung eines Anstiegs der Fallzahlen ausgerichtet werden. Zeigt sich allerdings die Tendenz eines starken Missverhältnisses, so müssen Maßnahmen getroffen werden, um die nicht erfassten Straftaten bekannt zu machen. Der Ansatz direkt am Täter und die damit verbundene Verbrechensverhütung ist sehr schwierig. Gibt die Bevölkerung allerdings Hinweise zu Plätzen, an denen zum Beispiel oft Straftaten, die erheblichen Einfluss auf das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung haben, verübt werden, so können Veränderungskonzepte dort ansetzen. Es stellt sich also die Frage, wie sicher sich die Einwohner der Stadt Zeitz fühlen, an welchen Orten sie sich besonders unsicher oder gefährdet fühlen und wie sich das Verhältnis zwischen der angezeigten und nichtangezeigten Kriminalität darstellt. Innerhalb dieser Diplomarbeit soll versucht werden, mögliche Antworten dafür aufzudecken.
Die vorliegende Arbeit orientiert sich an dem theoriegeleiteten Aufbau einer KRA. Beginnend mit dem theoretischen Teil, welcher die geschichtliche Entwicklung der Kriminalitätsbekämpfungsansätze bis hin zur KRA und deren Aufbau darstellen soll, wird im methodischen Teil die KRA an sich behandelt. In diesem Abschnitt werden die Untersuchungsregion, die Analyse der Daten der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) und die Durchführung der Befragung thematisiert. Die Auswertung der Fragebögen wird im Kapitel Ergebnisse erfolgen. Daran schließen sich eine Zusammenfassung und ein kurzer Ausblick an.[2]
2 Kriminologische Regionalanalyse
2.1 Entwicklung der Kriminologischen Regionalanalyse
Zu Beginn wird die historische Entwicklung des Präventionsinstruments KRA, unter Berücksichtigung der Themenfelder Kriminalgeographie und kommunale Kriminalprävention, dargestellt. Erst nach langwierigen Entwicklungen und der Zusammenführung von Erkenntnissen in dem Bereich der Kriminalwissenschaften, konnte das Planungsinstrument einer KRA entstehen.
2.1.1 Kriminalgeographie
Als Begründer der Kriminalgeographie oder des kriminalgeographischen Forschungsansatzes gelten der Franzose André Michel Guerry (1802 – 1866) und der Belgier Adolphe Quetelet (1796 – 1874). Guerry soll 1833 erstmalig eine Art Kriminalitätsatlas von ausgewählten Gebieten Frankreichs erstellt haben. Dieser Kriminalitätsatlas bestand aus einem Kartenmaterial, auf welchem strafbare Handlungen dargestellt wurden. Als Datenquelle dienten Guerry dabei Statistiken, welche die verübten Delikte in Frankreich zwischen 1825 und 1830 beinhalteten.
Der Grundgedanke dieses Atlasses war es, den „moralischen Zustand“ der Bevölkerung nach deren Wohnsitzaufteilung zu erforschen. Von diesen Forschungen Guerrys angeregt, befasste sich auch Quetelet mit dem Thema. Im weiteren Verlauf beschäftigten sich beide Kriminalstatistiker mit der Abhängigkeit der Kriminalitätshäufigkeit vom Raum und deren Darstellung.[3]
Auf Grundlage dieser Studien bildeten Guerry und Quetelet den Ursprung für die Kriminalgeographie, welche als Teilwissenschaftsgebiet der Kriminologie gilt. In Bezug auf die genaue Definition von Kriminalgeographie wird allerdings in die kriminalistische und die kriminologische Kriminalgeographie unterschieden. Der kriminalistische Begriff bezeichnet Untersuchungen der Beziehungen zwischen einem Raum, dessen Struktur und dem darin anfallenden kriminellen Verhalten[4]. Der kriminologische Begriff setzt sich im Gegensatz dazu mit der Entstehung von kriminellem Verhalten, in Abhängigkeit von bestimmten Faktoren der Struktur des Raumes und der Zeit, die ein Individuum umgeben, auseinander. Hans-Dieter Schwind versteht unter Kriminalgeographie die Kombination von kriminalistischer und kriminologischer Forschung. Kriminelles Verhalten wird gemessen und anhand „raumzeitliche(r)“ Einflussfaktoren, mit dem Ziel der Verbrechensbekämpfung, versucht zu erklären.[5]
Weltweite Anerkennung erhielt in dem Bereich der Kriminalgeographie der „ökologische Ansatz der Chicago-Schule“, welcher auf der „Zonentheorie“ von Burgess (1926) aufbaut.
Die US-amerikanischen Wissenschaftler Shaw und McKay erweiterten Anfang der 40er Jahre die Untersuchungen, die Burgess in der Großstadt Chicago anstellte, auf verschiedene Großstädte der USA. Angefangen von Untersuchungen über Aufenthaltsorte von als kriminell eingestuften Jugendlichen, im Alter von 16 bis 18 Jahren, ermittelten Shaw und McKay die sogenannten „delinquency areas“. Damit waren die Orte gemeint, in denen der Großteil der Delinquenten wohnte und sich aufhielt. Die „delinquency areas“ bildeten den Ausgangspunkt weiterer Forschungen. Es stellte sich die Frage nach dem Grund der Konzentration von kriminellem, also sozialabweichendem Verhalten, an bestimmten Orten. Im Unterschied zu anderen Stadtteilen wurde deutlich, dass sich nicht nur die Anzahl von Delinquenten fokussierte, sondern auch die Raten von Sterblichkeit, Geburten, Übervölkerung, staatlich unterstützten Familien und Mangel an Freizeitmöglichkeiten.[6] Die ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung in dem Untersuchungsraum war, wie sich zeigte, nicht von Bedeutung. Schlussfolgernd stellte sich die Frage, „[…] ob der Raum selbst Kriminalität hervorbring[t] […]“[7] und die „[…] Jugendlichen immer wieder kriminell infizieren […]“[8] würde oder „[…] dass der Raum Kriminelle anzuziehen vermag […]“[9]. Beobachtungen ergaben, dass in dem Areal mit der höchsten Belastung an Kriminalität, bezeichnet als sogenannte Armutsviertel einer Stadt, die Bevölkerungsgruppen mit dem geringsten Einkommen lebten und es an sozialer Kontrolle fehlte.
Im Vergleich der untersuchten Großstädte zeigte sich fortwährend die äquivalente soziale Struktur, weshalb diese ringartigen Gebiete in Zonen eingeteilt wurden. Der Stadtkern, in dem überwiegend Industrie und Gewerbe angesiedelt war, bildete Zone 1. Anschließend fügte sich das Übergangsgebiet zu den Wohnvierteln an, welches als Slumgebiet (Zone 2) bezeichnet wurde. Hier waren überwiegend Wohnblöcke zu finden, in denen die oben beschriebenen Bevölkerungsgruppen lebten. Zone 3 bildeten die Wohnviertel der Arbeiter. Die Wohngebiete des Bürgertums und der Pendler erstreckten sich abschließend auf die Zonen 4 und 5. Resultat der Studien war somit: je größer die Entfernung vom Stadtkern, desto geringer die Kriminalitätsbelastung und die Wahrscheinlichkeit der Wiederholung von strafbaren Handlungen. Zudem wurde deutlich, dass ohne die notwendige soziale Kontrolle die Kriminalität nicht sinken wird.[10]
Der „ökologische Ansatz der Chicago-Schule“ bildete die Grundlage für die „broken-window“-Theorie (nach Wilson und Kelling, 1982), woraus sich später die Null-Toleranz-Strategie[11] und die Idee der kommunalen Kriminalprävention mit kommunalen Regionalanalysen ableiteten.[12]