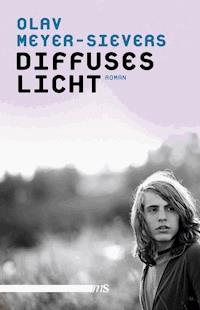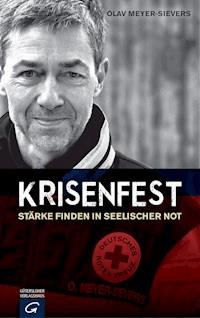
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Wie verletzte Seelen wieder Stärke finden können
Olav Meyer-Sievers ist als Notfallhelfer Zeuge erschütternder Schicksale und erster Ansprechpartner für Menschen in existenziellen Lebenskrisen. Um angesichts solchen Leids nicht selbst Schaden zu nehmen, bedarf es einer guten psychischen Widerstandsfähigkeit. Wie Olav Meyer-Sievers es schafft, seelisch im Gleichgewicht zu bleiben, verdeutlicht er in diesem Buch und gibt viele Anregungen zur Stärkung der eigenen Resilienz.
- Schicksalsschläge und Lebenskrisen bewältigen: ein Notfallhelfer erzählt aus seinem Leben
- Resilienz – innere Stärke gewinnen im Umgang mit eigenen Notlagen
- Ein Blick hinter die Kulissen der Kriseninterventionsarbeit
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 199
Ähnliche
OLAV MEYER-SIEVERS
KRISENFEST
STÄRKE FINDEN IN SEELISCHER NOT
GÜTERSLOHER VERLAGSHAUS
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.
Copyright © 2015 by Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
Coverfoto: © Sabine Vielmo
ISBN 978-3-641-16623-6V002
www.gtvh.de
INHALT
Vorwort
Extremerfahrung und Alltag
KAPITEL 1
Das erste Mal
Hilfe annehmen ist stark
KAPITEL 2
Der Großeinkauf
Dreimal um die Alster
Realitäten akzeptieren, offene Fragen aushalten
KAPITEL 3
Die letzte Tasse Kaffee
Persönlichkeit statt Oberfläche
KAPITEL 4
Chillen im Freibad
Für 100 Euro Kleingeld
Belastende Erfahrung oder Trauma?
KAPITEL 5
Picknick am Feldrand
Das Telefonat
Einfach für andere da sein
KAPITEL 6
Das Wunschkind
Begegnungen mit dem Tod
KAPITEL 7
Blaulicht, Presse, Fernsehen
Verletzungen hinterlassen Spuren
KAPITEL 8
Auslandseinsatz
Mama schläft so lange
Das persönliche Gleichgewicht halten
KAPITEL 9
Der letzte Arbeitstag
Gerahmte Vielfalt statt perfekter Konsens
KAPITEL 10
Besuch aus Spanien
Total abgebrannt
Praktische Hilfe ohne große Worte
KAPITEL 11
Schmucklos
Es bleibt so: Immer anders als erwartet
Nachwort
Mit dem Rucksack unterwegs
Anmerkungen
Danksagung
VORWORT
EXTREMERFAHRUNG UND ALLTAG
Einige Menschen setzen sich bewusst herausfordernden Situationen aus. Sie bezwingen höchste Gipfel ohne Sauerstoff, überqueren den Ozean auf einem Floß oder wandern allein durch eine Wüste. Sie versichern, dass ihnen diese Extremerfahrungen wertvolle Impulse geben, die sich positiv auf ihr alltägliches Leben auswirken. Sie finden Kraft und Selbstvertrauen, einen klaren Geist oder unerwartete Einsichten.
Auch ich setze mich regelmäßig extremen Situationen aus. Dafür begebe ich mich aber nicht auf 7.000 Meter Höhe, tauche nicht hinab in die Tiefsee oder laufe bei klirrender Kälte durch die Polarnacht. Ich sammle diese Erfahrungen in einem ganz normalen Reihenhaus am Stadtrand, auf einer Verkehrsinsel mitten im Berufsverkehr, in der Kantine eines Unternehmens. Denn ich bin beim Kriseninterventionsteam. Ich betreue Eltern, die gerade von der Polizei erfahren haben, dass ihr Sohn bei einem Gleissuizid ums Leben kam; Passanten, vor deren Augen ein kleines Mädchen mit seinem Fahrrad unter einen Lastwagen geriet; Mitarbeiter, deren Kollege von einer umstürzenden Schwerlast erschlagen wurde. Das mache ich freiwillig, ehrenamtlich, in meiner Freizeit. Warum?
Es geht beim Kriseninterventionsteam – kurz KIT genannt – natürlich nicht um den Kick, den ein Fallschirmspringer erlebt, wenn er auf die Erde zusaust, oder um die Überwindung der eigenen Grenzen in einer lebensfeindlichen Umgebung. Der Weg, der mich zum KIT brachte, führte allerdings auch durch unwegsames Terrain. Im übertragenen Sinn. Ich wurde in meinem Leben mit Krisen konfrontiert, die mich fast aus der Bahn fliegen ließen. Es gab Ereignisse, die meiner Seele so zusetzten, dass ich nicht mehr wusste, ob ich wieder Kraft und Lebenslust finden würde.
Doch das ist mir gelungen. Weil ich gelernt habe, dass es gut ist, sich den Themen zu stellen, die einen belasten. Und schlecht ist, Negatives zu verdrängen. Dann nämlich kann sich in den Tiefen der Seele eine bedrohliche Kraft entfalten und womöglich ganz das Ruder übernehmen – gegensteuern wird so immer schwieriger.
Die dunkle Macht, die ich zunächst verdrängen wollte, war: der Tod. Er war in mein Leben geplatzt, als ich 17 Jahre alt war. Meine Mutter hatte sich das Leben genommen. Ich versuchte, dieses tragische Ereignis einfach abzuhaken; einen Schnitt zu machen; nicht mehr daran oder an die Zeit davor zu denken. Ich wollte so tun, als wäre nichts geschehen und den Verlust einfach ignorieren. Doch das hat nicht funktioniert. Stattdessen geriet ich aus dem Gleichgewicht, konnte keine Perspektiven entwickeln, lebte ein Leben, mit dem ich mich nicht verbunden fühlte. Hätte ich diesem Leben eine Farbe zuordnen müssen, ich hätte Grau gewählt.
Als ich Jahre später wieder mit dem Suizid eines geliebten Menschen konfrontiert wurde, wollte ich anders damit umgehen – ohne Verdrängung. Ganz konkret: Ich wollte dem Tod ins Gesicht schauen, ihn und seine Auswirkungen besser kennenlernen. Ich sagte mir: »Okay, der Tod gehört zu meinem Leben.« Und es zeigte sich: Der aktive Umgang mit dem Verlust war konstruktiv. Ich suchte nach Wegen aus der Krise und fand Stärken, die sich auf mein weiteres Leben positiv auswirkten. Ein wichtiger Schritt dabei war, Hilfe von außen anzunehmen. Jahre später konnte ich einige der Kompetenzen, die ich zunächst zur eigenen Stabilisierung erworben hatte, auch für andere Menschen hilfreich einbringen.
Ich begann, nebenberuflich als nicht konfessioneller Trauerredner zu arbeiten. Merkte, dass ich keine Berührungsängste mit trauernden Menschen hatte. Entdeckte, dass es mir gelang, die Themen zu finden und die Gefühle zu formulieren, die die Hinterbliebenen bewegten. Zu meinem Erstaunen war das gar nicht so weit entfernt von meinem hauptberuflichen Schwerpunkt. Auch als Kommunikationsberater für Unternehmen musste ich mich in deren Themen und Strukturen einarbeiten und nach Wegen suchen, wie man die Menschen in ihrem Umfeld am besten erreicht. Und ebenso wie in familiären Netzwerken gibt es natürlich auch in Unternehmen Konflikte und Widersprüche, bei denen es zu vermitteln gilt. Nicht nur im Krisenfall, auch bei den ganz normalen Herausforderungen des Alltags.
Dann hörte ich erstmals vom Kriseninterventionsteam. Ach, dachte ich, das sind wohl diejenigen, die nach Erdbeben oder Tsunamis in fernen Ländern humanitäre Hilfe leisten. Dass es auch hier bei uns Krisenteams gibt, die Menschen bei seelischen Erschütterungen zur Seite stehen, wusste ich nicht. Ich fragte mich: Wie wäre es wohl gewesen, wenn ich als Siebzehnjähriger nach dem Tod meiner Mutter Unterstützung durch Krisenhelfer bekommen hätte? Es gab sie damals noch nicht. Diese Hilfssysteme entstanden erst viel später, nachdem man erkannt hatte, dass seelische Verletzungen ebenso einer Versorgung bedürfen wie körperliche. Erste Hilfe für die Seele. Ich wurde neugierig auf das KIT. Wer macht da mit? Psychologen? Sanitäter? Ärzte? Ich erfuhr, dass im Prinzip jeder mitwirken kann, der für diese Arbeit geeignet ist und eine spezielle Schulung absolviert hat.
Mein Interesse wuchs. Doch: Wäre ich geeignet? Wäre ich der Herausforderung gewachsen, Menschen in seelischen Extremsituationen erste Hilfe zu leisten? Ich bewarb mich beim KIT, durchlief die Ausbildung und stellte mich dem Praxistest.
Seit vielen Jahren werde ich nun regelmäßig von der Polizei alarmiert, um Menschen in den vielleicht schlimmsten Stunden ihres Lebens zur Seite zu stehen. Ich mache diese ehrenamtliche Arbeit gern. Sie ist sinnvoll und gibt auch mir viel für mein alltägliches Leben: Gelassenheit, die Dinge so anzunehmen, wie sie nun mal sind – Flexibilität im Umgang mit außergewöhnlichen Herausforderungen und eine bessere Akzeptanz der eigenen Grenzen. Bei meinen Extremerfahrungen im Alltag einer Großstadt geht es also definitiv nicht um das Überschreiten menschlicher Leistungsgrenzen, sondern um einen achtsamen Umgang damit. Der Extremsportler sucht persönliche Grenzerfahrungen, die weit außerhalb seines Alltags liegen – der Krisenhelfer unterstützt andere dabei, nach schicksalhaften Grenzverletzungen wieder zu Alltäglichkeit zurückzufinden.
Mit diesem Buch möchte ich allen, die auf ihrem Lebensweg mit kleinen oder großen Krisen konfrontiert sind, Mut machen, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Was ist, das ist. Der erste Schritt in eine bessere Zukunft beginnt immer genau dort, wo wir gerade stehen. Möglicherweise mitten im seelischen Chaos.
Ich werde Ihnen von meinen Einsätzen beim Kriseninterventionsteam erzählen. Wir werden der Fünfjährigen begegnen, die morgens vergeblich versucht, ihre Mutter zu wecken; dem Rentner, der nach einem Glas Rotwein im Sonnenschein nicht zu seiner Frau zurückkehrt; der jungen Familie, die sich fragt, wie es denn ohne Papa überhaupt weitergehen kann. Und weiteren Menschen, die von Schicksalsschlägen hart getroffen wurden. Um die Privatsphäre der Betroffenen zu schützen, werde ich keinen meiner Einsätze eins zu eins wiedergeben, sondern Namen, Orte und Geschehnisse verfremden. Denn natürlich unterliegen wir beim KIT der Schweigepflicht.
Jeder Mensch, der mit einem erschütternden Drama konfrontiert ist, muss seinen individuellen Weg finden, das Geschehene in sein Leben zu integrieren. Neue Stärke zu finden in seelischer Not beginnt mit einem Suchprozess. Ich habe erfahren, dass es auf diesem Weg durchaus einige Eckpfeiler gibt, die Orientierungshilfe bieten können. Und ich bin mir sicher, dass das, was bei dramatischen Ereignissen hilfreich ist, auch bei der Bewältigung der kleineren Verwerfungen des Alltags nützlich sein kann.
Dieses Buch ist kein Ratgeber nach dem Motto: »Für immer seelisch stark in zehn einfachen Schritten«, sondern beruht auf meinen ganz persönlichen Erfahrungen beim KIT und auf meinem eigenen Lebensweg. Ich habe gelernt, dass schmerzhafte Verluste oder belastende Erfahrungen nicht dafür sorgen müssen, dass sich ein düsterer Schleier über das gesamte Leben legt. Das Traurige existiert neben dem Schönen, dem Fröhlichen, dem Guten. Leben sollte bunt sein und nicht grau in grau. Oder eben: bunt mit grauen Flecken.
So weit, so gut.
Genau drei Tage bevor der Startschuss zu diesem Buch fallen sollte, starb meine kleine Enkeltochter Nahla im Alter von sieben Monaten. Gemeinsam mit meinem Sohn und meiner Schwiegertochter erlebte ich die traurigsten Momente meines Lebens. Und nun sollte ich ein Buch schreiben, bei dem es um Lebenskrisen und seelische Stärke gehen sollte?
Das geht ja gar nicht, war mein erster Gedanke, ich muss sofort absagen.
Nach einiger Zeit merkte ich, dass sich trotz großer Trauer kein dunkler Schleier über alles legte; dass ich mich trotz des großen Schmerzes über schöne Dinge freuen konnte; dass sich trotz der belastenden Sorgen um meine Familie keine Perspektivlosigkeit breitmachte. Zu den bunten Farben meines Lebens waren neue, tiefschwarze Flecken hinzugekommen. Wäre mir dieses Drama früher begegnet, hätte es mich in grauem Nebel versinken lassen. Aber bunt blieb bunt. Hell mit dunklen Flecken. Kein grau in grau. So schmerzhaft diese Erfahrung auch war und noch immer ist, sie bewies mir: Ich habe auf meinem Lebensweg tatsächlich etwas gelernt.
Und genau deshalb schreibe ich dieses Buch.
KAPITEL 1
Das erste Mal
Ein Mittwochvormittag im Jahr 2006. Mein Handy klingelt. Schon am Klingelton höre ich: Es ist das KIT.
»Hallo, Olav, wir haben einen Einsatz. Ist was Größeres!«
Mein Herz schlug schon schneller, als das Handy läutete. Nun pocht es heftig. Mein erster Einsatz und gleich etwas Größeres?
Die Kollegin spricht weiter: »Ein kleines Mädchen ist in der Schule zusammengebrochen, mitten im Unterricht. Alle Kinder sind geschockt, die ganze Schule ist in Aufruhr. «
»Ist die Kleine denn tot?«, frage ich mit unsicherer Stimme.
»Wir wissen noch nichts Genaues. Aber nun mach mal. Wir müssen! Hol mich ab! Fix!«
Ich versuche, mich blitzschnell startbereit zu machen. Während ich die Rotkreuzjacke anziehe, verheddere ich mich in den Ärmeln. Noch mal ausziehen. Zweiter Anlauf. Endlich klappt’s. Dann: Wo ist meine Brieftasche? Und der Autoschlüssel? Linke Jackentasche? Nein. Rechte? Auch nicht. Doch links? – Er liegt auf dem Schreibtisch.
Meine Hände zittern. Mit dem roten Betreuungsrucksack auf den Schultern renne ich die Treppe hinunter. Eigentlich war ich schon seit gestern Abend nervöser als sonst, denn um 19.00 Uhr hatte mein erster Bereitschaftsdienst begonnen. Was mich wohl erwarten würde? Ob überhaupt ein Einsatz käme? Und wenn: Würde ich damit zurechtkommen? Nun ist es so weit.
Jetzt aber los!
Mist, der Rotkreuzwagen parkt weit entfernt. Parkplätze sind in meinem Stadtteil Mangelware. KIT-Kollegin Silke wartet bestimmt schon. Endlich bin ich am Wagen. Mir fällt der Autoschlüssel runter. Ich bücke mich, der Rucksack rutscht von der Schulter. Ich fluche.
Als ich den Wagen starte, schlottern meine Knie. Eigentlich dürfte ich in diesem Zustand gar nicht fahren. Auf dem Weg zu meiner Kollegin geht mein Puls etwas nach unten. Gott sei Dank ist Silke schon sehr erfahren. Das wird schon, das wird schon. Silke lässt mich bestimmt nicht hängen.
Sie steht bereits am Straßenrand, steigt schnell ein und versorgt mich mit knappen Informationen.
»Wir müssen nach Wandsbek. Die Polizei wartet auf uns und wird uns einweisen. Ich habe noch zwei KIT-Kolleginnen zur Verstärkung alarmiert.«
»Was ist denn nun mit dem Mädchen?«, frage ich. Aus der Ausbildung weiß ich, dass das KIT meist bei Todesfällen alarmiert wird. Silke schaut auf ihre Notizen. Die Kleine heißt Malia, ist acht Jahre alt. Die Familie kommt aus Nigeria. Rettungsdienst und Notarzt waren da und haben das Kind mitgenommen.
Vor der Schule stehen mehrere Polizeiwagen. Die Auffahrt ist mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. Als wir vorfahren, hebt eine Polizistin das Absperrband an und lässt uns durch.
Ein Beamter erklärt uns, dass Malia nach jetzigem Ermittlungsstand kurz vor Beginn der Schulstunde kollabiert ist. Die Lehrerin war noch nicht im Raum, aber alle Mitschüler haben den Zusammenbruch miterlebt. Ein Schüler behaupte voller Scham, er sei schuld. Es müsse also geklärt werden, ob Fremdverschulden vorliege. Bei Kindern und Lehrern herrscht große Sorge und helle Aufregung.
Wir werden zum Grundschultrakt geführt. Auf dem Schulhof wimmelt es von Kindern. »Ist Malia tot?«, fragt uns ein kleiner Junge. »Die ist bestimmt im Himmel«, sagt ein Mädchen mit Pferdeschwanz.
»Wir müssen erst rauskriegen, was mit Malia passiert ist«, antwortet Silke. »Wenn wir wissen, wie es ihr geht, bekommt ihr alle Bescheid.«
Vor dem Grundschulgebäude warten schon unsere beiden Kolleginnen Ruth und Karin. Silke teilt uns auf: Eine KIT-Kollegin begleitet die Polizisten zu dem Jungen, der sich für das Drama verantwortlich fühlt, und wird später den Schulleiter beraten. Silke, Ruth und ich gehen gemeinsam in die Klasse des betroffenen Mädchens. Wir werden gleich umringt und mit Fragen überschüttet. Die Lehrerin sorgt für Ruhe. Silke vereinbart mit der Lehrerin eine Gesprächsrunde mit allen Kindern, um festzustellen, welche Kinder besonders belastet sind und wie wir am besten helfen können.
Meine Aufgabe ist es, in Erfahrung zu bringen, wie es Malia geht. Ich werde in die Kinderklinik fahren. Auf dem Weg zum Wagen wird mir klar, dass ich nun auf mich allein gestellt bin. Welche Nachricht wird mich dort erwarten?
Auch wenn mich die Frage nach dem Zustand des Kindes beunruhigt, so merke ich auf der Fahrt doch, dass ich nicht mehr so nervös bin wie vorhin. Ich habe eine klare Aufgabe. Als ich die Notaufnahme des Kinderkrankenhauses betrete und nach Malia frage, klopft aber doch mein Herz.
Ich werde gebeten, in der Wartezone Platz zu nehmen. Doch zum Sitzen bin ich zu unruhig, ich gehe stattdessen auf und ab.
Ein Arzt im weißen Kittel erscheint. Auf der Brusttasche mit dem Stethoskop lese ich »Dr. Mühlhaupt«. Er begrüßt mich mit Handschlag. Ich denke: Jetzt bitte keine schlechten Nachrichten!
»Malia geht es den Umständen entsprechend gut. Sie hatte einen Krampfanfall. Wir werden die kleine Dame noch in Ruhe untersuchen und dann entscheiden, wann sie wieder nach Hause kann.«
»Ein Junge hat sie geschubst. Kann das den Anfall ausgelöst haben?«
»Nein, da besteht ganz sicher kein Zusammenhang.«
»Danke, dann informiere ich gleich die Schule. Das wird alle beruhigen.«
Der Arzt nickt. »Wenn noch etwas ist: Sie finden mich auf der Station.«
Ich rufe sofort Silke an. »Prima!«, reagiert sie erleichtert, »das gebe ich gleich weiter an alle. Und Fabian, der Schubser, ist auch entlastet. Das ist gut.«
»Soll ich wieder zurück in die Schule kommen?«, frage ich.
»Nein, bleib bitte noch in der Klinik. Der Vater von Malia müsste demnächst dort eintreffen. Den kannst du vielleicht beruhigen.«
Also setze ich mich zum Warten auf eine blaue Metallbank.
Knapp zehn Minuten später trifft Malias Vater ein, sichtlich aufgeregt. Ich gehe sofort auf ihn zu. Ob ich jetzt mein Schulenglisch aktivieren muss?
»Was ist mit meiner Tochter?«, fragt er in perfektem Deutsch.
»Es geht ihr gut. Sie hatte einen Krampfanfall.«
Ich erzähle ihm, was in der Schule vorgefallen ist.
»Dann nehme ich Malia jetzt mit«, sagt Herr Anyoha.
»Das ist zu früh. Es müssen noch einige Untersuchungen durchgeführt werden.«
»Nein, das ist nicht nötig.«
»Doch, der Arzt sagte vorhin …«
Herr Anyoha schüttelt entschieden den Kopf: »Nein, Malia soll jetzt nach Hause.«
Ich bin verwirrt. »Ich hole wohl besser mal den Arzt«, schlage ich vor.
Herr Anyoha ist einverstanden.
Auf der Station erfahre ich, dass Dr. Mühlhaupt gerade im OP ist. Wir müssen warten. Während der Wartezeit unterhalte ich mich mit Herrn Anyoha. Er ist Physiker und lebt mit seiner Frau und seiner Tochter seit acht Jahren in Deutschland. Und dann erklärt er mir, warum er mit Malia sofort nach Hause möchte.
»Ihre Mediziner können meiner Tochter nicht helfen. Wissen Sie: Es gibt in Afrika eine Familie, die uns feindlich gesonnen ist. Seit mehreren Generationen. Immer wieder werden Flüche gegen uns ausgesprochen. Jetzt wurde Malia verhext. Deshalb ist sie in der Schule umgefallen.«
Ich bin baff. Ein Physiker, der an Zauberei glaubt?
Herr Anyoha bemerkt meine erstaunte Miene.
»Sie glauben nicht an Hexerei, oder?«, fragt er mich.
»Eher nicht«, sage ich vorsichtig.
»Ich bin zwar Naturwissenschaftler, aber auch die Wissenschaft durchdringt längst nicht alles, was es auf der Welt an Wundern und Rätseln gibt. Vielleicht sind wir in Afrika einigen Kräften noch näher als Sie hier in Europa. Jedenfalls braucht meine Tochter keinen Arzt. Können Sie bitte noch mal nach dem Doktor schauen und sagen, dass ich meine Tochter jetzt mitnehmen möchte?«
Ich nicke und gehe durch die Glastür in Richtung Station. Dr. Mühlhaupt kommt mir entgegen und sagt mir, dass der Vater nun zu seiner Tochter könne.
Ich kläre ihn kurz auf, dass Malias Vater keine weiteren Untersuchungen möchte und behaupte, seine Tochter sei verhext.
Der Arzt ist sichtlich irritiert.
»… und er hält deshalb nichts von medizinischen Maßnahmen«, fahre ich fort. »Ist es denn sinnvoll, wenn er die Kleine jetzt mitnimmt?«
»Aus ärztlicher Sicht nicht. Wir sollten sie schon gründlich untersuchen, um ihre Disposition zu Krampfanfällen hinreichend zu klären und den Eltern therapeutische oder prophylaktische Maßnahmen empfehlen zu können. Zwei, drei Tage sollte sie bei uns bleiben.«
»Und wenn er Malia trotzdem mitnimmt?«
»Dann trägt der Vater die Verantwortung. Das muss selbstverständlich auch schriftlich dokumentiert werden.«
Ich gehe zurück zu Herrn Anyoha. Gern würde ich ihn davon überzeugen, Malia noch im Krankenhaus zu lassen. Ich will mich aber auch nicht besserwisserisch über seine Sichtweise erheben …
»Sie haben vorhin selbst gesagt, dass es in Europa nicht so viele Fachleute für Zauberei gibt. Auch ich bin da ganz unerfahren. Aber ich will mir nicht anmaßen zu behaupten, dass es das nicht gibt. Dennoch möchte ich Sie bitten, Ihre Tochter noch ein paar Tage hierzulassen. Die Ärzte werden Ihrer Tochter sicher nicht schaden. Sie können Ihr Kind sogar gesundheitlich stärken. Vielleicht kann sie dadurch der Wirkung von Flüchen mehr entgegenstellen? Dann müssten Sie sich zukünftig weniger Sorgen um Malia machen. Und Malias Schulfreunde wären auch beruhigter, wenn sie hörten, dass sie hier gepflegt wird.«
Herr Anyoha ist skeptisch, und ich suche weiter nach guten Argumenten.
»Wenn die Kinder an der Schule hören, dass die Ärzte nicht helfen können, weil Malia verhext ist, haben sie möglicherweise Angst. Das könnten wir verhindern, wenn sie hierbliebe.«
Mein Gegenüber bleibt skeptisch.
In diesem Moment öffnet sich die elektrische Eingangstür, und meine Kollegin kommt herein. In der Hand trägt sie einen wirren Papierstapel.
Nachdem ich die beiden vorgestellt habe, zeigt Silke uns Bilder, die die Kinder für Malia gemalt haben.
Sie überreicht Herrn Anyoha die Bögen. Darauf sind bunte Blumen zu sehen, leuchtende Sonnenstrahlen, spielende Kinder. Man kann »Gute Beserung« lesen und »kom balt wieder« oder »Wir vermisen dich«.
»Wollen wir Malia die Bilder bringen?«, fragt Silke.
Herr Anyoha nickt, und wir machen uns auf den Weg zur Station. Malia liegt auf Zimmer 3. Sie ist wach und freut sich, ihren Vater zu sehen. An ihren Krampfanfall kann sie sich nicht erinnern. Aber die Krankenschwester hat ihr erzählt, was passiert ist. Silke drückt ihr die Bilder in die Hand.
Malia strahlt.
»Die können wir hier im Zimmer aufhängen«, schlägt Silke vor, »du wirst ja sicher noch ein paar Tage hierbleiben.«
»Muss ich denn hierbleiben?«, fragt Malia ihren Papa.
»Ja, kleine Maus, aber nur für ein paar Tage.«
Dann nimmt er seine Tochter in den Arm.
HILFE ANNEHMEN IST STARK
Während meiner KIT-Ausbildung hatte ich vieles gelernt, zum Beispiel über Schocksymptome, akute Belastungsreaktionen und Traumafolgestörungen. Wichtiges theoretisches Wissen, das sich in der Praxis bewähren sollte. Doch interkontinentale Flüche, Voodoozauber oder Hexerei waren in der Ausbildung nicht vorgekommen. Dennoch habe ich bei meinem ersten Einsatz etwas erfahren, das bei allen weiteren gelten sollte: Ganz gleich, welche Informationen man bei der Alarmierung erhält – welche Aufgaben tatsächlich auf einen warten, weiß man nie.
Und noch etwas: Was man als belastend empfindet, ist relativ. Malias Zusammenbruch war vergleichsweise harmlos, aber ihre kleinen Mitschüler standen mächtig unter Schock. Insbesondere Fabian fühlte große Angst und Scham, weil er seinen Schubser für den Auslöser hielt. Ich lernte also, dass es nicht hilft, nur auf Fakten zu schauen, sondern wichtig ist, die unterschiedlichen Perspektiven der Betroffenen wahrzunehmen. Und ernst zu nehmen. Ein oberflächliches »Ist doch nicht so schlimm!« hilft nicht weiter und ist sogar eher kontraproduktiv.
Ich sollte später noch viele Einsätze erleben, bei denen rein faktisch gesehen niemand körperlich zu Schaden gekommen war, aber zum Beispiel die Pistole eines Bankräubers an der Schläfe gespürt hatte oder den Ausruf eines Täters »Wenn du die Polizei rufst, komm ich wieder und stech dich ab!« nicht vergessen konnte. Angst ist auch dann belastend, wenn im Endeffekt »nichts passiert« ist. Und umgekehrt kann die Fantasievorstellung dessen, was geschehen war oder möglicherweise noch geschehen würde, grauenvoller sein als das Wissen um die Fakten. Und Schuldfragen können auch dann sehr belastend sein, wenn ein Außenstehender sie völlig grundlos findet.
Mein erster KIT-Einsatz hatte ein Happy End. Das war untypisch. Gleich bei meinem zweiten waren beim Absturz eines Kleinflugzeugs mehrere Menschen gestorben oder schwer verletzt worden. Es gab viele betroffene Angehörige und zahlreiche Augenzeugen. Für mich als Anfänger eine chaotische Situation, in der ich mich selbst eher hilf- und ratlos als nützlich fühlte. Aber da waren ja die erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, die Orientierung gaben. Auch das habe ich früh gelernt: Man muss nicht alles selber können und wissen. Das ist völlig okay – und dann ist es gut, sich anderen anzuvertrauen und Rat, Hilfe und Unterstützung anzunehmen. Das gilt nicht nur beim KIT. Teamwork kann sogar spontan funktionieren, auch außerhalb geregelter Strukturen.
Vielen Menschen fällt es schwer, Hilfe anzunehmen oder gar darum zu bitten. Auch mir ging es lange so. Um Hilfe zu bitten bedeutet Schwäche einzugestehen. Helfen ließ man sich erst, wenn es gar nicht mehr anders ging. Eine familiäre Botschaft, die tief verankert war. Heute bin ich froh, dass ich diesen Anker lösen konnte. Ich finde es nicht nur schön, anderen helfen zu dürfen, ich lasse mir auch gern helfen. Vom Einzelkämpfer zum Teamworker. Nicht nur in Krisen. Es macht auch sonst viel mehr Spaß, zusammen mit anderen Aufgaben zu lösen oder Ideen zu finden, als sich allein durchzubeißen. Und: Sind gemeinsam gefundene Lösungen nicht oft die besseren? Weil sie mehrere Perspektiven berücksichtigen?
Wenn wir beim KIT Erste Hilfe für die Seele leisten, geht es nicht anders, als gemeinsam mit den Betroffenen nach sinnvollen Schritten zu suchen. Wir bringen unser Knowhow und unsere Erfahrung ein – doch über das individuelle Leiden der Betroffenen wissen wir erst mal nichts. Unser Wissen wäre wertlos ohne Offenheit für die Perspektive des anderen und achtsame Flexibilität im Umgang damit.
Nach mittlerweile neun Jahren beim Kriseninterventionsteam schlottern mir nicht mehr die Knie, wenn ich alarmiert werde. Aber etwas schneller klopft mein Herz noch immer. Denn ich weiß: Kein Einsatz ist wie der andere. Immer geht es um Menschen und ihr persönliches Schicksal. Und genauso, wie diese Menschen unsere Hilfe annehmen, lasse ich mir von den Kollegen helfen, wenn ich im Einsatz nicht mehr weiter weiß. Denn: Hilfe anzunehmen ist kein Zeichen von Schwäche, sondern eine starke Entscheidung!
KAPITEL 2
Der Großeinkauf
Freitagnachmittag. Ich habe Bereitschaftsdienst. Das ist mittlerweile Routine. Um 16.14 Uhr kommt eine Alarmierung von der Leitstelle: »Tödlicher Verkehrsunfall in Lokstedt. Die Polizei fordert Sie an. Überbringung der Todesnachricht an den Ehemann.«
Ich rufe das zuständige Polizeikommissariat an und erfahre: »Eine Radfahrerin wurde von einem LKW erfasst. Sie verstarb noch am Unfallort. Ehemann und Tochter müssen benachrichtigt werden.« Sofort telefoniere ich mit der KIT-Kollegin, die mit mir zusammen Dienst hat: »Marianne, wir müssen los. Wir treffen uns auf dem Kommissariat.«