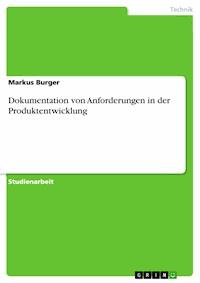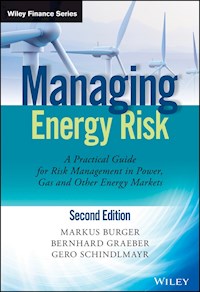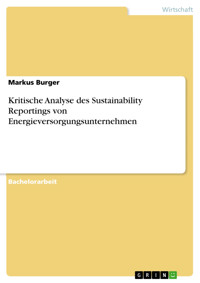
Kritische Analyse des Sustainability Reportings von Energieversorgungsunternehmen E-Book
Markus Burger
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Controlling, Note: 1,0, Technische Universität Darmstadt (Fachgebiet für Rechnungswesen, Controlling und Wirtschaftsprüfung), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit gibt zunächst eine kurze Einführung zur Nachhaltigkeit im Allgemein. Im dritten Kapitel erfolgt eine Beschreibung der Branche der Energieversorger. Das vierte Kapitel befasst sich mit dem eigentlichen Sustainability Reporting. Darauf aufbauend werden die Vorgehensweise und die Inhalte der durchgeführten Untersuchung dargestellt. Abschließend werden die Ergebnisse aufgezeigt und ein Fazit zur durchgeführten Untersuchung gezogen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Eidesstattliche Erklärung
Ich versichere an Eides statt durch meine Unterschrift, dass ich die vorstehende Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe angefertigt und alle Stellen, die ich wörtlich oder annähernd wörtlich aus Veröffentlichungen entnommen habe, als solche kenntlich gemacht habe, mich auch keiner als der angegebenen Literatur oder sonstiger Hilfsmittel bedient habe. Die Arbeit hat in dieser oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen.
Darmstadt, den 04. Oktober 2011
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Formelverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Sustainability
2.1 Historische Entwicklung der Nachhaltigkeit
2.2 Weitere Modelle unternehmerischer Verantwortung
2.3 Modell der Nachhaltigkeit im Unternehmenskontext
2.3.1 Grundgedanke der Nachhaltigkeit
2.3.2. Weiterentwicklung des Drei-Säulen-Modells
2.3.3 Bedeutung der Kernbereiche der Nachhaltigkeit
2.4. Zwischenfazit zur Nachhaltigkeit
3 Branche der Energieversorgungsunternehmen
3.1. Energiewirtschaft und Energieversorgung
3.2. Energieversorgung in Zahlen
3.3. Verantwortung und Herausforderungen von Energieversorgern
4 Sustainability Reporting
4.1. Grundlagen der Nachhaltigkeitsberichterstattung
4.2. Ursachen und Wirkungen des Sustainability Reportings
4.3. Gegenwärtige und zukünftige Anwendung von Sustainability Reporting
4.4. Richtlinien der GRI zum Sustainability Reporting
4.4.1. Praxisrelevanz der GRI
4.4.2. Berichtserstattungsgrundsätze der GRI
4.4.3. GRI- Standardangaben
4.4.4. Electric Utilities Sector Supplement
5. Analytische Vorgehensweise
5.1. Datengrundlage der Analyse
5.2. Auswahl der berichtenden Unternehmen
5.3. Analyse der Nachhaltigkeitsberichte
5.3.1 Indikatoren zur Unternehmensdarstellung und formalen Aspekten
5.3.2 Ökonomische Indikatoren
5.3.3 Ökologische Indikatoren
5.3.4 Soziale Indikatoren
5.4 Bewertung und Gewichtung
6. Ergebnisse der Analyse
6.1 Häufigkeit der Berichte
6.2. Auswertung der Printberichte
6.2.1. Printberichte der großen Unternehmen
6.2.2. Printberichte der mittelgroßen Unternehmen
6.2.3. Weitere Ergebnisse
6.3. Auswertung der Onlineberichte
7. Fazit
Anhang
Anhang 1: Stichprobe der Energieversorgungsunternehmen
Anhang 2: Indikatorkatalog Kennziffer I
Anhang 3: Indikatorkatalog Kennziffer II
Anhang 4: Indikatorkatalog Kennziffer III
Anhang 5: Indikatorkatalog Kennziffer IV
Anhang 6: Erreichte Punkte Printberichte
Anhang 7: Erreichte Punkte Onlineberichte
Anhang 8: Zuordnung der Kriterien von Quick
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Entwicklung der Nachhaltigkeitsmodelle
Abbildung 2: Stakeholdermatrix
Abbildung 3: Nachhaltigkeitsrad
Abbildung 4: Wertschöpfungskette der Energieversorgung
Abbildung 5: Energieverbrauch, Wirtschaftswachstum und Energieproduktivität
Abbildung 6: Entwicklung des Primärenergieverbrauchs
Abbildung 7: Verbreitung der GRI Richtlinien
Abbildung 8: Schematische Aufteilung des Untersuchungsinhaltes
Abbildung 9: Umsatz der berichtenden Unternehmen
Abbildung 10: Gesamtpunktzahlen der Printberichte
Abbildung 11: Punktzahl der Teilbereiche große Unternehmen
Abbildung 12: Punktzahl der Teilbereiche mittelgroßer Unternehmen
Abbildung 13: Einfluss der GRI-Richtlinien auf die Gesamtwertung
Abbildung 14: Erstberichtserstattung und der Integration im Geschäftsbericht
Abbildung 15: Vergleich der Gesamtwertung von Print- und Onlineberichten
Abbildung 16: Punktzahl der Teilbereiche der Online-Berichte
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: GRI- Indikatorprotokolle
Tabelle 2: Anzahl der Energieversorger nach Bundesland
Tabelle 3: Berichtsbezeichnungen der Printberichte
Tabelle 4: Anzahl der berichtende Unternehmen und Unternehmensgröße
Formelverzeichnis
Formel 1: Nachhaltigkeitskapital
Formel 2: Randbedingung des Nachhaltigkeitskapitals
Formel 3: Anteil Recyclingmaterial
Formel 4: Gesamtenergieverbrauch
Formel 5: Ozonemission
Formel 6: Berechnung der Punktzahl
Formel 7: Berechnung der Gesamtpunktzahl
Formel 8: Umrechnung der Punkte aus den Teilbereich
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
Das Thema Nachhaltigkeit hat in den letzten Jahren sowohl für die Öffentlichkeit als auch für den unternehmerischen Alltag deutlich an Bedeutung gewonnen. Aussagen über eine nachhaltige Entwicklung können heutzutage in fast allen Lebensbereichen gefunden werden.[1] Die Energieversorger schließen sich diesem Trend ebenfalls an. Sie sprechen von Ökostrom und nachhaltiger Energie.[2] Wollen die Unternehmen jedoch nicht des Greenwashings[3] beschuldigt werden, müssen sie die Nachhaltigkeit aktiv und in angemessenem Rahmen nach außen und nach innen kommunizieren. Ein geeignetes Mittel hierzu ist der Nachhaltigkeitsbericht.
Auch in der Forschung steigt das Interesse an der Nachhaltigkeit und damit verbundenen Themen. So wurden in den letzten Jahren zahlreiche Arbeiten und Studien veröffentlicht, die sich mit den unterschiedlichen Themengebieten der Nachhaltigkeit befassen. Einbeziehung der Stakeholder, Berichtsrahmen, Verbreitung und Nutzen der Berichterstattung sind Beispiel für deren Inhalte.
Vor allem mit dem aktuellen Wandel in der Energiepolitik durch die jüngsten Ereignisse in Fukushima (Japan) verstärkt sich die Orientierung hin zu erneuerbaren Energien und nachhaltig erzeugtem Strom.[4] Dies zwingt die Energieversorger zu einem Umdenken, dass sowohl ökonomische und ökologische als auch soziale Konsequenzen mit sich bringt. Die Energieversorger sollten sich daher in der Pflicht sehen über den Wandel in diesen Bereichen offen und transparent zu berichten.
Die nachfolgende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage inwieweit die Energieversorger auf dem deutschen Markt über ihre Nachhaltigkeit berichten und in welchem Umfang die Nachhaltigkeitsberichterstattung stattfindet.
Die Arbeit gibt zunächst eine kurze Einführung zur Nachhaltigkeit im Allgemein. Im dritten Kapitel erfolgt eine Beschreibung der Branche der Energieversorger. Das vierte Kapitel befasst sich mit dem eigentlichen Sustainability Reporting. Darauf aufbauend werden die Vorgehensweise und die Inhalte der durchgeführten Untersuchung dargestellt. Abschließend werden die Ergebnisse aufgezeigt und ein Fazit zur durchgeführten Untersuchung gezogen.
2 Sustainability
Für das Sustainability Reporting ist es zunächst wichtig den Begriff Sustainability näher zu analysieren. Deshalb ist es Ziel dieses Kapitels einen umfassenden Überblick zum Begriff der Nachhaltigkeit (engl. sustainability) zu geben. Weiterhin soll diese Kapitel das zu Grunde liegende Verständnis dieser Arbeit wiederzugeben.
Um Nachhaltigkeit möglichst vollständig zu erfassen, wird zunächst die Entwicklung des Begriffes - im Laufe der Zeit - betrachtet. Hierbei werden wesentliche Meilensteine auf dem Weg zum heutigen Verständnis erörtert und deren zentralen Beiträge zu einem umfassenden Nachhaltigkeitsverständnis zusammengefasst.
Im nächsten Schritt wird das Konzept der Nachhaltigkeit von ähnlichen Konzepten, welche sich mit der unternehmerischen Verantwortung, gegenüber internen und externen Stakeholdern befassen, abgegrenzt. Dies ist für die eindeutige Definition des Begriffes Nachhaltigkeit bzw. Sustainability notwendig, da die Bandbreite synonym verwendeter, inhaltlich ähnlicher oder gleicher Begriffe erheblich ist.[5]
Nach der Abgrenzung wird in diesem Abschnitt auf das eigentliche Modell der Nachhaltigkeit eingegangen. Es folgt eine Erläuterung der grundlegenden Ideen, inklusive der Kernbereiche der Nachhaltigkeit. Es wird auf die Interdependenzen zwischen diesen Bereichen und die aktuellen Entwicklung im Rahmen des Modellverständnisses eingegangen.
In einem letzten Schritt erfolgt abschließend die Definition von Sustainability, wie sie in dieser Arbeit Anwendung findet.
2.1 Historische Entwicklung der Nachhaltigkeit
In der modernen Literatur zum Thema Nachhaltigkeit[6] als Ausgangspunkt der nachhaltigen Entwicklung - somit als Ansatz zur Nachhaltigkeit - häufig das Ergebnis des sog. Bruntland-Reports aus dem Jahre 1987 gefunden. In dieser Ausarbeitung wird die Nachhaltigkeit als ein generationsübergreifendes Konzept verstanden, dessen Ziel es ist, die Bedürfnisse zukünftiger Generationen nicht zu gefährden, aber dennoch die Bedürfnisse heutiger Generationen zu befriedigen.[7] In diesem Zusammenhang von einer intragenerativen und intergenerativen Perspektive gesprochen. Die intragenerative Perspektive betrachtet dabei die Bedürfnisse innerhalb einer Generation im Querschnitt, im engeren Sinne zwischen verschiedenen Ethnien, Kulturen und Regionen. Die intergenerative Perspektive betrachtet hingegen die Interessenskonflikte zwischen mehreren Generationen über einen zeitlichen Horizont, also im Längsschnitt.
Der Ursprung einer nachhaltigen Entwicklung geht auf VON CARLOWITZ zurück, der im 18. Jahrhundert erstmalig das Prinzip der nachhaltigen Forstwirtschaft in seiner „Sylvicultura Oeconomica“ beschreibt. Ähnlich zu der zukunftsorientierten und intergenerativen Sichtweise des Bruntland-Reports zeigt er auf, dass nur so viel Holz geschlagen werden darf, wie durch die Neupflanzung aufgeforstet werden kann, wenn der Holzbedarf zukünftiger Generationen gesichert werden soll.[8] Der Ursprung der Nachhaltigkeit liegt somit primär im Ökologischen.[9]
Ebenso sei, entlang der wesentlichen Meilensteine der Entwicklung der Nachhaltigkeit, der Club of Rome erwähnt, welcher in den 70er und 80er Jahren den Begriff der Ressourcenknappheit in die Debatte um eine nachhaltige Entwicklung brachte.[10] Dies hat dazu geführt, dass sich der Begriff Sustainability zu diesem Zeitpunkt im Wesentlichen über den ökologischen Teilaspekt definiert.
Angesichts dieser neuen und komplexen Herausforderungen führt der Bruntland-Report dazu, dass auch von einer politischen Seite eine notwendige Berücksichtigung von inter- und intragenerativen Interessen gefordert wird. Dieser Tendenz folgend kommt es zwangsläufig zur Einbeziehung einer sozialen Komponente in die Diskussion um die Nachhaltigkeit, da der Mensch in die Betrachtung einfließt.[11] Nachhaltigkeit wird somit als ein Modell verstanden, welches die sozialen und ökologische Belange der Gesellschaft und die Wechselwirkungen dieser Belange verknüpft.[12]
Einen weiteren Meilenstein in der schnell wachsenden Nachhaltigkeitsgeschichte stellt die Konferenz der Vereinten Nation im Juni 1992 in Rio de Janeiro dar. Als besonders wesentlich ist die dabei entstandene Agenda 21 zu erachten, welche die Idee einer nachhaltigen Entwicklung in vier Teilen konkretisiert: soziale und wirtschaftliche Dimensionen, Erhaltung und Management von Ressourcen zur Entwicklung, Stärkung der Rolle wichtiger Gruppen und Maßnahmen zur Implementierung. Dies prägen erstmalig auf global-politischer Bühne zwei weitere Aspekte der Nachhaltigkeit.[13] Diese sind der Ansatz zur Stakeholder-Theorie, durch die Einbeziehung mehrere relevanter Interessensgruppen, sowie daraus resultierend die explizite Einbeziehung von Unternehmen.[14] Eng an die Agenda 21 und den Bruntland-Report sind weiterhin auch die Bellagio-Prinzipien gebunden. Die zehn Prinzipien sind das Resultat der Bellagio-Konferenz im Jahre 1996.[15] Sie dienen der Einschätzung einer nachhaltigen Entwicklung, berücksichtigen Interdependenzen zwischen einzelnen Bereichen und zeichnen sich durch ihre allgemeine Umsetzbarkeit und Anwendbarkeit besonders für die Praxis aus.[16] Im späteren Verlauf der Arbeit werden diese Prinzipien auch als Teil der Bewertung von Nachhaltigkeitsberichten eingehen.[17]
Mitte und Ende der 90er beginnen die ersten Unternehmen über Nachhaltigkeit zu berichten. Dies führt in der praktischen Umsetzung zur Komplettierung des Nachhaltigkeitsverständnisses, da durch die Einbeziehung der Unternehmen die wirtschaftliche Sichtweise in die Nachhaltigkeitsdebatte Einzug hält.[18] Das hierdurch entstandene Modell bezeichnet ELKINGTON als 3-Säulen-Modell (engl. tripple bottom line). Es beinhaltet die Bereiche Ökologie, Ökonomie und Soziales. Diese drei Bereiche stützen, gemäß dem Sinnbild, die Idee der Nachhaltigkeit. Es drückt im Besonderen aus, dass Nachhaltigkeit von allen drei Säulen gleichmäßig getragen werden soll und somit alle Bereiche gleich gewichtet werden. Das Modell der Tripple Bottom Line stellt den Grundstein des heutigen, unternehmerischen Nachhaltigkeitsbewusstseins dar. [19]
2.2 Weitere Modelle unternehmerischer Verantwortung
Der Begriff der Nachhaltigkeit ist vor allem auf Grund der Vielzahl an Modellen und Theorien, welche im engen Zusammenhang mit Sustainability stehen oder unter anderem Namen ähnliche Konzepte beschreiben, als kritisch anzusehen. Auch im Umfeld der Unternehmen etabliert sich diese begriffliche Vielfalt und macht es dem interessierten Leser zunächst schwer, zu durchschauen wie umfangreich das Selbstverständnis unternehmerischer Verantwortung nach Innen und nach Außen gestaltet wird. [20] Im Folgenden werden diese Konzepte in einem kurzen Überblick dargestellt und wesentliche Inhalte und Kritiken aufgezeigt.
JONKER, STARK und TEWES identifizieren, nebst der Nachhaltigkeit, vier wesentliche Konzepte, welche in Unternehmen überwiegend Anwendung finden, wenn diese über Soziales, Ökologisches und/oder Ökonomisches berichten. In ihren Augen sind dies primär Corporate Social Responsibility (CSR), Corporate Citizenship (CC), die Wirtschafts- und Unternehmensethik sowie Corporate Responsibility (CR).[21]
Das Konzept der CSR ist unter diesen vier Konzepten das am weitesten verbreitete Konzept.[22] Es umfasst in erster Linie die Integration sozialer Belange und Verpflichtungen in die Ausrichtung der Unternehmenstätigkeit und ergänzt das klassische Profitstreben.[23] CSR ist sowohl ein theoretischer Ansatz als auch eine Führungsphilosophie[24] und stellt nach dem Verständnis dieser Arbeit einen wesentlichen Bestandteil der Nachhaltigkeit dar. Dieses Konzept sieht das Unternehmen als profitmaximal ausgerichtete Institution, deren politischer Einfluss durch die enge Verknüpfung von sozialen und wirtschaftlichen Prozessen erheblich ist. Darüber hinaus erfüllen Unternehmen in der Gesellschaft wesentliche soziale Aufgaben. Diese entstehen zum Einen durch die interne, zum Anderen durch die externe Kommunikation mit Stakeholdern. Sie werden, unabhängig von ihrem ökonomischen Einfluss auf das Unternehmen, bei der Verfolgung der Unternehmensziele berücksichtigt.[25] Eine weitere Abgrenzung der CSR ist allerdings schwierig, da bei diesem Konzept keine einheitliche Definition vorliegt.[26] Dieses Konzept ist durchaus kritisch zu betrachten, da es sich durch die begriffliche Einschränkung des Wortes social inhaltlich stark von anderen Themenkreisen, welche im Rahmen einer ganzheitlichen Nachhaltigkeit relevant sind, differenziert.[27] Es wird ebenfalls kritisiert, dass CSR nicht durch die intrinsische Motivation eines Unternehmens - den Informationsbedarf der Stakeholder zu befriedigen - getrieben wird, sondern in erster Linie eine Reaktion auf die Marktanforderungen darstellt.[28]
Ein anderes Konzept, das versucht die Verantwortung von Unternehmen gegenüber der Gesellschaft zu beschreiben, ist das Corporate Citizenship. Dass Ziel von VV ist es, ein gesellschaftsbewusstes Handeln zu implementieren. Es umfasst alle Maßnahmen, bei denen ein Unternehmen in sein gesellschaftliches Umfeld investiert.[29] CC stellt folglich ein Konzept des Gebens durch die Unternehmen dar, ohne das unmittelbar ein Mehrwert für das Unternehmen entstehen muss.[30] Im Optimalfall führt dies zu einem Imagegewinn oder einem finanziellen Vorteil für das Unternehmen.[31] Zum Gewährleisten einer nachhaltigen Entwicklung ist dieses Konzept allein nicht ausreichend. Eine Integration des Grundgedanken, in ein Nachhaltigkeitskonzept eines Unternehmens, ist dennoch wünschenswert.
Neben dem Modell der CSR und des CC ist das Modell der Wirtschafts- und Unternehmensethik das am wenigsten greifbare der genannten Konzepte. Auch wenn der Übergang zwischen beiden Ethiken nahezufließend ist, steht die Wirtschaftsethik, hierarchisch betrachtet, über der Unternehmensethik. Sie dient der gesamte Wirtschaft als Leitfaden und stellt ethische Normen. Es werden keine konkreten Handlungsempfehlungen ausgesprochen, sondern Möglichkeiten zur Reflexion und Analyse geboten. Die Unternehmensethik ist, im Vergleich dazu, praxisorientiert und unternehmensspezifisch. Sie spiegelt individuell den externen und internen Blick auf ein Unternehmen wider.[32] Ihr Ziel ist es gesellschaftliche Werte und Normen im Bewusstsein und dem Führungsalltag des Unternehmens zu verankern.[33] Auch dieses Konzept betrachtet nur einen Teilaspekt der Nachhaltigkeit.