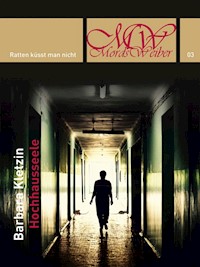4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Politkrieg um eine Industriebrache, die mit Millionen von Fördergeldern vom Land saniert werden soll. Lokalpolitiker wollen einen Volkspark, Geschäftsleute spekulieren, dass sie nach der Sanierung dort ein Gewerbegebiet ausbauen können. Umweltschützer boykottieren das Projekt, aufgrund schützenswerter Amphibien, die sich laut eines Gutachters, dort angesiedelt haben, aber außer ihm hat niemand die Tiere gesichtet. Zwischen den Riesen, die sich bekämpfen, steht Reinold Maaß, ein kleiner Beamter, der zum Held werden will. Er lässt sich weder von Drohungen noch von Leichen, die seinen Weg pflastern, aufhalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Barbara Kletzin
Krötentanz
Mordsweiber 02
Inhaltsverzeichnis
Über das Buch
Prolog
Die Begegnung
Die Ereignisse fünf Tage davor
Schlachtfelder
Spurensuche
Flugangst
Leichenshow-down
Home Sweet Home
Geisterstunde
Scharmützel
Der Tanz
Jagdreviere
Stillwasser redet
Feldzüge
Die Fährte
Der Fluch der Kugel
Friedhofs-Talk
Les miserablés
Dämonen
Anmerkungen der Autorin
Impressum
Über das Buch
Ein Don Quijote
Ein Moriarty
Eine Philosophin
Ein Hauptkommissar
Wer rettet die Welt?
Aber ein Anderes ist der Gedanke,
ein Anderes die That,
ein Anderes das Bild der That.
Friedrich Nietzsche
Prolog
„Du glaubst, es funktioniert?“
„Wir haben die richtigen Leute auf unserer Seite.“
„Sind Sie verlässlich? Wir müssen Sie für einen längeren Zeitraum bei Laune halten.“
„Du weißt doch: ‚Geld regiert die Welt‘.“
„Schaffen wir es, die Störenfriede zu beseitigen?“
„Darum kümmere ich mich.“
„Was ist, wenn deren Plan gelingt?“
„Niemals!“
Heiteres Gelächter.
„Wie ändern wir die Pläne später offiziell zu unseren Gunsten?“
„Durch monetäre Überzeugungskraft und die federführenden Personen, die auf unserer Seite sind.“
„Die Umweltverbände werden Schwierigkeiten machen.“
„Lass das meine Sorge sein.“
„Was ist, wenn sie uns auf die Schliche kommen?“ Bedenken von dem Jüngsten unter ihnen.
„Uns? Junge! Wir sind das System. Wir sind unangreifbar.“
„Gut. Ich denke, wir können von einem reibungslosen Ablauf ausgehen, vorausgesetzt niemand von uns tanzt aus der Reihe.“
Alle sahen sich prüfend an und alle zeigten sich entschlossen, das Projekt umzusetzen.
„Wie verhalten wir uns dem – nun ihr wisst, wen ich meine – gegenüber?“
Schweigen. Dichter Zigarrenqualm stahl den Gesichtern die Konturen.
„Ich habe meine Leute.“ Die Stimme erinnerte an Salzsäure, die jedes Problem auslöschte.
Der Jüngste wagte zu fragen, flüsternd: „Wie weit würdet ihr gehen?“
Das daraufhin folgende Schweigen erzeugte bei dem Jungen eine Kälte, die nicht zu der schwülen Nacht passte, die um das Gebäude stand wie eine schwarze Witwe.
*
Sie hat die Strecke verlängert. Seit Tagen, gleiche Zeit, gleicher Ort. Ich hoffe, sie ändert daran nichts mehr. Der Standort ist wie geschaffen für mich. Ich werde ihn beibehalten. Mir muss nur noch einfallen, wie ich dorthin komme. Der entscheidende Punkt. Es muss ein unauffälliges Gefährt sein und es darf nachher keine Spur zu ihm führen. Nachher. Bei dem Gedanken wird mir flau. Werde ich es tun? Bin ich dazu in der Lage? Die Sache ist es wert. Aber sei ehrlich zu dir. Gestehe dir ein, dass dich auch das Geld reizt. Die Bezahlung ist unglaublich hoch. Mit meinem Verdienst… mh, man nimmt mich nicht ernst. Das wird sich ändern, wenn ich diese Aufgabe durchziehe. Ich weiß, keiner der mich kennt, traut mir eine solche Tat zu. Danach aber… Schluss. Was für ein Unsinn. Niemand darf davon erfahren. Ich muss unscheinbar bleiben. Nur so kann ich erfolgreich handeln. Vorausgesetzt ich tue es. Mir graust vor dem Tag. Nein und nochmals nein! Ich werde nicht kneifen. Ich werde zu gegebener Zeit zur Stelle sein. Was dann passiert? Man wird sehen.
Die Begegnung
Samstag, 4. August
Victor Kranski fluchte. Seine Schuhe, Modell Bergarbeiter- Sicherheitsschuh, aus feinstem Leder handgearbeitet, steckten in einer grünlichen Brühe. Er hatte, nach mehreren vergeblichen Startversuchen, den Porsche, dessen Räder sich in den Schlamm gewühlt hatten, zurückgelassen. Obwohl es seit Stunden nicht mehr regnete, flaggte der Himmel grau und finster über dem Land. Soweit das Auge reichte bedeckten Schlamm und Pfützen den Boden. Die Straße, die sich allein durch tiefe Schlaglöcher zu erkennen gegeben hatte, hatte sich verflüchtigt und Kranski war auf etwas gelandet, das er einer landwirtschaftlichen Nutzfläche zuordnete. Ein verdammter Acker.
Hauptkommissar Victor Kranski sagte mehrmals das Sch-Wort. Er wusste, diesmal würde er die Rechtsmedizinerin töten. Nicht wie sonst, in seiner Fantasie, sondern diesmal würde er sie tatsächlich töten. Dabei würden ihn keine moralischen Bedenken, ein menschliches Wesen zu vernichten, hindern. Frau Doktor Wolf hatte nichts Menschliches. Keine Frau wühlte täglich in Leichen, ohne Schaden zu nehmen. Doch augenblicklich war er unterwegs, um sich von einer Frau Rat zu holen, so wie die Wolf es ihm empfohlen hatte.
Er besann sich darauf, dass er ein Kerl war, ignorierte die demütigende Situation und marschierte mit zusammengebissenen Zähnen, den aufspritzenden Dreck missachtend, los.
Jegliches Zeitgefühl war ihm abhandengekommen. Zudem erschwerten die Sichtverhältnisse das Nachvollziehen der Wegbeschreibung, die die Rechtsmedizinerin für ihn skizziert hatte. Am liebsten wäre Kranski wieder umgekehrt. Aber hinter ihm lag eine Ödnis, die durch die hereinbrechende Dämmerung nicht verlockender wurde. Unwillig gestand er sich ein, dass ihn auch seine Neugierde auf die mysteriöse Frau Malo in diese missliche Situation gebracht hatte.
Nach wenigen Metern versperrte ihm eine Mauer den Weg, die, überwuchert von stachligen, dicht ineinander verschlungenen Ranken, jedem Besucher ein „Nein“ entgegenrief. Kranski dagegen betrachtete sie als Orientierungshilfe. Er stapfte an ihr entlang, geriet mal eben in Brombeerranken, aus deren Stacheln er sich vorsichtig, besorgt um sein Leinenjackett, befreite und hoffte inständig, dass der bösartige Steinhaufen zum Anwesen gehörte und ihn endlich zu einem Eingang führte.
Nach einiger Zeit, die ihm wie eine Ewigkeit vorkam, erreichte er ein Tor, dessen eiserne Gitterstäbe mit ihren Spitzen wehrhaften Lanzen ähnelten. Es war in massive Steinsäulen eingelassen, auf deren Sockel steinerne Löwen saßen, die bedrohlich ihre Mäuler aufrissen. Durch die Gitterstäbe erkannte Kranski eine unbefestigte Auffahrt. In dem dämmerigen Licht konnte er das riesige Gelände dahinter nur erahnen.
Er betätigte eine altmodische Klingelschnur. Beim Anblick der Festung war er jetzt vollkommen überzeugt, in seinem schwierigen Fall keine Hilfe von einer Frau erwarten zu können, die so zurückgezogen lebte.
Überraschend leicht glitten die beiden Hälften des schweren Tores auseinander um sich gleich, nachdem Kranski hindurchgegangen war, wieder hinter ihm zu schließen. Wie unter Zwang sah er nach oben und entdeckte die Videokamera. Offensichtlich gab es einen Torhüter, der einen elektrischen Mechanismus bediente.
Zögernd tat Kranski ein paar Schritte. Verlassen und düster breitete sich das Anwesen, auf dem man einen Staat hätte gründen können, vor ihm aus. Wild wuchernde Sträucher bedeckten einen großen Teil des riesigen Parks. Aus der regennassen Wiese, die sich vor dem Gestrüpp ausbreitete, dampfte Feuchtigkeit ab und zog in dünnen Nebelfäden einem trüben Himmel entgegen. Wie gelangweilte Gespenster hingen die zerfransten Dunstschwaden in dem struppigen Gebüsch.
Zornig blickte Kranski auf das menschenleere Areal. Ein Gebäude war nicht in Sicht und das Ende der Auffahrt mündete in einem Wäldchen, wo Kranski von den Bäumen in dem fadenscheinigen Licht nur dicke, efeuumrankte Stämme wahrnahm.
Er hatte große Lust, einfach umzukehren, als der Wind plötzlich auffrischte und die dunkle Wolkendecke auseinanderriss. Drei dunkelgraue Hunde, ähnlich zotteligen Ponys, tauchten auf, begleitet von einem hünenhaften Mann, der sich auf den Eindringling zubewegte gleich einem Rausschmeißer, der den ungebetenen Gast grob hinausbefördern würde.
Vorerst wappnete Kranski sich jedoch gegen den Angriff vor dem gewaltigsten der Hunde, der auf ihn zuraste, vor ihm stoppte, sich auf die Hinterpfoten stellte, die Vorderpfoten auf Kranskis Schultern legte und ihm die Zunge liebevoll durchs Gesicht zog.
Kranski machte einen kurzen Ausfallschritt nach hinten und behielt das Gleichgewicht. „Hey, Dog, nimm deine dreckigen Pfoten von mir oder ich knall dich ab wie einen Hund.“
Erneuter Zungenschlag durchs Gesicht.
„Okay, du willst es nicht anders.“ Victor packte den Kopf des Hundes mit beiden Händen, zog ihn zu sich heran und drückte ihm einen dicken Kuss auf die Schnauze. Der Hund tollte begeistert davon.
„Down!“ Der scharfe Befehl zerschnitt die Stille und alle drei Hunde lagen im Platz. Der Hüne kam näher, seine Bewegungen waren schwerfällig, was nichts an seinem furchteinflößenden Äußerem änderte. Ein muskelbepackter Typ, wohl an die ein Meter neunzig groß. Seine Haare waren so grauschwarz, lang und zottelig wie die der Hunde. Er hatte ein Boxergesicht, platte Nase, angriffslustige Augen.
Großer Zeus, dachte Victor, sie haben einen Neandertaler geklont. Was ist das hier. Area 666?
„Was?“, fragte der Hüne.
„Fragen Sie lieber ‚wohin‘. Ich will zu einer Frau Laura Malo.“ Victor und der Hüne standen sich auf Augenhöhe gegenüber. Der Mann machte eine Kopfbewegung, die Kranski im Sinne „folge mir“ interpretierte.
Er stapfte hinter dem Hünen und den drei Hunden her und verfluchte im Stillen wieder die Rechtsmedizinerin, die ihn hierhin geschickt hatte. „Suche Laura Malo auf, wenn du in deinem Fall nicht weiterkommst. Ihre Art, Spuren zu deuten, beruht auf einem Wissen, das die wahre Natur eines Verbrechens erkennt und sich durch scheinbar sichere Fakten nicht in die falsche Richtung führen lässt.“
Sie gingen eine Auffahrt hoch, die schier kein Ende nehmen wollte. Victor Kranski zweifelte immer stärker an Dr. Wolfs Worten, die ihm versichert hatte, „Laura ist Ihre Rettung. Sie sieht die unsichtbaren Spuren“. An diesem Ort jedoch stellte er sich eine ängstliche, kleine Frau vor, die den archaischen und martialischen Aufwand zum Selbstschutz nötig hatte und kaum in der Lage sein würde, anderen zu helfen. Das Herrenhaus minderte den Eindruck nicht. Es war von uralten Fichten umgeben und die einfallende Dämmerung wischte seine Konturen ins Ungewisse.
Endlich erreichten sie den Eingang. Der Hüne benutzte einen Ring, der aus einem eisernen Löwenmaul hing, zum Klopfen und der Raum dahinter erdröhnte. Victor war überzeugt, in wenigen Augenblicken einem Mischgeschöpf aus Quasimodo, Frankensteins Kreatur und Dracula gegenüberzustehen.
Die Tür wurde mit einem heftigen Ruck aufgerissen und in dem ausladenden Eichenholzrahmen erschien eine kräftige Gestalt, die Victor als weiblich einstufte. Um den Kopf trug sie ein Tuch in Piratenmanier gebunden, zwischen farblosen Lippen hing eine Zigarillo und an ihrer linken Hand ein Wischeimer. „Lässt du die Köter rein, bist du ein toter Mann, Josef“, schlug sie den Hünen in die Flucht, „und Sie…“ der Stil des Schrubbers in ihrer Rechten arretierte kurz vor Victors Nasenspitze, „wagen Sie nicht, mit den schmutzigen Schuhen ins Haus zu kommen.“ Im Takt der Worte hüpfte die Zigarillo in ihrem Mundwinkel wie ein ekstatischer Voodootänzer. Etwas Glut sprühte zu Victor herüber. „Da!“. Die Person schob mit der Fußspitze Überziehpantoffeln in seine Richtung.
Er zog sie gehorsam an. „Frau Malo? Wir sind verabredet. Ich hatte heute früh angerufen“.
„Ich bin nur die Putze, Laura ist oben“, der Stiel des Schrubbers wies eine stockfinstere Treppe hoch. „Lichtschalter gleich am Treppenabsatz“. Danach hörte Kranski eine lautstarke Debatte über die Fußbodendiva aus Marmor, deren Reinigung eine Sensibilität erforderte, die der Piratin fremd war. Eine Line von Flüchen hinter sich herziehend, verschwand die Piratin nach draußen und ein Wasserfall platschte die Stufen hinunter.
Victor erreichte den Absatz, schaltete das Licht ein und setzte eine zwar wenig erhellende, dafür aber stimmungsvolle Wandbeleuchtung in Funktion. Vorsichtig tastete er sich, behindert durch die Überziehschuhe, die Treppe hinauf. In dem schummerigen Licht ahnte er die Länge des Flures mehr, als er sie erkennen konnte. Zu seiner Erleichterung fiel aus einer Tür ein Lichtstreifen auf rohe Steinplatten. Er schritt darauf zu und stieß die Tür auf, gespannt, was für ein Mäuschen ihn dahinter erwarten würde.
Die Wände des Raumes schienen aus Büchern gemauert zu sein. Kein freier Fleck. Einige Bilder, die alle den Typ Hund zeigten, der ihm draußen begegnet war. Die Gestalt Laura Malos löste sich von den Regalen, als entnähme man ihnen ein Buch. Sie wirkte, trotz des weiten Jeanshemdes, schlank und schmal. Das Hemd trug sie über einer verwaschenen Jeanshose.
„Herr Hauptkommissar Kranski!“ Ihr spöttischer Gesichtsausdruck passte nicht zu der offenen Art, mit der sie auf ihn zukam. Ein kräftiger Händedruck und eine Handbewegung, die weniger einladend als befehlend auf ein Sofa wies. „Setzen Sie sich.“
Sie ließ sich ihm gegenüber in einen wuchtigen Sessel nieder. Ihr dunkelbraunes Haar, das weich auf ihre Schultern fiel, durchzog eine gelbe Strähne. Victor Kranski, der Womanizer, hätte sie auf seiner Attraktivitätsskala nicht zwischen eins und zehn ansiedeln können. Sie passte nicht in seinen vorherrschenden Frauengeschmack. Sie hatte ein ovales Gesicht, hohe Wangenknochen und ihre Augen zogen sich schmal zur Schläfenseite hin. Wolfsaugen, dachte Victor. Ihre Stimme, mit der sie ihn nach dem tieferen Grund seines Kommens fragte, war sachlich, nüchtern, ihr Gesichtsausdruck konzentriert. Aber in ihren dunkelbraunen Augen forschte er vergeblich nach dieser Klarheit. Sie waren düster und es schien ihm etwas Verächtliches darunter zu liegen, das allem und jedem galt, und eine seltsame Traurigkeit.
Kranski fühlte sich so wohl, als säße er nackt in einer Ritterrüstung und er versuchte, die Distanz etwas aufzuheben, indem er auf eines der Bilder zeigte und fragte:“ Was sind das für Hunde?“
„Irish Wolfes“, antwortete sie knapp. Und dann, während sie ihren schön geschwungenen Lippen ein halbes Lächeln erlaubte: „Philosophie auf vier Pfoten.“
„So, so“, lenkte sie das Gespräch um, „Sie sind also an meinen Wächtern vorbeigekommen“. Wieder das halbe Lächeln in einem ernsten Gesicht.
„Ich habe einen Termin“, antwortete Victor Kranski, auf die Regeln des modernen Business bauend und nahm eine selbstbewusste Sitzhaltung ein. Er breitete die Arme auf der Rückenlehne des Sofas aus und legte den rechten Fuß auf das linke Knie, obwohl der lächerliche Überziehschuh der Haltung viel von ihrer Dominanz nahm.
„Kommen Sie zur Sache und lassen wir die überflüssige Konversation.“
Kranski schilderte die Tötungsdelikte und deren Problematik so akribisch wie möglich. Plötzlich bemerkte er, wie Frau Malos anfängliche Aufmerksamkeit abnahm. Sie hatte den Kopf zurückgelehnt. Ihre Blicke hingen mal an der Decke, schweiften durch den Raum oder überliefen seine Person wie ein Scanner. Seine Worte schien sie kaum noch zu hören, ihre Hände lagen entspannt auf dem Bauch oder umkrampften die Sessellehnen. Während des Gesprächs fiel ihm auf, dass ihre Augenfarbe und -größe sich veränderten. Manchmal sah sie ihn aus großen geweiteten Augen an, deren Braun so lieblich war, dass er das Bedürfnis hatte, die zierliche Frau in die Arme zu nehmen. Dann zog sie die Augen unvermittelt schmal und sie leuchteten bedrohlich gelb. Laura Malo war ihm unheimlich und er hätte sich am liebsten schnellstens verabschiedet und Frau Wolf heftig seine Meinung gesagt. Aber es war tiefschwarz draußen und Victor Kranski war klar, dass er sich auf eine Übernachtung einrichten musste. Irgendjemand musste am nächsten Tag auch seinen Porsche aus dem Dreck ziehen. Als er an seinen Liebling dachte, der in Schmutz und finsterer Nacht einsam dalag, krampfte sein Herz.
Victor schaffte es, seinen Bericht zu beenden. Danach lehnte Frau Malo sich weit zu ihm herüber.
„Es geht nicht nur um Opfer und Täter, Herr Kranski, dieser Fall wird darüber hinaus fest gefügte Lebensordnungen aus den Fugen reißen.“ Und zum ersten Mal lächelten ihre Augen.
Sonntag, 5. August
Morgens
Das Heulen der Hunde weckte Victor Kranski aus wirren Träumen, in denen er hilflos hatte zusehen müssen, wie sein Porsche in den Schlammmassen unterging. Victor lag in einem bequemen Boxspringbett und sah zur Zimmerdecke hoch, die von schwarzen, jahrhundertalten Holzbalken getragen wurde. Ein Paradies für Spinnen. Kranski erhob sich, blickte misstrauisch zu den Balken und rettete sich schnellstens ins Badezimmer, dessen Ausstattung einem Luxushotel alle Ehre gemacht hätte. Angezogen stand er eine halbe Stunde später orientierungslos auf dem Flur. Wohin? Kein Laut drang aus dem Haus, bis auf das Rauschen des Windes um das alte Gemäuer und das Knacken in dem Jahrhundertgebälk. Ohne die Überziehschuhe hoffte er, geräuschlos die Treppe hinunterzugelangen, die seine Bemühung durch ein höhnisches Knarren vereitelte. Wie aus dem Nichts stand die Haushälterin vor ihm. Piratentuch, Zigarillo im Mundwinkel. „Wenn Sie Dreck machen, putzen Sie den selber weg.“ Der Zigarillo hüpfte auf und nieder. „Laura ist da.“ Der Putzeimer schwang nach links, in Richtung einer zweiten Treppe.
Victor lächelte. Er lächelte sein Frauenherz schmelzendes Lächeln und der Piratin fiel der Zigarillo aus dem Mund. „Sie sind hinreißend“, sagte Victor und schob sich mit einer geschmeidigen Bewegung an der jungen Frau vorbei, berührte sie scheinbar unbeabsichtigt und hörte danach nur noch das Klappern des Wischeimers, der zu Boden ging.
Immer noch lächelnd stieg Victor die Treppe hinunter und betrat eine Küche, die so groß war, dass eine Kleinfamilie darin hätte wohnen können.
Ein monströser Kamin, in dem schon ein Feuer brannte, eine Kücheneinrichtung wie aus einem Hochglanzkatalog und ein Herd der Edelmarke. Laura Malo hatte Kaffee aufgebrüht und wandte sich nun dem Gast zu. Victor hörte kaum ihr gequältes „Morgen“. Sie strich sich mit beiden Händen über das Gesicht und sah ihn aus halbgeschlossenen Augen an. „Ich bin keine Frühaufsteherin. Aber die Hunde bekommen um sieben Uhr ihr Fressen und wird es fünf nach sieben, machen sie ein Theater, das es die Toten auf dem hauseigenen Friedhof zum Leben erweckt. „Sie hielt die Kanne hoch. „Trinken Sie mit. Milch? Zucker?“
„Schwarz.“ Victor setzte sich an den Eichenholztisch und nahm den Pott Kaffee entgegen. „Gibt es Frühstück.“
„Ich frühstücke nie“, sagte Laura, indem sie sich an der entgegengesetzten Seite des Tisches niederließ.
D’accord“, seufzte Victor und ignorierte seinen knurrenden Magen. „Mein Porsche ist einige Kilometer von hier steckengeblieben. Kann ihn da jemand rausziehen?“
„Josef mit dem Traktor.“
„Großartig.“
Sie schwiegen. Plötzlich erfasste Victor Kranski das starke Gefühl, angekommen zu sein. An diesem unwirtlichen Ort, in diesem herzlosen Haus fühlte er sich seit seiner Kindheit zum ersten Mal wieder geborgen. Ihm war bewusst, dass die Person ihm gegenüber dieses Gefühl hervorrief. Ihre zarte äußere Erscheinung, ihre großen dunkelbraunen Augen, die geheimnisvolle Kraft, die sie ausstrahlte und die charismatische Aura, die sie umgab. Ein Mensch, der alles weiß und versteht. Victor sah sich in einem eigenen Haus, an seinem eigenen Küchentisch sitzen und Laura an seiner Seite. Für immer.
„Sie wohnen hier?“ Victors Stimme klang rau.
„Vorübergehend.“
„Wem gehört das Haus?“
„Einem Amerikaner mit deutschen Wurzeln. Mister Samuel Miller.“
„Sie wohnen zur Miete?“
„Nein.“
„Verwandte von Mister Miller?“
„Nein.“
Morgenmuffel, dachte Victor. Genau wie ich.
„Großzügiger Mann“, startete er einen erneuten Versuch, Persönliches über Frau Malo zu erfahren.
„Bonus.“
„Das erklärt alles.“
„Ich habe wohl einen Nachbarschaftskrieg verhindert“, sagte Laura, nun aufgeschlossener. Sie goss sich und ihrem Gast die zweite Tasse Kaffee ein.
„Sie haben das Duell gewonnen?“
„Ja. Meine bevorzugte Waffe ist der Instinkt. Der Fall: Mister Miller züchtet Irish Wolfhounds. Sehr erfolgreich. Seine Nachbarn auch. Jedoch weniger erfolgreich. Zwei seiner besten Hunde starben, seiner Meinung nach vergiftet. Er hatte er die Nachbarn in Verdacht und beauftragte mich, sie zu observieren, sozusagen auf frischer Tat zu ertappen.“
„Haben Sie?“
„Ein Tag genügte mir, um festzustellen, dass diese Menschen zu einem so heimtückischen Anschlag unfähig wären. Ich ließ die verendeten Hunde ausgraben und bat Sina, sie zu obduzieren.“
„Woher kennen Sie Frau Wolf?
„Während meiner Ausbildung zur Privatdetektivin habe ich ein Seminar in Kriminalistik besucht. Dort traf ich Sina Wolf. Wir verstanden uns sofort.“
„Und die geniale Rechtsmedizinerin hat das Rätsel gelöst?“, fragte Kranski sarkastisch.
„Ja. Hasenreste. Kranke Tiere, die die Hunde gefressen hatten. Daran waren sie gestorben. Josef schläft zwar im ehemaligen Gesindehaus inmitten der Wolfsmeute. Aber das Gelände ist riesig und die Hunde können frei herumlaufen. Er hatte sie also nicht ständig unter Aufsicht. Daraufhin wurde der Auslauf der Hunde übersichtlich verkleinert und Mister Miller informierte einen Förster, der das Problem bald gelöst hatte.“
„Heilmittel Schrotkugel?“
„Ausnahmsweise“, sagte Laura und atmete tief durch, „hat es mich nicht belastet. Die Krankheit führt bei den Hasen zu einem elenden Tod.“
„Sonst sind sie kein Freund der Jäger.“
„Nein“, sagte Laura hart.
„Und Ihre Belohnung?“
„Ein großzügiges Honorar und das Angebot, in diesem Haus mietfrei zu wohnen bis ...“ Laura stockte unvermittelt.
„Wo sind sie eigentlich zu Hause?“, fragte Kranski.
Laura stand wortlos auf und ging zu der Kaffeemaschine, um sich noch einmal nachzufüllen.
Victor sah nur ihren schmalen Rücken und das lange, dunkelbraune Haar, das weich über ihre Schultern fiel.
„Wer sind denn diese beiden wilden Geschöpfe? Ich spreche von den archaischen Zweibeinern.“ Er lenkte sich durch die Frage von der Gestalt ab, die ihn faszinierte und gleichzeitig durch ihr seltsames Benehmen auf seine Frage irritierte.
„Geschwister. Josef und Paulette. Korsen. Mister Miller hat sie aus dem Urlaub mitgebracht. Er hat ein Faible für außergewöhnliche Typen. Und er zahlt gut.“
Victor beobachtete, wie Laura ein Medizinfläschchen aus dem obersten Schrank nahm, die Verschlusskappe abdrehte und allem Anschein nach, etwas davon in ihre Tasse schüttete.
Lautlos erhob er sich von seinem Platz und ebenso lautlos trat er hinter Laura Malo. Er sah über ihre Schulter auf das Etikett der Flasche. Ein Opiat. Seine Kehle schnürte sich zu und er brachte nur ein Flüstern zustande, als er fragte:
„Sind Sie krank? Unheilbar?“
Laura zählte unbeirrt die Tropfenanzahl zu Ende, drehte sich um und sah Victor ruhig an.
„Nein“, sagte Laura, „nur Schmerzen. Chronisch. Damit kann ich uralt werden. Aber das will ich gar nicht.“
„Gut. Ich wollte nicht neugierig…also aufdringlich…ich meine…“ Victor schob die Hände in die Taschen seiner schwarzen Jeanshose, hob die Schultern und blickte befangen auf die zarte Person. Er sehnte sich wieder danach, sie in die Arme zu nehmen.
Laura betrachtete…nein, sie begutachtete ihn und Victor fühlte, wie er unter ihrer Einschätzung um Fassung rang.
Mit emotionsloser Stimme beschrieb sie sein Gesicht. „Um Ihre schmalen Lippen liegt ein Ausdruck starken Selbstbewusstseins und gleichzeitig wirken sie betörend sinnlich. Ihre Augen schimmern grün, wie die einer Dschungelkatze in der Nacht. Gefährlich, verführend. Lauernd, schmeichelnd.“
„Danke“, sagte Victor trocken, unsicher ob er es als Kompliment auffassen sollte. „Malen oder bildhauern Sie?“
„Nein“, sagte Laura. „Es ist nur meine Liebe zum Schönen.“
„Das war’s, dachte Victor. Wenn mir nicht schnellstens ein unverfängliches Thema einfällt, knie ich vor ihr nieder und mache ihr einen Heiratsantrag.
„Bleiben Sie für immer hier wohnen?“, fragte er hastig und glaubte sich auf neutralem Boden.
Sie setzten sich wieder an den Tisch. Laura trank genüsslich die hochprozentige Koffeinbrühe mit dem Schmerzmittel darin.
„Nein“, sagte sie. „Mister Miller will seine Familie nach Deutschland holen und dann selbst hier wohnen.“
„Wo bleiben Sie dann?“
Schweigen.
„Sie müssen doch ein Zuhause haben?“, ließ Kranski nicht locker.
„Einen Wohnwagen.“
Bevor Kranski nachfragen konnte, erstickte Laura seine Neugierde mit den Worten „Fragen Sie nicht“ im Keim.
Kranski schwieg. Auch ohne Frau Malos Zurückweisung spürte, dass es in ihrem Leben einen wunden Punkt gab, an den er nicht rühren durfte. Doch die Vorstellung von ihr in einem Wohnwagen…
„Falls Sie nicht wissen wohin“, sagte er energisch, „ich habe ein Haus.
Laura lehnte ab. „Ich möchte kein Dauergast sein.“
„Kein Problem. Sie zahlen Miete. Ein richtiger Vertrag.“
„Ich brauche das Alleinsein“, mauerte Laura.
„Verstehe“, sagte Kranski. „Ich wohne im Hotel.“
„Auf Crack? Sie vermieten Ihr Haus und wohnen im Hotel.“
Kranski wehrte ab. „Ich habe schon vor Jahren eine Suite im ‚Kings‘ mitten in der Stadt bezogen, dauerhaft. Ich ertrage das leere Haus nicht. Mein Vater ist dort gestorben.“
„An Geldmangel scheinen Sie nicht zu leiden“, stellte Laura fest. „Aber warum ein Hotel und nicht ein schickes Apartment, wenn Ihnen Ihr Haus zu unheimlich ist?“
Victor überlegte eine Weile. Dann fragte er im konspirativen Tonfall: „Bleibt das ein Geheimnis zwischen uns?“
„Vertrauen Sie mir“, sagte Laura.
„Ich kann nicht allein sein“, sagte Victor. „Im Hotel sind Menschen um mich herum. Zimmerservice, Zimmermädchen. Und“, fügte er lächelnd hinzu, „es ist einfacher, einen One-Night-Stand aus einem Hotelzimmer zu verabschieden als aus der eigenen Wohnung.“
„Dann“, sagte Laura, „soll es mir recht sein. Darf ich mein Büro dort einrichten? Ehrlich gesagt, ich kann die Miete für eine Detektei in einem öffentlichen Gebäude nicht aufbringen.“
„Richten Sie sich im Arbeitszimmer meines Vaters ein, falls es Sie nicht stört, dass er darin gestorben ist.“
„Ich lebe mit vielen Gespenstern. Auf eines mehr kommt es nicht an.“
„Deal?“ Victor reichte ihr die Hand.
„Deal!“ Laura schlug ein und der Hauptkommissar stellte wieder fest, wie viel Kraft in ihrem Händedruck lag.
Die Ereignisse fünf Tage davor
Schlachtfelder
Montag, 30. Juli
Nachts
Brachiales Splittern. Das klirrende Aufschlagen von Glasscherben auf Fliesen.
Reinold Maaß lag regungslos im Bett. Ein stechender Schmerz fuhr durch den Knöchel seines rechten Fußes, der nackt dalag, unbedeckt, schutzlos, und von einem kalten, nassen Etwas berührt wurde. Durch das Loch in der Terrassentür floss in kurzen Wellen die warme Juliluft. Reinold hielt die Augen fest geschlossen und versuchte, unhörbar zu atmen.
Gabriele knipste die Nachttischlampe an. Es enttäuschte Reinold, dass sie seit einiger Zeit ihr wunderschönes goldblondes Haar nachts nicht mehr auf Lockenwickler drehte, sodass es anderentags in zauberhaften Löckchen ihr rundes puppenhaftes Gesicht umschmeichelte. Gabriele wandte ihm den Kopf zu, um den die Haare zerzaust hingen. „Dein Ding. Unternimm was. Schaff Ordnung.“ Dann löschte sie das Licht.
In langen Zügen sog Reinold Luft ein und wagte erst nach einer ganzen Weile, die Augen zu öffnen. Mit steifen Fingern haspelte er an der Schnur seiner Nachttischlampe bis sie aufleuchtete. Er richtete sich auf und sah nach dem Etwas, das ihn am Fuß getroffen hatte. Einer der großen Kieselsteine aus dem Gartenteich. Er packte ihn, hielt ihn ins Licht der Lampe, kniff die Augen zusammen und stellte fest, dass diesmal ein Utensil fehlte. Normalerweise waren die Steine mit einem Papierfetzen umwickelt, auf dem die üblichen Drohungen standen. Wie ein Ball lag der große Kiesel nun in Reinolds Hand. Ich schleudere dich nach draußen, grimmte er, und wenn ich Glück habe, treffe ich den Werfer. Der Gedanke beflügelte ihn. Er robbte aus dem Bett, vergaß die Pantoffeln, tappte auf bloßen Füßen los und trat in eine Scherbe. Der Stein sauste ihm aus der Hand und schlug eine tiefe Delle ins Laminat. Aufschreiend humpelte Reinold zum Bett zurück.
„Herrgott noch eins.“ Wütend sprang Gabriele auf, eilte aus dem Schlafzimmer und kam nach einer Weile mit Schüppe und Handfeger wieder. Wortlos fegte sie die Scherben zusammen. Zornig nahm sie den Schaden auf dem Fußboden wahr. „Dich erledige ich morgen“, sagte sie zu dem steinernen Übeltäter. Dann öffnete sie die Terrassentür weit und rief laut in die Nacht „Feiglinge!“
Die Dachterrasse lag dunkel vor ihr. Die Pupillen geweitet, spähte Gabriele die spiralförmig angelegte gusseiserne Treppe hinunter, die in den Garten führte und nur durch gelbliches Licht einer kleinen Außenlaterne beschienen wurde. Was war dort? Ein Schatten? Eine davonhuschende Gestalt? Schwierig, in dem kargen Mondlicht etwas deutlich zu erkennen Gabriele lauschte in die Dunkelheit. Da! In der Strauchhecke, die sie vom Nachbargarten trennte, vernahm sie ein Rascheln.
„Bist du lebensmüde?“, flüsterte Reinold. „Komm sofort von der Tür weg!“
Gabriele kroch ins Bett zurück. Sie starrte ihren Mann bitterböse an. „Ändere endlich deine Meinung, Reinold. Erst waren es Schmierereien an der Wand, jetzt ein Stein und demnächst? Womöglich ein Brandanschlag. Das sind die paar Kröten nicht wert.“
Sie zog die Bettdecke wie ein Schutzschild über sich. Doch Reinold spürte den Zorn, unsichtbar wie radioaktive Strahlen, unter denen er langsam zerfiel. Nein, dachte er, während er seinen Fuß verarztete – er hatte im Nachtschränkchen einen Erste Hilfe Kasten – ich gebe nicht auf. Am Ende werde ich siegen. Ein Held sein, ein wahrer Held.
Er fiel in tiefen Schlaf. Schwarze Schatten, die die zerbrochene Scheibe nutzten, flatterten herein. Sie setzten sich auf Reinolds Brustkorb, erdrückten ihn und einer schlang sich um seinen Hals. Er schlug nach ihnen, aber die Schläge trafen körperlose Wesen. Sie raubten ihm den Atem. Im letzten Augenblick erschien eine Lichtgestalt, in einem weißen, leuchtenden Gewand und goldglänzendem Haar. Sie schwebte über ihm. Die Schatten ließen von ihm ab und flohen in die dunkle Nacht.
Keuchend wachte Reinold auf. Er lag, das Gesicht ins Kissen gepresst, was die Luftnot erklärte. Er richtete sich auf und sog die Nachtluft ein, die das Einzige war, das durch die kaputte Scheibe strömte, angenehm kühl. Reinold tastete nach Gabriele. Sie lag von ihm abgewandt. Ungerührt. Er vernahm ihre leisen Atemgeräusche. Ich hätte ersticken können, erboste Reinold sich.
Mechanisch strich er über ihr Haar und die Schultern. Sie fühlte sich kühl und frisch an wie die Nachtluft. Am Ausschnitt des Nachthemdes ertastete er Feuchtigkeit. War das Schweiß? So stark? Nass klebte der Stoff an Reinolds Hand.
„Jetzt hast du mich geweckt“, giftete Gabriele plötzlich.
„Warst du draußen?“
„Spinnst du? Was sollte ich nachts draußen? Deine Feinde verscheuchen?“
„Schon gut.“ Kleinlaut kroch Reinold unter die Bettdecke, dachte, lach nur über mich, und träumte sich nach wenigen Minuten auf ein Siegerpodest.
Dienstag, 31. Juli
Morgens
Es duftete nach frischgebrühtem Kaffee und gerösteten Toastscheiben. Auf dem Frühstückstisch stand das Blümchengeschirr und in der Mitte, wie jeden Morgen, eine grazile Vase, in der frische Blumen steckten.
Das Fenster stand auf Kippe und der übliche allmorgendliche Lärm drang von der nahegelegenen Hauptstraße in die Küche. Die ersten Sirenen der Rettungswagen, das Rauschen der vielen Pkws, die ihre Besitzer zur Arbeit brachten, sechs Glockenschläge von der Sanctuskirche.
Das unermüdliche Bellen des Nachbarhundes Hasso, das klang, als käme es aus einer Blechdose, dazu das Rasseln der Kette, wenn er gegen sie anlief.
„Wann zeigst du den Kerl an?“, fragte Gabriele. „Kettenhaltung ist Tierquälerei und davon abgesehen geht mir das Gekläffe auf die Nerven.“
„Dann kommt der Hund ins Tierheim. Wer weiß, wo er danach landet“, war jedes Mal Reinolds Antwort. Im Stillen dachte er, eines Tages befreie ich den Hund und lege sein Herrchen an die Kette. Er dachte es und fühlte sich gut.
„Mutter kommt zu meinem Geburtstag. Sie will diesmal länger bleiben“, wechselte Gabriele das Thema.
„Schön“, sagte Reinold, ohne zu begreifen. Er hatte sich in die Sportseite der Zeitung vertieft und las betont langsam den Artikel über den Trainer seines Fußballvereins. Er fürchtete sich davor, zu Ende zu lesen.
„Sie wird es nicht verstehen.“ Gabriele stocherte lustlos mit dem Löffel in ihrem Brei aus Magerquark und Müsli herum. „Sie wird mir die ganze Zeit Vorhaltungen machen, dass eine Frau in meinem Alter so etwas nicht tut.“
„Wird schon“, sagte Reinold und ahnte den Schluss des Artikels, in dem über den Verbleib seines Lieblingstrainers diskutiert wurde. Nur weil seine Mannschaft zweimal hintereinander gegen einen schwächeren Gegner verloren hat, wollen sie ihn feuern, dachte Reinold. Aber in Wahrheit ist es sein Alter. Es ist immer das Alter. Reinold hob den Kopf und sah kurz zu seiner Frau hinüber. Sie hatte ihr Haar achtlos mit einem Gummiband zusammengewurschtelt und schlürfte missmutig ihr Müsli. Reinold vertiefte sich wieder in die Zeitung.
„Sie dir diese Krähenfüße an“, gab Gabriele keine Ruhe.
Reinold blinzelte über den Zeitungsrand. „Ich sehe keine, meine Liebe.“
„Sei nicht albern. Ich bin Mitte Vierzig. Zudem esse ich weniger und werde trotzdem ständig breiter. Es ist zum Verrücktwerden.“
Reinold fühlte sich wie ein Pferd im brennenden Stall, das trotz der Gefahr nicht den Ort verlassen wollte, der ihm zum Inbegriff von Sicherheit geworden war. Reinold wusste, jede Antwort würde falsch sein. Auch keine Antwort. So sagte er zaghaft:
„Du übertreibst, Liebes.“
„Du meinst also, die Alterserscheinungen sind eindeutig erkennbar, aber nur halb so schlimm, wie ich es sage. Oder?“
Zu dem stechenden Schmerz, den Reinold im dick verbundenen rechten Fuß spürte, gesellte sich ein stechender Schmerz in der linken Brustseite. Unauffällig vertiefte er sich wieder in den Sportartikel.
„Ich nehme Hildegards Rat an“, entschied Gabriele, „und gehe in die Klinik, die sie mir empfohlen hat. Reinold, was meinst du?“
Schweigen.
„Ich lass mich operieren.“
Reinold ließ die die Zeitung sinken, deren oberer Rand sich auf die Butter senkte und durchfettete.
„Du bis krank? Liebe, wie lange denn schon? Was hast du?“
Gabrieles Stimme traf Reinold wie ein Eispickel. „Du hörst mir nie zu. Du hörst mir explizit nie zu.“
Reinold schnaubte. Seit Gabriele mit dieser Hildegard von…irgendwas den Literaturkreis besuchte, liebte sie Fremdwörter. „Explizit vielleicht nicht, aber implizit höre ich, was du sagst.“
„Mach dich nur lustig. Ich gehe in die Klinik.“
„Gab, sag endlich was dir fehlt.“ Reinold schrie fast.
„Die Jugend, mein Lieber. Ich lasse mich liften. Dazu Fettabsaugung. Das ganze Programm. Rundumerneuerung.“
„Tu mir das nicht an, Gabriele. Du bist wunderschön. Eine seltene barocke Schönheit. Deine Haut ist wie Milch und Honig. Das Blau deiner Augen beschämt den Himmel an einem Sommertag. Und deine Haare…nun vor kurzem noch stellten sie die Sonne in den Schatten.“
„Bullshit“, war Gabrieles Antwort. „Ich bin fest entschlossen.“
„Warum? Du bist eine wundervolle Mutter, eine hinreißende Ehefrau, eine perfekte Hausfrau. Du führst doch ein glückliches Leben.“
„Nein, du bist glücklich damit, wie mein Leben abläuft. Wegen der Kinder habe ich mich gefügt. Und weil du mir etwas versprochen hattest, was du jedoch nicht eingehalten hast. Nach dem Abitur die Verwaltungsfachschule. Eine solide Ausbildung, hast du gesagt. Und dann studieren, den Doktortitel holen, um eines Tages in einem Ministerium unterzukommen. Was ist daraus geworden? Du gehst auf die Fünfzig zu und bis nur ein kleiner Beamter in mittlerer Laufbahn, mit einem ebenso mittleren Gehalt. Wir wohnen immer noch in dieser Null-Acht-Fünfzehn-Siedlung in diesem kleinen Haus in diesem beschränkten Leben. Jetzt sind die Kinder aus dem Haus und ich will endlich leben. Mein ureigenstes Leben und keine Funktion mehr erfüllen. Ich will schön sein, schön und jung und die Kraft haben das Leben in all seinen Facetten zu erfahren.“
„Das hat dir diese Hildegard von…von… aufgeschwatzt“, brauste Reinold auf.
„Hildegard von Burghausen. Und was bildest du dir ein? Dass ich unfähig bin, selber zu entscheiden?“
„Dein Pech, meine Liebe. Uns fehlt das Geld für deine Rundumerneuerung“, bemerkte Reinold voller Genugtuung.
„Uns? Ich verdiene Geld. Ich habe einen Job.“
„Einen Halbtagsjob?“
„Vollzeit. Seit sechs Monaten. Ich habe es so eingerichtet, dass ich vor dir zu Hause bin.“
Der Raum begann sich um Reinold zu drehen. Gabriele hat nichts gelernt. Die Tatsache arretierte Reinolds Schwindelgefühl. Vielleicht hat sie ‚ne Stelle als Putze, oder Kellnerin. Ach scheiß drauf! Er schrie innerlich. Ich will ihre Wärme und mollige Anwesenheit zu Hause haben.
Ich verbiete es dir!“, brüllte er los.
Er hatte eine andere Reaktion erwartet. Nicht diesen spöttischen Blick, untermauert von einem spöttischen Lächeln.
„Verstehe doch bitte“, beschwor er Gabriele, bemüht sie umzustimmen, „auch wenn du von mir enttäuscht bist, ich liebe meine Arbeit. Dass sie mir so viel bedeuten würde, konnte ich vorher nicht wissen. Stadtplanung. Daran mitarbeiten dürfen, eine Stadt, unsere Stadt, zu einem lebens- und liebenswerten Raum zu gestalten. Ich liebe die Bürgernähe, ihre Ideen und Anregungen aufzunehmen, sie mit einzubinden. Uns geht es doch gut. Vergiss diese Hildegard von…“
„Zurzeit bist du mehr Umweltschützer als Stadtplaner, mein Lieber, und damit geht es uns schlecht.“
„Die Industriebrache hat sich zu einem Biotop entwickelt. Das muss erhalten bleiben. Es wertet als ‚Grüne Lunge‘ unsere Stadt auf. Das darf nicht wieder dem Profit zum Opfer fallen. Gelder vom Land, um Natur in einen künstlichen Park umzuwandeln. Angepriesen als ‚Leuchtturm‘, der den Wohlstand in unseren Ort lockt.“ Reinold schnaubte. „Der Wohlstand segelt nur zu denjenigen, die mit Planung und Ausbau des Geländes beauftragt wurden. Ich werde Ihnen einen Strich durch die Rechnung machen.“
„Oder sie streichen uns durch. Wären die blöden Amphibien nicht, die niemand außer dir und dein geschätzter Gutachter gesehen haben, wären die Bagger schon unterwegs und wir hätten wieder unsere Ruhe.“
„Blöde Amphibien“, grummelte Reinold. „Eine artenreiche Umwelt ist eine gesunde Umwelt. Du begreifst es nicht!“
„Gewiss mein Lieber. In jedem von euch Männern steckt ein Atlas und Herkules. Ihr tragt die Welt auf euren Schultern und trefft richtungsweisende Entscheidungen.“
„Sei nicht so schnippisch. Sei froh, dass es so ist. Oder? Folgendes Beispiel: Flugzeugentführung. Landung in der Wüste. 60 Grad Hitze im Flugzeug. Was wäre, wenn es nicht hieße, Frauen und Kinder, sondern Männer und Kinder dürfen zuerst aussteigen?“ Reinold grinste triumphierend.
„Ist es nicht eure größte Angst, wir würden uns davor nicht fürchten?“
Reinold wurde blass. Er richtete die Zeitung auf und begann den Sportartikel nochmals von Anfang an zu lesen. Die letzten Zeilen! Gleich fiel das Urteil! Reinold war zumute, als läse er über sein eigenes Schicksal. Er hatte seit Langem das Gefühl, dass man ihn versetzen wollte. Niedrigere Arbeit, niedrigerer Lohn. Und dass, schon bevor er Hans Lohmanns Gutachten zum Schutze der Amphibien unterstützte. „Die Kommission kam zu dem Schluss…“, las Reinold als Gabriele plötzlich losfauchte:
„Du hältst mich nicht auf. Übermorgen gehe ich in die Klinik. Der Mist hilft nicht!“ Dabei schlug sie den Löffel heftig in die Müslischale, sodass die Körnerquarkmischung wie eine Fontäne hochschoss und über den Zeitungsrand hinweg auf den Sportartikel klatschte. Das Schicksal des Trainers ging im Magerquark unter.
*
Es schellte. Gabriele murrte: „Wer kann so früh was von uns wollen?“
„Sieh nach, dann erfährst du es!“ Reinold knüllte erbost die bekleckerte Zeitung zusammen.
Gabriele raffte den Bademantel um ihren üppigen Körper, knotete den Gürtel fest und ging zur Tür.
Ihr Nachbar, Herr Trappke, sah sie verlegen an. Herr Trappke war Rentner, Witwer und einsam. Er war oft auf die Hilfe von Reinold angewiesen. Nachdem ein Problem gelöst war, nötigte er Reinold jedes Mal, von seinem selbsthergestellten Kräuterschnaps zu kosten, woran sich längere Gespräche anschlossen.
Gabriele verschränkte die Arme und blockierte den Eingangsbereich.
„Was gibt‘s?“, fragte sie kurz angebunden.
Trappkes Garten grenzte direkt an den der Maaß‘.
„Sie haben einen Toten.“ Gabriele sah in Trappkes Gesicht, dessen Faltentiefe im Zeitraffertempo zunahm.
„Woher wissen Sie das?“
„Ich habe mehrmals „Hallo“ gerufen und „Das ist Hausfriedensbruch“ gesagt. Das Subjekt hat nicht reagiert.“
„Welches Subjekt? Wo?“
„In Ihrem Gartenteich schwimmt eine Leiche.“ Trappke flüsterte.
„Leichen schwimmen nicht.“
„Also…ähm…“ Trappke war verwirrt. „In Ihrem Teich treibt eine Leiche.“
„Unser Teich ist zu klein, als dass eine Leiche darin treiben könnte.“
„Ist Ihr Mann da?“
Wortfetzen waren zu Reinold gedrungen. Er hatte nur mit halbem Ohr hingehört und erst, als er gefordert wurde, gesellte er sich zu seiner Frau und dem Nachbarn.
„Morg’n. Wolfgang, alter Junge, was ist denn los?“
„In deinem Teich…äh…“ Trappke suchte offensichtlich nach einer korrekten Bezeichnung. Sein Gesicht hellte auf. „…liegt ein Toter.“
„Armes Tier“, Reinold schüttelte den Kopf. „Ich habe doch extra eine Flachzone eingerichtet.“
„Ein Mensch, Reinold“, unterbrach Trappke heftig.
„Was!“ Reinolds Stimme überschlug sich. Er stieß den Nachbarn beiseite, rannte die Treppe hinunter und schrie: „Meine Kois! Meine armen Kois!“
Gabriele und der Nachbar folgten ihm und guckten Reinold dabei zu, wie er, auf den Knien liegend sich abmühte, die Leiche aus dem Wasser zu ziehen.
Reinold ächzte. Er hatte den Toten halb aus dem Wasser gezerrt.
„Du kontaminierst den Fundort“, mahnte Gabriele kühl, „und zerstörst mögliche Spuren, indem du das Corpus Delicti bewegst.“
„Scheiß auf Beweise“, keuchte Reinold. „Meine wunderbaren Kois“, jammerte er und hatte Mühe, die Fische, die sich gierig im Gesicht und an den Armen des Leichnams festgesaugt hatten, zu entfernen.
„Was ist es denn“, fragte Gabriele. „Mann oder Frau?“
„Ein Mann“, japste Reinold. „Der tote Körper verunreinigt das Wasser.“
„Typisch“, sagte Gabriele und wandte sich an ihren Nachbarn. „Haben Sie die Polizei informiert.“
„Ist doch Ihr Toter“, trotzte Trappke.
„Alter Trottel“, murmelte Gabriele, ging ins Haus und rief in der Polizeizentrale an.
Der Streifenwagen traf gleichzeitig mit dem Rettungswagen ein.
Nachdem der Notarzt den Leichnam untersucht hatte, kreuzte er auf der Todesfeststellungsbescheinigung ‚unnatürliche‘ Todesursache an und reichte sie dem Beamten. „Ich tippe zwar auf Unfall“, erklärte der Notarzt und zeigte auf einen großen blutbeschmierten Stein am Teichrand, „aber es könnte auch jemand nachgeholfen haben.“ Er zuckte mit den Schultern und sagte: „Das herauszufinden, überlasse ich Ihnen und der Rechtsmedizin.“
Während der jüngere Polizist den Fundort großflächig absperrte, nahm der ältere Beamte die Personalien Trappkes und der Eheleute Maaß auf.
„Ich muss meine Kois füttern“, protestierte Reinold.
„Die sind satt“, sagte der Beamte mit einem Blick auf die angefressene Leiche, die gerade in einem Sarg verschwand und abtransportiert wurde.
„Der Arzt hat festgestellt“, begann er nun die Befragung, „dass der Mann seit Stunden im Wasser lag. Haben Sie in der Nacht etwas Verdächtiges gehört oder gesehen.“
„Ich bin vor dem Fernseher eingeschlafen“, blockte Trappke.
Reinold baute sich breitbeinig, die Arme in die Hüften gestemmt, vor dem Polizeibeamten auf. „Natürlich! Sehen Sie!“ Er wies auf die eingeschlagene Terrassentür. „Ein Stein wurde in der Nacht durch die Tür geworfen. Wir werden bedroht. Man will mich klein kriegen, durch Drohbriefe, Schmierereien an der Hauswand. Ich habe Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Aber es passiert ja nichts. Ich“, er wurde größer und breiter, „kämpfe gegen mächtige Leute für die Bewahrung eines Naturreservates. Ich habe Feinde.“
„Wer Feinde hat, hat auch ein Motiv?“
„Ich soll den da …?“, entrüstete Reinold sich. „… und die Leiche zu den Fischen? Wissen Sie eigentlich wie wertvoll diese Kois sind?“
Der Polizist guckte Reinold an, als wollte er eine Nervenheilanstalt benachrichtigen. Stattdessen fragte er: „Kennen Sie den Toten?“
„Nein“, sagte Reinold.
Gabriele schüttelte den Kopf.
„Keine Ahnung“, sagte Trappke. „Kann ich gehen?“ Er sah ängstlich aus.
„Sicher“, sagte der Beamte. Dann zu Reinold Maaß „Lassen Sie alles wie es ist. Auch die Terrassentür. Die Spurensicherung ist schon unterwegs. Melden Sie sich heute noch auf dem Polizeirevier, um das Protokoll aufzunehmen.“ Er winkte seinem Kollegen. „Wir befragen die Nachbarn. Vielleicht ist ja jemandem etwas aufgefallen.“
„Viel Glück“, sagte Reinold.
„Wieso?“
„Sie sprechen die falsche Sprache.“
Auf der Straße vor dem Haus hatte sich, trotz des frühen Morgens, eine neugierige Menschenmenge eingefunden. Die Beamten schauten auf Kopftücher und in dunkle Augen. Dann schauten sie sich an und sagten übereinstimmend: „Botschaft angekommen. Hauen wir ab.“
*
Er kam zu spät. Normalerweise stand er zehn Minuten vor Bürobeginn um sieben Uhr vor dem Parkhaus, um einen guten Stellplatz zu ergattern. Heute musste er auf der Straße parken und kam abgehetzt im Büro an. Die Büroräume waren leer. War schon Wochenende? Die Ereignisse des Morgens hatten Reinolds ansonsten sturen Zeitabläufe durcheinandergebracht. Er schwitzte. Er fühlte sich elend, lief von Büro zu Büro. Sie waren aufgeschlossen, also musste jemand anwesend sein.
Ich muss mich abkühlen, dachte Reinold und stürmte den Waschraum. Im Spiegel sah er sein hochrotes erhitztes Gesicht über das Schweißperlen rannen. Haarsträhnen klebten auf der Stirn. Auf keinen Fall darf die Meute da draußen mich so sehen. Er ging zum Waschbecken.
Er hatte die Tür nicht gehört. Plötzlich stand Susanne Klein, die Praktikantin, neben ihm.
„Du siehst heiß aus, Reini.“ Ihr Blick hatte etwas Irres. „Mach’s mir“, stieß sie hervor. Ihr Spitzenhöschen rutschte die nackten Beine entlang und wurde nur von den hochhackigen Schuhen aufgehalten. Susanne hob den Rock hoch und legte ihren Oberkörper auf die Ablage neben dem Waschbecken.
Reinold starrte auf den nackten, straffen Po, den ihm die junge Frau auffordernd hinhielt. Evas Apfel.
„Mann, Reini, fang an. Ich brauch’s jetzt. Jetzt!“
Sie bot sich ihm dar, wie Gabriele sich ihm in 25 Ehejahren nie gezeigt hatte. Die Frage, warum eine Neunzehnjährige ihn aus heiterem Himmel zum Geschlechtsakt aufforderte, schaffte es nicht in die linke Gehirnhälfte. Er reagierte triebgesteuert. Es dauerte etwas, bis seine fahrigen Finger den Reisverschluss der Hose heruntergezogen hatten. Er stellte sich hinter Susanne. Die Position, die sie ihm bot, war ihm fremd. Er sah auf den weißen Stringtanga, der um ihre Knöchel hing. „Soll ich…also vaginal oder…? Er konnte es nicht aussprechen.
„Ist mir egal, du Schlappschwanz, fang endlich an.“
Das demütigende Wort erzeugte das Gegenteil und Reinolds Blut schoss dahin, wo es gebraucht wurde. Er fummelte noch etwas unsicher herum, bis er in Susannes Lustgarten eindrang.
Reinold sah aus halb geschlossenen Augen sein Gesicht im Spiegel. Ein fremdes Gesicht, über das Schweißbäche flossen und dem der weit offen stehende Mund ein blödes Aussehen verlieh. Er sah, wie sich dieses Gesicht im Rhythmus des Aktes spiegelte. Vorstieß und zurückschnellte. Anfangs langsam, dann schneller und schneller. Er stöhnte in dieses blöde Gesicht. Er spürte, wie seine Lenden gegen die festen Pobacken schlugen, immer härter und heftiger. Dann entrang sich ihm ein Urschrei und er sackte über Susanne zusammen.
Susanne rammte ihm den Ellenbogen in die Rippen und stieß ihn von sich weg.
Undeutlich nahm Reinold wahr, wie sie ihr Höschen hochzog und in einer der Toilettenkabinen verschwand. Er hörte, wie sie Unmengen von Klopapier abriss. Sie wischt mich weg, dachte er und der Rausch verflog. Reinold zog seine Hose hoch und zurrte den Reisverschluss fest. Er wusch sich die Hände, formte sie wie ein Gefäß, in dem sich kaltes Wasser sammelte, in das er ein paar Mal sein Gesicht tauchte. Nachdem er sich mit den Papierhandtüchern abgetrocknet hatte, hielt er seinen Kopf unter den Luftstrom des Händetrockners und verrenkte sich fast, als er versuchte, seine Haare zu trocknen und sie einigermaßen ordentlich zu kämmen. Während der ganzen Zeit hörte er immer wieder mal das Abreißen von Klopapier und die Toilettenspülung. Reinold überzeugte sich mit einem Blick in den Spiegel, dass er vorzeigbar war. Sein Verstand sprang wieder in den Modus des nüchternen Denkens. Er hatte es mit einer Neunzehnjährigen getrieben. Sie hätte seine Tochter sein können und er hatte sie geknallt. Markus hatte das Wort gebraucht und er fand es abscheulich und er verabscheute sich selbst. Was tun? Gleich kam sie aus der Kabine und er musste ein paar freundliche Worte finden. Ja, ihr zeigen, dass er sie achtete. Ich werde sie zu einem Kaffee einladen oder in die Eisdiele, überlegte Reinold. Dort können wir in aller Ruhe darüber sprechen, was gerade passiert ist und … ihm wurde flau, als er sich vorstellte, Gabriele könnte davon erfahren.
Susanne hatte ihre Reinigungsprozedur beendet, kam aus dem Klo und wusch sich die Hände. Sie warf die Papierhandtücher sorglos neben das Waschbecken, nahm den Kaugummi aus dem Mund, auf dem sie die ganze Zeit herumgekaut hatte und pappte ihn an den Spiegel.
Reinold räusperte sich. „Fräulein…äh Frau Susanne, ich habe mir überlegt, dass wir uns zusammensetzen, ganz ungezwungen. Café oder Eisdiele, und uns unterhalten, ruhig und erwachsen, wie wir mit dieser Situation nun ähm in Zukunft umgehen sollen.“
Susanne taxierte ihn, als sei er eins der Silberfischchen, die sich gerne in Nassräumen aufhalten. „Was quatscht du denn für’n Scheiß, Alter. Verkneif dir bloß komische Gedanken. Ich hätte auch jeden anderen genommen, der gerade greifbar gewesen wäre. Nach dem, was ich heute früh gesehen habe, musste ich mich einfach abreagieren. Vergiss den kurzen Fick mal ganz schnell, Reini.“ Die Tür schlug laut hinter ihr zu.
Nach einer Weile der Erstarrung, schaltete Reinolds Überlebensmechanismus ein und er begann aufzuräumen. Er entsorgte die zusammengeknüllten Papiertücher im Abfalleimer und benutzte eines, um den Kaugummi vom Spiegel zu lösen.
Er schrak zusammen, als plötzlich eine Frauenstimme hinter ihm sagte: „Herr Maaß, schämen sie sich.“
„Weshalb“, Reinold wirbelte herum und stand Frau Finke, der Sekretärin, gegenüber.
„Sie befinden sich auf der Damentoilette. Beobachten Sie heimlich?“ Frau Finkes mageres Gesicht schien nur aus Kanten, Ecken und Abgründen zu bestehen.
„Was? Ich? Nein, nein, ich mach hier sauber.“
Frau Finkes Gesicht wurde noch abgründiger.
„Entschuldigen Sie“, Reinold hatte sich wieder im Griff, „ich bin heute spät dran und in der Eile ist mir gar nicht aufgefallen, wo ich hin…nun ja, es war dringend.“
Frau Finke atmete langsam Empörung aus. „Wir warten seit einer halben Stunde auf Sie. Im Konferenzraum. Mit all diesem Grässlichen…“ Ihre Gesichtsfarbe wurde gelblich. „Gehen Sie! Machen Sie dem ein Ende. Obwohl, im Grunde sind Sie ein anständiger Kerl und haben so etwas nicht verdient.“
„Was habe ich nicht verdient?“ Reinolds Magen gewann gerade die Goldmedaille in der Disziplin Barrenturnen.
„Geh…Ge…Sie.“ Frau Finke schoss auf eine der Toilettenkabinen zu.
*
Mit weichen Knien ging Reinold den Flur entlang zum Konferenzraum.
Er hörte die anmaßende Stimme von Henning Bulthaupt. „Unser Idealist verspätet sich, weil er gerade einem Frosch über die Straße hilft.“ Hämisches Lachen.
Reinold stieß die Tür zum Konferenzraum energisch auf. Tatsächlich waren hier alle versammelt, die lieben Kollegen und Kolleginnen. Vor jedem lag ein geschlossener Ringordner. In einer Sache war er sich ganz sicher, sie würden ihn nicht schwach sehen. Egal, was passierte.
Er setzte sich an seinen Platz und betrachtete gedankenverloren den schwarz-weiß marmorierten Deckel seines Ordners. Es musste eine außerordentliche Sitzung sein. Er hatte alle Dienstbesprechungen in seinem Kalender eingetragen.
Reinold sah hoch. Ihm gegenüber saß Bulthaupt, dessen Blicke ihn trafen wie die Scheinwerfer eines 40-Tonners den Igel auf der nächtlichen A1. Einrollen zwecklos. Ohne Zweifel lag unter dem Pappdeckel das Versetzungsschreiben. Man würde ihn irgendwohin befördern, in ein Dorf auf einen unbedeutenden Posten mit herabgestuftem Einkommen. Er sah die Scheidungspapiere vor sich, die Gabriele ihm reichte.
Reinold linste zwischen die Pappdeckel und wunderte sich, dass der Aktenordner, der normalerweise für das Abheften großer Mengen Blätter benutzt wurde, anscheinend nur ein einziges Blatt enthielt, von dem ein unangenehmer Geruch ausging.
Kurze Unruhe durch Frau Finkes Eintreten, die sich auf den freien Stuhl setzte.
Reinold schaute in die Runde, in die vertrauten Gesichter der Mitarbeiter, die, sehr blass, doch konzentriert und gleichzeitig gierig jeder seiner Bewegungen folgten. Das war Mobbing pur. Kein Gespräch unter vier Augen mit seinem Vorgesetzten, sondern im Kreis der Kollegen, sollte er die Demütigung erfahren. Wie waren sie an das Schreiben gekommen. Er verdächtigte Bulthaupt, seinen schärfsten Widersacher, der diese Show inszenierte. Aber Reinold war gewappnet. Schließlich rechnete er schon lange damit, erst recht, seit er Lohmanns Gutachten unterstützte. Eine Art inneres Rückgrat straffte sich, hielt ihn aufrecht. Ruhig und gefasst würde er seine Versetzung zur Kenntnis nehmen und keiner dieser Hyänen die Freude bereiten, ihn am Boden zerstört zu sehen. Als er den Deckel des Ordners aufschlagen wollte, betrat Amtsleiter Bertold Kirschner den Raum und nahm seinen Platz am Kopfende des Tisches ein. Er nickte Reinold zu:
„Freut mich, dass Sie es noch geschafft haben, Herr Maaß“.
Ein einziges Mal war Reinold zu spät. Die süffisante Rüge kränkte ihn. Er wischte sich Schweißtropfen aus dem Nacken, wischte die Hand an seiner grauen Hose ab, wo dunkle Schlieren zurückblieben.
„Öffnen Sie endlich Ihren Ordner. Wir sind alle sehr gespannt.“
Auch Kirschner? Er beteiligte sich an dieser schäbigen Bloßstellung? Entschlossen schlug Reinold den Ordner auf. Zwei Augäpfel starrten ihn an.
Das ging weit über Mobbing hinaus. An die Stelle der Angst quartierte sich Wut ein.
„Was hast du?“, kreischte Susanne los.
„Eine Unverschämtheit“, reagierte Reinold entrüstet.
„Ich habe ein Ohr, das rechte“, fiel Frau Finke ein.
„Ich das linke“, komplettierte Sachbearbeiter Busch.
„Mir hat man die Nase verpasst“, grinste Bulthaupt.
„Lippen, halbgeöffnet. Dazwischen steht etwas.“ Sachbearbeiterin Frau Richter wandte sich angewidert ab, senkte den Kopf, magisch angezogen vom blaugesprenkelten Linoleum.
„Ich, ich…“, schrillte Susanne, „habe Haut, exakt in den Maßen einer DIN-A 4 Seite, mit einem Tattoo, ein Salamander.“ Das Zwischenspiel im Waschraum hatte nicht ausgereicht. Susannes Erregungskurve jagte auf den Höhepunkt zu.
Reinold wurde bleich. „Was geht hier vor?“ Misstrauisch beobachtete er seine Kollegen.
Susanne begann hysterisch zu kichern. „Hat vielleicht jemand“, sie schnappte nach Luft, „hat einer von euch seine wertvollsten Teile erhalten.“ Erhitzt und überdreht war sie nahe im Bereich einer Kernschmelze.
„Ich.“ Amtsleiter Kirschner sah aus wie sein eigener Gipsabdruck. Er atmete tief durch und schlug den Aktendeckel auf. „Klöten und Hansemann“.
Reinold spürte eine quälende Enge im Hals. „Was soll der Mist“, verlor er die Beherrschung. „Wenn Sie mir, Herr Kirschner, etwas mitteilen wollen, dann reden Sie mit mir wie ein Erwachsener. Das hier ist eine schlechte Einleitung.“
„Heute früh“, erklärte Bertold Kirschner, „passte ein Kurier mich unten am Eingang ab und überreichte mir ein Paket, an mich adressiert. Absender: Hans Lohmann. Ich öffnete es in meinem Büro und sah eine Anzahl von Ordnern, auf denen jeweils der Name unserer Mitarbeiter stand. Die Aktendeckel wurden durch ein breites Band zusammengehalten. Ich dachte mir nichts dabei, weil ich überzeugt war, dass Lohmann endlich vernünftig geworden war und uns eine Modifikation seines Gutachtens schickte. Also setzte ich eine sofortige Besprechung an. Dann der Schock nach dem Öffnen der Ordner. Bevor ich die Polizei einschalte, wollte ich, dass Sie Herr Maaß, sich diese Schweinerei ansehen und Ihre Position nochmals überdenken.“
„Wir sollten Hans Lohmann kontaktieren.“ Reinold hatte ihm bei seinem Gutachten zugunsten des Naturschutzes den Rücken gestärkt, indem er sich weigerte, das Planungsverfahren für die Industriebrache, das nur Politik und die beteiligten Unternehmen glücklich machen würde, mitzutragen und hatte gedroht, interne Mauscheleien der Presse zuzuspielen, und dass trotz der Drohbriefe, die daraufhin beide, er und Lohmann, erhielten.
„Sie wollen Lohmann kontaktieren? Sprechen Sie in Ihren Ordner!“ Bulthaupt platzte los. Lachte, sein herrisches, niedermachendes Lachen.
„Ich darf doch bitten.“ Kirschner schippte den Füllfederhalter mit echter Goldfeder von einer Hand in die andere. „Herr Maaß“, seine Stimme wurde rau, „Hans Lohmann ist unter uns, zumindest in Teilen, und die sind ordentlich abgeheftet. Und jedes Teil ist mit einer Warnung versehen.“
Reinold starrte auf die Augen. Darunter stand: ‚Umweltschutz macht blind‘. Er schüttelte den Kopf. „Das ist niemals Lohmann.“ Doch in seinem Hinterkopf hämmerte es. Sein Mitstreiter hatte ein Salamander-Tattoo. Es ist unecht. Reinold rang innerlich um Fassung. Die wollten sie in die Irre führen.
Susanne blickte zu Kirschners Ordner rüber, wo auf einer DIN-A4-Rautenseite zwei – aufgrund der groben Behandlung – verschrumpelte Hoden und ein schlapper kleiner Penis aufgeklebt waren. „Das ist Lohmann“, krähte sie fröhlich.
Kirschner sah aus, als wollte er ihr eine runterhauen. „Beherrschen Sie sich, Frau Klein.“ Dann ergänzte er: „Mein Statement lautet: ‚Umweltschutz macht impotent‘.“
„Lässt einen aus der Haut fahren“, kreischte Susanne.
„Macht sprachlos“, gab Frau Richter die Drohung an sie bekannt.
„Taub.“ Frau Finke und Herr Busch im Duett.
„Stinkt“, grinste Bulthaupt. „Dem stimme ich zu.“
„Wenn man Sie gefesselt in eine Jauchegrube wirft, ändern Sie vielleicht Ihre Meinung.“ Kirschner ähnelte jetzt optisch dem Blitze schleudernden Zeus.
Reinold ereifert sich erneut. „Darauf fallt ihr herein. Vielleicht hat man ihn entführt. Die Teile gehören zu einer Leiche, die irgendjemand aus der Pathologie besorgt hat.“
„Irgendjemand?“ Kirschner zog zweifelnd die Augenbrauen hoch.
„Die haben ihre Leute doch überall“, verteidigte Reinold seine Theorie. „Eine abgefertigte Leiche im Sarg, ins Krematorium. Wem würde es auffallen, wenn ein wenig abgeschnippelt worden ist. Für den richtigen Preis bekommt man immer jemanden der das macht.“
„Ich denke“, sagte Kirschner ruhig, „eine DNA-Analyse wird klären, wen – er zögerte – oder was wir da vor uns haben. Ich bin überzeugt es ist Lohmann und eine knallharte Drohung an uns alle. Verflucht noch mal, Maaß, ändern Sie Ihre Meinung. Das sind die dämlichen Frösche nicht wert und wenn Lohmann tatsächlich tot ist, gibt es sowieso ein neues Gutachten.“
„Frösche und Kröten, darunter vor allem die Bombina variegata, die Gelbbauchunke, sind stark gefährdet. Zersiedelung, Straßenbau, Landwirtschaft tragen dazu bei, dass Amphibien bald ausgestorben sind, wenn wir nicht Schutzräume erhalten.“ Reinold rezitierte mit leeren Augen.
„Bislang hat auf dem Gelände, das Sie schützen wollen, noch keiner die Viecher gesichtet“, argumentierte Kirschner. „Bis auf ein paar abgedrehte Naturfuzzis.“
„Ich habe Bilder. Die Naturschützer haben die seltenen Amphibien dokumentiert.“ Reinolds Blick schweifte in die Ferne, in ein Land der Gerechtigkeit.
„Seien Sie vernünftig, Herr Maaß. Reinold“, Kirschner sprach wie ein Kinderpsychologe mit seinem kleinen Patienten. „Geben Sie grünes Licht. Dienen Sie dem Gemeinwohl.“ „Gemeinwohl? Unfug. Einige Leute machen unter dem Deckmantel Landesgartenschau eine Menge Kohle und schrecken vor geschmacklosen Drohungen nicht zurück?“
Kirschner schippte den Füllfederhalter wieder von einer Hand in die andere. Immer schneller, bis er im hohen Bogen über das Ziel hinausflog, auf dem Boden landete und zerbrach, Tinte lief aus.
Betroffen sahen die Angestellten auf ihren Amtsleiter.
„Von welchen Leuten reden wir hier eigentlich?“ Bertold Kirschner sprach leise. „Wir kennen die Beteiligten am Parkausbau. Ich traue keinem einen Mord zu. Wer also agiert hier?“
Stille. Hypnotisiert starrten sie auf die Leichenteile. Nur Bulthaupt gackerte. „Hey, lasst euch nicht ins Bockshorn jagen. Thats Entertainment.“
Kirschner brachte ihn mit einem Blick, der dem Todesstern ähnelte, zum Schweigen.
„Kann ich euch sagen“, polterte Reinold los. „Ich weiß, dass bei den Ausschreibungen Bestechungsgelder geflossen sind. Die Stadt scheffelt Millionen. Wird das Gebiet unter Naturschutz gestellt, wird auch der Geldhahn zugedreht. Wundert mich nicht, wenn einige die Nerven verlieren.“
Kirschner räusperte sich mehrmals. „Vor fünf Tagen fiel Lohmann in mein Büro ein. Ich hätte nicht gedacht, dass unser braver Hans dermaßen in Rage geraten könnte. Er hielt mir sein Handy wie einen Siegespokal entgegen und wütete: ‚Ich habe ein Gespräch aufgenommen. Ein Beweis für schmutzige Geschäfte die das Biotop bedrohen. Ich werde diese Geier abschießen.‘ Sagte es und tobte davon.“
Niemand im Raum bemerkte, dass Bulthaupts Gesicht leichenblass geworden war.
„Herr Maaß, wissen Sie, von welchem Beweis er gesprochen haben könnte?“ Kirschners Stressfaktor stand plastisch im Raum.
„Hans hat mich nicht eingeweiht.“ Reinold trotzte. Dann herausfordernd: „Wer plant was?“
Kirschner zuckte die Schultern. „Dazu hat Lohmann sich leider nicht geäußert. Nach Öffnen der Ordner hatte ich versucht, Hans anzurufen. Vergeblich. Nicht einmal die Mailbox. Sein Handy ist deaktiviert. Daraufhin hatte ich keine Zweifel mehr, dass er sich mit skrupellosen Leuten angelegt hatte. So etwas jedoch“, Kirschner tippte auf den abgehefteten Penis, „hatte ich nicht erwartet.“
„Mich kriegen die nicht klein!“, brüllte Reinold los. Er schoss hoch, stand stramm und hätte fast salutiert.
„Sie sind eine Gefahr für uns alle.“ Die Sorgenfalte auf Kirschners Stirn wurde steiler. „Wir wissen nicht, mit wem wir es zu tun haben.“
Reinold sackte auf den Stuhl zurück. „Gott sei Dank, entscheide ich nicht alleine“, wehrte er ab. „Inzwischen ist ein Umweltverband aktiv geworden, um die radikale Sanierung zu stoppen. Sie stützen sich auf Lohmanns Gutachten und mein Wort, dass Lurche dort laichen.“
„Dann werden wir dafür sorgen, dass man kein einziges Tierchen dort finden wird.“ In Kirschners Augen glänzte Jagdfieber.
Reinold sah ihn traurig an. „Sie wollen, dass die gewinnen?“
„Reinold!“ Kirschner flehte mit gefalteten Händen. „Es muss um etwas Größeres gehen als ein politisches Zuckerle für die Bürger. Ich fürchte, kapitalträchtige, möglicherweise ausländische Investoren mischen plötzlich mit. Und das Kapital gewinnt immer. Wollen Sie der nächste sein, dessen Teile wir im Aktenschrank finden?“
Susanne prustete los. „In dem Fall stünde unser Hans nicht so schlecht da. Wir könnten die Schniedels ja rahmen und an die Wand…“
Es klatschte links und rechts auf Susannes Wangen und auf der schlagartig bleich gewordenen Haut zeichneten sich Kirschners kräftige Finger ab.
Susanne sackte zusammen, die blonde Mähne verdeckte das Gesicht. Sie schluchzte hemmungslos, es schüttelte sie durch und durch.
„Außer der Polizei benötigen wir anscheinend auch einen Arzt“, sagte Kirschner, sah ärgerlich auf sein Opfer und rief in der Polizeizentrale an.
*
Polizisten sammelten die Corpora Delicti ein und brachten sie ins Labor. Die Büroräume wurden gesperrt und zum Spielfeld der Kriminaltechniker. Kirschners Team war nach ersten Befragungen entlassen worden. Susanne hatte eine Beruhigungsspritze bekommen und Bulthaupt fuhr sie, ganz grinsende Fürsorge, nach Hause.
Lohmanns Handy war so tot wie aller Wahrscheinlichkeit nach sein Besitzer. Wie man herausfand, lebte er allein. Ein Ermittlertrupp machte sich auf den Weg zu seinem Haus.
Zwei Streifenwagen, Polizisten in Uniform und ein hochgewachsener Mann mit langen, schwarzen Haaren in zivil, schreckten Hans Lohmanns Nachbarn auf. Einige begnügten sich damit, die Fenster zu öffnen und hinauszuschauen. Rentner, Hausfrauen, neben denen die glückstrahlenden Gesichter von Kindern auftauchten.
Victor Kranski erfasste alle mit schnellem Blick. Er registrierte das Fenster, vor dem sich die Gardine leicht bewegte und der Neugierde nur einen schmalen Spalt gönnte. Einzig ein älteres Paar war vor die Haustür getreten und stand nun am Gartenzaun. Victors Opfer. Rasch ging er auf sie zu, nannte seinen Namen und wies sich aus.
Der Mann, klein, füllig mit roten Pausbäckchen und seine Frau, hippelig, graugesichtig unter weißem Haar, sahen ihn erwartungsvoll an.
Kranski: „Haben Sie in letzter Zeit irgendetwas Ungewöhnliches beobachtet? Fremde, die um Herrn Lohmanns Haus herumschlichen. Oder ein unbekanntes Auto, das auffällig lange in der Nähe parkte?“
Der ältere Herr: „Was’n los?“
Seine Frau: „Was’n?“
Kranski überlief ein Schauer. Die Stimme der Frau traf ihn wie das Sprechformat eines Papageis.
„Tja“, er räusperte sich, „Ihr Nachbar Hans Lohmann ist…ähm…schwierig zu sagen…teilweise verschwunden.“
Der ältere Herr: „Entführt?“
Seine Frau: „Entführt?“
Kranski: „Möglich. Unter anderem. Könnten Sie sich eine Entführung vorstellen? Hegen Sie irgendeinen Verdacht?“
Der ältere Herr: „Der Lohmann. So’n Überkorrekter.“
Seine Frau: „So’n Überkorrekter.“
Der ältere Herr: „Vorne hui, hinten pfui.“
„Pfui!“
„Könnten Sie das detaillierter erläutern?“ Victor Kranski würgte Ungeduld.
Wechselseitiger Dialog des Ehepaares.
„Der Vorgarten picobello. Aber hinten, die reine Wildnis. Eine Schande.“
„Eine Schande!“
„Ehrlich gesagt“, Kranski begann gefährlich zu knurren, „Lohmanns gärtnerischer Geschmack interessiert mich einen Scheiß. Ich will wissen, ob Sie so etwas wie eine Bedrohung seiner Person ausgemacht haben?“
„Junger Mann, Sie haben keine Ahnung.“
„Keine Ahnung.“
„Ach was.“
„Wenn Unkraut und Brennnessel rüberwachsen, ist das bedrohlich.“
„Also aus den Brennnesseln kann man eins a Tee machen.“
Victor starrte irritiert auf die Frau, die das erste Mal einen ganzen Satz hervorbrachte, der eine eigenständige Semantik enthielt.
Kranskis Hand glitt zum Pistolengriff der Walther, die im Hosenbund steckte. Es beruhigte ihn.
Dann legte der ältere Herr los. „Der Lohmann, so’n Sturkopf. Konnte kaum grüßen. Richtiger Korinthenkacker…“
„Korinthenkacker!“
„…und immer allein. Komischer Vogel…“
„Vogel.“
„…würde mich nicht wundern, wenn es sich der mit allen verdorben hätte.“ Der ältere Herr beugte sich über den Gartenzaun zu Kranski und zwinkerte ihm zu. „Gutachter. Na, weiß man doch, wat dat für ‘ne Mischpoke ist.“
„Mischpoke.“
„Hat sich schmieren lassen oder ist den Großkopferten auf die Zehen getreten, der Tausendprozentige, der.“
„Schmieriger Tausendprozentiger.“ Jedes Mal, wenn die Frau etwas wiederholte, reckte sie den Kopf auf dem dünnen Hals nach vorne und nickte.
Kranski holte tief Luft und fragte: „Hat er Ihnen mal von seiner Arbeit erzählt? Oder wem er auf die Zehen tritt?“
Der ältere Herr: „Der und reden. Kein Wort hat der mit uns gesprochen. Immer fix rinn ins Auto und ab.“
„Fix ins Auto und ab.“
Pause.
Die Beiden sahen Kranski an, als könnte er den wundersamen Lohmann enträtseln.