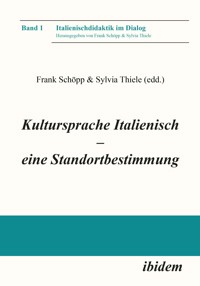
Kultursprache Italienisch – eine Standortbestimmung E-Book
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Fremdsprachen
- Serie: Italienischdidaktik im Dialog
- Sprache: Deutsch
Der vorliegende Band, der erste der neu gegründeten Reihe Italienischdidaktik im Dialog (IDD), vereint 17 Beiträge, die aus Vorträgen zweier Tagungen hervorgegangen sind: Standortbestimmungen und Perspektiven des Italienischunterrichts an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg im November 2016 sowie, genau ein Jahr später: Quo vadis, italiano? – Wege der Sprache, der Kultur und der Italianistik an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Ziel beider Veranstaltungen war es, die Kultursprache Italienisch unter verschiedenen didaktisch-methodischen Fragestellungen zu beleuchten und damit einen Beitrag zur ihrer Sichtbarmachung im Kontext der universitären Romanistik und des schulischen Fremdsprachenunterrichts zu leisten. Zwar ist das Italienische die kleinste der drei romanischen Schulfremdsprachen, die hier versammelten Beiträge von Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Italien und Österreich belegen jedoch eindrucksvoll seine Lebendigkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort der Herausgeber
Vorwort
Individualisiertes Lernen mit einer Ganzschrift im fortgeschrittenen Italienischunterricht am Beispiel von Alessandro Bariccos Novecento
LehrerInnenbildung NEU: storie transculturali nella didattica della letteratura di lingua straniera
1. “Was lernt man, wenn man Sprachen lernt?” (Krumm 2009, 104)
2. Scelta dei testi
3. Competenza visiva e didattica delle immagini: proposte applicative
4. Attivare il discorso comunicativo transculturale nella classe di lingua straniera
5. Conclusioni e prospettive
Riferimenti bibliografici
Scoprire la commedia settecentesca. Un progetto interdisciplinare per promuovere un lavoro creativo e orientato all’azione con testi letterari nella lezione d’italiano LS
1. Alcune osservazioni sull’insegnamento dell’italiano come lingua straniera in Austria e in Germania
2. Il ruolo dei testi letterari nella lezione d’italiano come lingua straniera
3. Perché lavorare con testi letterari in generale e teatrali in particolare?
4. Scopi e svolgimento del progetto
5. Risultati del progetto: unità didattiche concrete
6. Conclusione
Riferimenti bibliografici
Bianco, rosso e… giallo. Unità didattica per alunni principianti
1. Il genere giallo nell’insegnamento dell’italiano
2. Obiettivi, competenze e schema del lavoro
Riferimenti bibliografici
Die kommunikativen Kompetenzen Schreiben und Sprechen – Trainingsmöglichkeiten mit Stefano Bennis Il bar sotto il mare
Bibliographie
Mit Gianni Rodaris Grammatica della fantasia (1973) kreative Schreibprozesse bei Schülerinnen und Schülern anregen
0. Einleitung
1. Die Anforderungen des baden-württembergischen Bildungsplans
2. Funktionen des Schreibens
3. Definition von „Kreativität“
4. Methoden kreativen Schreibens
5. Kreatives Schreiben in Gianni Rodaris Grammatica della fantasia
6. Fazit
Bibliographie
Förderung des Fremdverstehens und eines reflexiven Film-Rezeptionsverhaltens mit Alla luce del sole von Roberto Faenza im Italienischunterricht für Fortgeschrittene
1. Vorbemerkungen
2. Überblick über den Spielfilm
3. Methodisches Vorgehen im Unterricht
4. Schlussbemerkungen
Bibliographie
„Gli stili comunicativi – un paragone interculturale tra l’Italia e la Germania“. Eine Unterrichtseinheit für die Kursstufe Italienisch
1. Einleitung
2. Unterrichtsplanung
3. Abschließende Bemerkungen
Bibliographie
Material
Mündliche Sprachmittlungssituationen vor dem Hintergrund der besonderen Rolle der Mittelnden
Einleitung
Der Einfluss zwischenmenschlicher Beziehungen auf Sprachmittlungen
Scaffolding als Strukturierungshilfe bei Sprachmittlungsaufgaben
Bibliographie
Einsatz der Web-2.0-Werkzeuge bubbl.us und ThingLink im Italienischunterricht der ersten Lernjahre
1. Einführung
2. Brainstorming und Mindmapping mit bubbl.us
3. Text- und Bildarbeit mit ThingLink
4. Fazit
Bibliographie
Creare una mappa concettuale – Lo sport
Analizzare una mappa concettuale – Lo sport
Compito: Va’ in giro e fa’ degli appunti sulle altre mappe concettuali. Sottolinea qualche parola che vuoi aggiungere alla tua mappa.
Thinglink – presentare una città italiana in modo interattivo
Evaluazione delle immagini interattive
Vorwort
Die Italoromania als Bild der gesamten Romania
Bibliographie
O così o Pomì: Zum Nutzen der Beschäftigung mit Werbesprache im Italienischunterricht
1. Einleitung
2. Die Verortung der Werbesprache im Lehrplan (Rheinland-Pfalz)
3. Markennamen als werbesprachlicher Mikrokosmos
4. Schlusswort
Bibliographie
Italienisch als neu einsetzende Fremdsprache im Lehramts-
1. Einleitung
2. Exkurs: Begriffsbestimmungen zur Verdeutlichung der Argumentation
3. Projektidee
4. Ausblick
Bibliographie
Ein Versuch zur Didaktisierung einer ladinischen Schulgrammatik
1. Einleitung
2. Das ladinische Schulsystem als mehrsprachiges Modell
3. Der soziolinguistische Kontext des Ladinischen in Südtirol
4. Ein Vorschlag zum mehrsprachigen Grammatikunterricht für das Ladinische
5. Wie kann mehrsprachiges Lehrmaterial den Erwerb der Erstsprache verstärken?
6. Schlussbemerkungen
Bibliographie
Verso l’italiano: testi semicolti in contesto migratorio
1. Brevemente sull’italiano popolare
2. La conquista della scrittura in contesti migratori
3. Una lingua in bilico (dal corpus MeTrOpolis)
4. La lingua che si arrampica: una testualità oralizzante
Riferimenti bibliografici
L’Italia al lavoro: Generazione 1000 € Strategie didattiche per l’insegnamento dell’italiano a scuola e all’università
1. Introduzione
2. Dalla teoria alla pratica
Riferimenti bibliografici
“Salsicce” in salsa postcoloniale. La riscrittura della Commedia all’italiana in un racconto di Igiaba Scego
Premessa
2. La finzione autobiografica
3. Il discorso identitario
4. L’intertesto cinematografico
5. Osservazioni conclusive
Riferimenti bibliografici
Emailadressen
Reihe
Impressum
ibidem-Verlag, Stuttgart
Vorwort der Herausgeber
Die Schriftenreihe Italienischdidaktik im Dialog (IDD) möchte eine Plattform für Publikationen zum Italienischen als Fremdsprache bieten, da es in Deutschland bisher keine Fachzeitschrift gibt, die sich ausschließlich dem Erlernen des Italienischen als Fremdsprache widmet. Alle am Italienischunterricht Interessierten und Beteiligten, also Studierende, Referendarinnen und Referendare, Lehrkräfte, Ausbilderinnen und Ausbilder der 2. Phase der Lehrerbildung und Lehrende an Hochschulen, müssen in der Regel bei der Suche nach Fachliteratur mit viel Aufwand Beiträge von den verschiedensten Publikationsmedien und -orten zusammentragen. IDD kann diese Recherche erleichtern.
In der Reihe sollen Tagungsbände, Sammelbände und Monographien zum Italienischunterricht sowie zur italienischen Sprache, Literatur und Kultur erscheinen können. Der durch die Reihe intendierte Dialog kann der engeren Vernetzung der ersten und zweiten Phase der Lehrerausbildung ebenso dienen wie dem Austausch zwischen universitärer Fachdidaktik und den Lehrkräften an den verschiedenen Schulformen. In Bezug auf die Lernendenzahlen an allgemeinbildenden Schulen und Universitäten liegt das Italienische zwar hinter seinen romanischen Schwestersprachen Französisch und Spanisch, als eine der bedeutendsten Kultursprachen Europas verdient es jedoch nachhaltige Unterstützung.
Italienischdidaktik im Dialog reiht sich in die Schriftenreihen Romanische Sprachen und ihre Didaktik sowie Französischdidaktik im Dialog ein, die der Zeitschrift Romanische Sprachen und ihre Didaktik angegliedert sind. Auch diese Reihe erscheint im corporate design, der türkisfarbene Streifen auf dem Cover konnotiert die Farbe des Mittelmeers, die das Zielsprachenland in weiten Teilen umgibt.
Um den Facettenreichtum der Kultursprache Italienisch zu beleuchten, Forschungsergebnisse sowie methodisch-didaktische Vorschläge im Kontext der Italianistik und Italienisch als Fremdsprache zu präsentieren und eine Standortbestimmung vorzunehmen, werden im vorliegenden, ersten Band dieser Reihe Beiträge zweier Tagungen publiziert: „Standortbestimmung und Perspektiven des Italienischunterrichts“, 11. und 12. November 2016, Julius-Maximilians-Universität Würzburg sowie „Quo vadis, italiano? – Wege der Sprache, der Kultur und der Italianistik“, 16. und 17. November 2017, Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
FRANK SCHÖPP (WÜRZBURG) & SYLVIA THIELE (MAINZ)
Vorwort
Am 11. und 12. November 2016 fand an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg die 1. Würzburger Tagung zur Fachdidaktik des Italienischen statt, die den Titel „Standortbestimmung und Perspektiven des Italienischunterrichts“ trug. Ziel dieser Veranstaltung war es, eine stärkere Vernetzung aller am Italienischunterricht Beteiligten anzubahnen. Dementsprechend waren Ausbilderinnen und Ausbilder an Studienseminaren, Lehrkräfte im Schuldienst sowie universitäre Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktiker aufgerufen, sich mit einem Vortrag an der Tagung zu beteiligen. Von den zwölf Vortragenden haben sich zehn bereit erklärt, ihren Beitrag zu verschriftlichen und ihn damit einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Diese zehn Aufsätze bilden den ersten Teil des vorliegenden Sammelbandes. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die in stetigem Wandel begriffenen Rahmenbedingungen des Italienischunterrichts sowie dessen Schwerpunkte eine weitaus geringere Diskussion in Form von Publikationen erfahren als dies in den anderen modernen Schulfremdsprachen der Fall ist, ist diese Bereitschaft besonders positiv zu bewerten, erlaubt sie doch allen am Italienischunterricht Interessierten, die Texte in einem Band nachzulesen – zudem noch erweitert um die Beiträge der Mainzer Arbeitstagung „Quo vadis, italiano? – Wege der Sprache, der Kultur und der Italianistik“, die fast genau ein Jahr später stattfand. Tatsächlich gibt es für die Praxis des schulischen Italienischunterrichts kein Publikationsorgan, während für den Englisch-, den Französisch-, den Spanisch- und den Russischunterricht sprachbezogene Fachzeitschriften existieren. Der Grund dafür liegt natürlich in der zahlenmäßigen Bedeutung des Fachs Italienisch, das im Schuljahr 2017/18 von 47.972 Schülerinnen und Schülern an allgemeinbildenden Schulen in Deutschland gelernt wurde (Statistisches Bundesamt 20181). Dies entspricht in der Reihenfolge der meist gelernten Fremdsprachen dem sechsten Rang hinter Englisch, Französisch, Latein, Spanisch und Russisch.
Die nachfolgenden Beiträge von Lehrkräften, Ausbilderinnen und universitären Fachdidaktikerinnen aus zwei österreichischen und sechs deutschen Bundesländern stellen thematisch höchst unterschiedliche, aber doch stets alltagsbezogene und lernerorientierte Konzepte für den schulischen Italienischunterricht vor, die für die Leserinnen und Leser – das ist unser Wunsch – eine Inspiration für den eigenen Unterricht darstellen mögen.
Der Band wird mit einem Beitrag zum individualisierten Lernen von Gabriele Kroes eröffnet. Die Autorin zeigt am Beispiel des in Prosa geschriebenen Monologs Novecento von Alessandro Barrico (1994), wie durch eine Individualisierung und Öffnung des Unterrichts für mehr Selbststeuerung einerseits und ein breit gefächertes Spektrum an Lernaufgaben andererseits ein für alle Schülerinnen und Schüler herausfordernder Italienischunterricht gestaltet werden kann.
Simona Bartoli Kucher geht in ihrem Beitrag der Frage nach, wie sich eine Perspektive für kulturelle (Sprachen-)Bildung in die Ausbildung von Fremdsprachenlehrkräften integrieren lässt. Diese Funktion, so die zentrale These, können im Italienischunterricht unter anderem italophone transkulturelle Texte übernehmen, die zu einem produktiv orientierten Sprach- und Kulturerwerbsprozess beitragen.
Der Artikel von Michaela Rückl und Rachele Moriggi beschreibt die Konzeption multimedialer Lehr-/Lernmaterialien für den Italienischunterricht in der Sekundarstufe II. Die Entwicklung dieser Materialien erfolgte im Zuge eines interdisziplinären Lehrprojekts, das die Vernetzung einer fachdidaktischen mit einer literaturwissenschaftlichen universitären Lehrveranstaltung sowie den Einbezug eines Fortbildungsseminars für Lehrkräfte vorsah. Ziel war es, literarische und kulturelle Themen im Kontext der commedia settecentesca für einen handlungsorientierten Fremdsprachenunterricht aufzubereiten, um für den Mehrwert literarischer Texte zu sensibilisieren, die in den aktuellen (österreichischen) Lehrplänen nur noch eine marginale Rolle spielen.
Ausgehend vom großen Erfolg des giallo in Italien nimmt sich Monica Zama in einem weiteren italienischsprachigen Beitrag des Potenzials dieses Genres für den schulischen Italienischunterricht an. Die Autorin skizziert eine unità didattica für Lernende auf dem Niveau A2 des GER, bei der die Schülerinnen und Schüler, ausgehend von einem Krimi-Kurzfilm, ihre eigene Kriminalgeschichte verfassen.
Im Mittelpunkt des Beitrags von Sylvia Thiele steht die Frage nach dem didaktisch-methodischen Potenzial der Geschichtensammlung Il bar sotto il mare von Stefano Benni (1987). Die Autorin zeigt am Beispiel ausgewählter Texte die Einsatzmöglichkeiten des Bandes in der Sekundarstufe II zur Entwicklung der Schreib- und Sprechkompetenz.
Der Schulung der Schreibkompetenz bzw. einzelner Teilkompetenzen, die das Schreiben betreffen, widmet sich auch Michaela Banzhaf. Ausgehend vom baden-württembergischen Bildungsplan Italienisch hält die Autorin ein überzeugendes Plädoyer für die Eignung von Gianni Rodaris Grammatica della fantasia zur Ausbildung der im Bildungsplan genannten Teilkompetenzen. Während Rodari hierzulande in erster Linie als Autor humorvoller (Kurz-)Geschichten bekannt ist, handelt es sich bei der Grammatica della fantasia um einen der vielen interessanten Texte, die im schulischen Kontext bislang keine besondere Würdigung erfahren.
Christina Maier zeigt in ihrem Beitrag das Potenzial des Films Alla luce del sole des italienischen Regisseurs Roberto Faenza (2004) zur Förderung der schülerseitigen Text- und Medienkompetenz auf. Die Geschichte des Priesters Giuseppe Puglisi, seines Kampfes gegen die organisierte Kriminalität und seines Engagements vor allem für Kinder und Jugendliche ist insbesondere für Schülerinnen und Schüler im deutschsprachigen Raum, die die Gewalt, die Mafia und Cosa nostra anzuwenden imstande sind, nicht aus eigener Erfahrung kennen, ein spannendes und bewegendes Thema.
Eine konkrete Unterrichtseinheit stellt Monika Rueß in ihrem Beitrag vor. Die Autorin zeigt, wie Schülerinnen und Schüler der Qualifikationsphase einen interkulturellen Vergleich am Beispiel von Kommunikationsstilen in Deutschland und Italien vornehmen und dabei nicht nur Unterschiede erarbeiten, sondern im Rahmen von Rollenspielen italienische Identitäten annehmen.
Manuela Franke widmet sich in ihrem Beitrag der mündlichen Sprachmittlung im Italienischunterricht und legt dabei einen Fokus auf den/die Mittler/in. Zwar besteht in der fachdidaktischen Diskussion weitestgehend Konsens bezüglich der Neutralität der/des Sprachmittelnden, Franke weist jedoch völlig zu Recht darauf hin, dass Sprachmittelnde in der Regel eine emotionale Verbindung zu einer der involvierten Parteien haben und daher nicht gänzlich objektiv handeln können. Die Autorin stellt in der Folge eine interessante Erweiterung eines gängigen Modells zur Diskussion und fordert eine stärkere Berücksichtigung der Rolle der Sprachmittelnden in Aufgabenstellungen.
Abgeschlossen wird der erste Teil des Doppelbandes durch den Beitrag von Stefan Witzmann, der anhand von Lernaufgaben aus dem Italienischunterricht des zweiten Lernjahres das Nutzungsspektrum zweier Web-2.0-Werkzeuge vorstellt und auslotet.
Abschließend möchte ich mehreren Personen, die am Zustandekommen dieses Teilbandes maßgeblich beteiligt sind, meinen Dank aussprechen. Zuerst sind dies die Autorinnen und der Autor der hier abgedruckten zehn Aufsätze, die in allen Phasen der Entstehung dieses Bandes ausgesprochen konstruktiv mit mir zusammengearbeitet haben. Frau Valerie Lange und dem ibidem-Verlag danke ich für die freundliche und kompetente Beratung bei allen Fragen im Zusammenhang mit der neu gegründeten Reihe Italienischdidaktik im Dialog. Weiterhin bin ich Claudia Schlaak für ihre unermüdliche Unterstützung in allen Fragen der korrekten Formatierung zu großem Dank verpflichtet. Alle Links, die in den hier zusammengetragenen Forschungsergebnissen genannt sind, wurden kurz vor der Publikation auf Erreichbarkeit geprüft. Last, but by no means least, danke ich meiner Freundin und Kollegin Sylvia Thiele, die diesen ersten Band der neuen Reihe mit mir gemeinsam herausgibt für Vieles: für ihre Geduld in allen Phasen der Arbeit an diesem Band, ihre fachdidaktische Expertise bei inhaltlichen Fragen und dafür, dass sie mir zu jeder Zeit eine geschätzte Gesprächspartnerin und einfühlsame Zuhörerin war.
FRANK SCHÖPP (WÜRZBURG), im November 2019
1 https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Schulen/_inhalt.html;jsessionid=69D774937BE27F6FE18436F81FE538DD.internet711#sprg233806.
Individualisiertes Lernen mit einer Ganzschrift im fortgeschrittenen Italienischunterricht am Beispiel von Alessandro Bariccos Novecento
Gabriele Kroes (Münster)
Heterogene Lerngruppen sind in deutschen Schulen der Normalfall; besonders sichtbar werden auseinander driftende Lernstände jedoch gerade in den Kursen spät einsetzender Fremdsprachen mit ihrer steilen Progression. Es sitzen dort im dritten Lernjahr engagierte Schülerinnen und Schüler, die sich auf die schriftliche oder mündliche Abiturprüfung im Fach Italienisch vorbereiten, neben solchen, die sich mit einem Leistungspunkt begnügen, um immerhin ihre Zulassungschancen zur Prüfung zu wahren. Quereinsteiger in die gymnasiale Oberstufe müssen die neue (und also für sie erst zweite) Fremdsprache häufig belegen – auch ohne ihr ein spezifisches Interesse entgegenzubringen; andere wollen nach Erfahrungen in Englisch, Französisch und/oder Latein oder Spanisch nun auch noch die dritte oder vierte Sprache lernen. Sie nutzen umfangreiche Lernerfahrungen und ein ausgebildetes Sprachbewusstsein und erreichen gerade auch im Lese- und Hörverstehen schnell solide Kompetenzen, während andere erkennbare Schwierigkeiten haben, dem Unterrichtsgeschehen in der Zielsprache zumindest in groben Zügen zu folgen. Will man in einer solch heterogenen Ausgangslage dennoch möglichst viele Schülerinnen und Schüler erreichen und allen die Chancen auf Kompetenzzuwachs bieten, so müssen Lernprozesse individualisiert und auch für ungewohnte und deutlich niveaudifferente Aufgabenstellungen geöffnet werden.
Im Folgenden soll skizziert werden, wie sich ein längeres Unterrichtsvorhaben (etwa ein Quartal) auf Basis einer Ganzschrift so organisieren lässt, dass Lernzuwachs auf unterschiedliche Weise und auf unterschiedlichen Niveaustufen möglich wird, um Frustration durch Unter- oder Überforderung zu vermeiden1.
Die Schülerinnen und Schüler eines Grundkurses im dritten Lernjahr2 hatten Buch (und Film) aus mehreren Vorschlägen durch Mehrheitsvotum selbst gewählt. Ihnen gefiel die Geschichte um den merkwürdigen Schiffspianisten, der im Jahr 1900 als Neugeborenes auf einem Ozeanriesen mit Kurs New York gefunden wird, auf diesem Schiff aufwächst und es nie mehr verlässt. Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento: Sein Name ist so außergewöhnlich wie sein Talent als Pianist, das ihn und seine Musik bald zur Legende werden lässt. So skurril wie sein Leben auf dem Ozean ist seine Sicht auf die Welt.
Die Auswahl des Textes ist in mehreren Bundesländern durch Lehrpläne bzw. Vorgaben für die Zentralen Abiturprüfungen legitimiert.3 Zielspannung beim Lesen und Unbestimmtheit der Gattung zwischen monologo und Erzählung mögen für die Schülerinnen und Schüler motivierend wirken. Für den Unterricht geeignet erscheint Novecento zudem durch den geringen Umfang und die Tatsache, dass es eine für deutsche Schülerinnen und Schüler annotierte Version mit Vokabelhilfen gibt und der Text zudem in deutscher Übersetzung vorliegt. Ferner lassen sich die Verfilmung durch Giuseppe Tornatore und eventuell auch eine aktuelle Bühnenfassung nutzen.
In einer Einstiegsphase prima della lettura, die Vorkenntnisse aktivieren, (hoffentlich) Neugier auf den Text und Leselust wecken soll, wird vor allem mit Bildmaterial und der Anfangsszene des Films gearbeitet, um den kontextspezifischen Wortschatz grundzulegen. Leitfragen dieser Phase mit viel Plenumsunterricht sind „Andare in America all’inizio del Novecento – chi? perché? come?“ und „Viaggiare sull’oceano“, die zugleich die Textrezeption vorbereiten. Die Lektüre erledigen die Schülerinnen und Schüler sodann selbstständig über die Ferien. Aufgabe für alle ist es, den Plot zu kennen und Inhalte für sich systematisch zu notieren. Dabei bleibt es den Lernenden überlassen, ob sie den Originaltext lesen, die deutsche Übersetzung oder den Film schauen.4 Auf dieser Grundlage können sich hernach alle an der Planung des weiteren Vorgehens beteiligen und Fragen an den Text formulieren, die sie für interessant in der Sache und inhaltlich ertragreich halten. In etwa diese Fragen kamen zusammen:
Com’è il mondo della nave?
I passeggeri: chi sono e da dove vengono?
Novecento: che tipo è? (il suo carattere, il suo talento)
Com’è la relazione tra Novecento e il suo amico trombettista?
Il duello tra Novecento e Jelly Roll Morton
Che cosa significa la musica per Novecento?
La donna e il disco: perché Tornatore ha inventato questi due episodi?
Perché un giorno Novecento voleva lasciare la nave – e perché non ci è riuscito?
La fine del monologo: una catastrofe?
Für die Organisation der nachfolgenden Sequenzen ist zentral, dass jede Schülerin und jeder Schüler an einer selbst gewählten Frage und nach eigenem Interesse arbeitet, dass jede/r etwas findet, das ihr/ihm und zu den eigenen Lernvoraussetzungen ‚passt‘. Vorzugsweise finden sich Arbeitsteams von in der Regel zwei Personen zusammen; dabei bleibt es den Schülerinnen und Schülern überlassen, ihre Lernpartner zu wählen. Somit kommen sowohl leistungsheterogene als auch -homogene Gruppierungen zustande, die sich im Rahmen ihres Themas jeweils für ein geeignetes Lernprodukt entscheiden, das am Ende auch einer größeren Schulöffentlichkeit, z.B. in einer kleinen Ausstellung am ‚Tag der Sprachen‘, präsentiert werden soll.5 Möglich sind u.a. die Gestaltung eines (Lern-/Info-) Plakats, eines Vortrages mit Visualisierungen, ein längerer Text zum Lesen (Text-/Filmanalyse; kreatives Schreiben). Die Lernprodukte können also unterschiedlichen Aufgabentypen und Anforderungsbereichen zugeordnet werden:
Verstandenes reorganisieren und darstellen (riassumere, elencare, presentare)
Inhalte und ihre Darstellung analysieren (analizzare, confrontare, spiegare, caratterizzare)
Textinhalte kommentieren und einordnen (spiegare, commentare, giudicare)
Hintergründe recherchieren und adressaten- und kontextgerecht aufbereiten (ricercare, spiegare, presentare)
ausgehend von Inhalten Neues gestalten (inventare, produrre, mettere in scena).6
Die gewählten Themen und inhaltlichen Fragestellungen fasst die Lehrkraft zu (hier) fünf Sachgruppen A bis E zusammen.
Abb. 1: Gesamtübersicht über die inhaltlichen Fragestellungen
Die genaue Aufgabenstellung entwickeln die Schülerinnen und Schüler aus den eingangs zusammengetragenen Fragen möglichst selbst; gerade bei leistungsschwächeren Lernenden unterstützt die Lehrkraft im Hinblick auf die die passende Wahl des Lernprodukts, die Dimensionierung eigener Recherchen, sie weist auf zu erwartende Schwierigkeiten hin und stellt nötigenfalls Hilfen (etwa Modelltexte und textsortenspezifisches Vokabular) bereit. Beispiele für gewählte Aufgaben7 und das Anforderungsniveau sind hier kurz skizziert:
livello di base (o meno) – AFB I/II
Eine Zeichnung (Aufriss) eines Ozeanriesen mit Beschriftung (Vokabeln und verortete Episoden als riassunti aus dem Ausgangstext) – A
Bebilderter Lebenslauf von Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento – B
livello medio – AFB II/III
Fiktives Interview einer New Yorker Gazette mit dem berühmten Pianisten, der das Schiff nicht verlässt (gestaltete Zeitungsseite mit Fotos) – B oder D
Analyse der Beziehung zwischen dem narratore und Novecento (Text) – B
Reisetagebuch eines Passagiers der Dritten Klasse – A
Meine 3 Lieblingsszenen. Kommentare zu Standbildern aus dem Film – E
livello avanzato – AFB III
Dialog auf der Gangway – ein inszeniertes Gespräch zwischen Novecento und dem narratore, in dem dieser versucht ihn zu überreden, doch an Land zu gehen (Baricco 1994, 49) – B oder D
Vortrag mit Bildern und Musikbeispielen über Entwicklungen (Ragtime, Dixie) im Jazz der 30er Jahre – C
Come raccontare la vita eccezionale di Novecento? Vergleich von Erzähltechnik im Film und der literarischen Vorlage (Analyseaufsatz) – E
Diese Aufstellung verdeutlicht unmittelbar, wie unterschiedlich die gewählten Aufgaben in Bezug auf die inhaltliche Komplexität bzw. den Umfang und die erforderlichen zielsprachlichen Kompetenzen sind. Doch zweifellos ermöglichen auch die Aufgaben auf dem livello di base Kompetenzentwicklung sowohl im Bereich des Leseverstehens als auch hinsichtlich der Schreibfähigkeit. Hier werden die Schülerinnen und Schüler Könnenserfahrungen machen, die ihnen angesichts komplexerer Aufgabenstellungen schon aus Gründen der mangelnden Sprachkompetenz verschlossen blieben.
Parallel zur inhaltlichen Arbeit fokussieren die Schülerinnen und Schüler eine funktionale kommunikative Teilkompetenz, die sie im Laufe dieses Unterrichtsvorhabens vorrangig erweitern wollen. Je nach Aufgabe sind das Schreiben, dialogisches/monologisches Sprechen, Text- und Medienkompetenz, methodische Kompetenzen, Sprachlernbewusstsein, eventuell auch Hör- bzw. Hör-Seh- und Leseverstehen. Diesen Schwerpunkt setzen die Schülerinnen und Schüler generell selbst, gegebenenfalls berät die Lehrkraft gemäß früherer Lernstandserhebungen. Entscheidend ist, dass die Lernenden sich anhand der Deskriptoren in vorgegebenen Kompetenzrastern8 selbst einschätzen, und zwar einmal zu Beginn und ein zweites Mal am Ende des Unterrichtsvorhabens.
Das gesamte Unterrichtsvorhaben lässt sich schematisch etwa so darstellen:
Sequenz 0: Einstieg: prima della lettura – Planung
59
Sequenz 1: Textrezeption (individuell)
Sequenz 2: Organisation, individuelle Zielsetzung, Arbeitsplanung
2
Sequenz 3A
Sequenz 3B
Sequenz 3C
Sequenz 3D
Sequenz 3E
4
wechselseitige Information zum Arbeitsstand, Feedback geben und einholen
2
Sequenz 3A
Sequenz 3B
Sequenz 3C
Sequenz 3D
Sequenz 3E
4
Korrekturen und Fertigstellung der Produkte
(Plakate, Stellwände, PPPs…) Einüben der Vorträge
2
Sequenz 4: Präsentation, Reflexion, Auswertung
der Ergebnisse und des Vorhabens
4
Abb. 2: Schematische Darstellung des Sequenzverlaufs
Grau unterlegt sind die arbeitsteiligen Phasen, in denen die Schülerinnen und Schüler an ihren Fragestellungen arbeiten und die das inhaltliche Zentrum des Vorhabens darstellen.
Wenngleich zentrale didaktische Entscheidungen den Lernprozess für Selbststeuerung öffnen und den Lernenden ein hohes Maß an Wahlfreiheit eingeräumt wird, ist es doch auch von entscheidender Bedeutung, dass diese Freiheit nicht in Beliebigkeit mündet. Deshalb führen die Schülerinnen und Schüler fortlaufend ein Arbeitstagebuch10, das auch als Grundlage der Beratungsgespräche durch die Lehrkraft dient. Falls erforderlich, wird überdies ein Bogen zur (Selbst-)Kontrolle11 ausgeteilt, in dem jede/r Einzelne für jede Stunde Beobachtungen zum eigenen Arbeitsverhalten notiert. Auf dieser Basis kann die Lehrkraft beraten, Anregungen zur Weiterarbeit geben, nötigenfalls auch Leistungen einfordern und Hilfen und Unterstützung anbieten, wo dies notwendig erscheint. Ebenso wichtig ist jedoch das Feedback, das sich die Lernenden untereinander geben und das in einer klar definierten zweistündigen Phase etwa zur Hälfte der inhaltlichen Arbeit stattfindet.
Realistisch ist davon auszugehen, dass die Arbeitssprache der Schülerinnen und Schüler untereinander Deutsch und die Förderung der Mündlichkeit in diesem Unterrichtsvorhaben folglich relativ gering ist. Daher soll die Phase der wechselseitigen Berichte und Rückmeldungen unbedingt in italienischer Sprache stattfinden. Zur Unterstützung erhalten die Schülerinnen und Schüler sprachliche Hilfen und Strukturmuster.12
Während der zentralen Arbeitsphase (Sequenz 3) beobachtet die Lehrkraft die Arbeit der Schülerinnen und Schüler und gibt Feedback, das sich auf die jeweilige Aufgabe, den Prozess, die Selbstorganisation der Einzelnen und der Kleingruppen beziehen kann. Wichtig ist hier insbesondere der Bezug zu den von den Lernenden selbst gesetzten, individuellen Zielen; diese Rückmeldungen erfolgen möglichst in der Zielsprache, wobei Nachfragen der Schülerinnen und Schüler nötigenfalls auch auf Deutsch erfolgen dürfen, da hier die Ausbildung der Sprachlernkompetenzen Vorrang vor der Förderung der funktionalen kommunikativen Kompetenzen hat (De Florio-Hansen 2014, 153). Überdies macht die Lehrkraft Korrekturangebote für fertige Texte, wobei die Autorenteams Schwerpunkte in Form von Korrekturaufträgen möglichst selbst setzen sollen. Generell ist das Kriterium bei diesen Korrekturen nicht die unbedingte Beachtung der sprachlichen Norm, sondern die Verständlichkeit der Äußerungen. Bewährt haben sich auch Korrekturzeichen in verschiedenen Farben, etwa Rot für imperfezioni, die die Schülerinnen und Schüler selbst verbessern können, und Schwarz für Positivkorrekturen, insbesondere Vorschläge zur lexikalischen Optimierung. Auch kürzere Phasen nachhelfender Instruktion (Weinert 1997, 52) für Teilgruppen von Schülerinnen und Schülern können sich in stockenden Arbeitsprozessen als sinnvolle Unterstützung erweisen.
Die Präsentation aller Produkte erfolgt im Museumsgang und in zwei Runden. Die Arbeitsteams besetzen je eine Station; etwa zwei bis drei Präsentationen finden simultan statt. Die Zuhörenden erhalten je zwei Rückmeldekarten in drei Kategorien: „Quello che mi piace molto…“, „Una domanda sul vostro tema: …“ und „La mia proposta per farlo ancora meglio: …“. Diese Karten füllen die Zuhörerinnen und -hörer aus und geben sie an zwei Stationen ihrer Wahl ab. Auf diese Weise ist relativ sicher, dass jedes Arbeitsteam Peer-Feedback erhält13 und alle sich zumindest mit zwei fremden Produkten vertieft auseinandersetzen. Diese Phase der Rezeption wird zusätzlich durch eine schriftliche (Haus-)Aufgabe gesichert: „Scegliete una presentazione che volete descrivere e commentare. Scrivete un testo – minimo 300 parole.“ Selbstverständlich nimmt auch die Lehrkraft reihum an Präsentationen teil und kann ihrerseits Kommentare und Verbesserungsvorschläge schriftlich hinterlassen.
Im Anschluss an die zweite Präsentationsrunde müssen im Plenum ggf. noch Absprachen über die Schlussredaktion (Aufgreifen der Rückmeldekarten) und die Gestaltung der Präsentationen in der Schulöffentlichkeit getroffen werden. Zusätzlich findet noch ein Reflexionsgespräch im Kugellager statt, während dessen sich je zwei Schülerinnen bzw. Schüler kurz austauschen über Impulse wie z.B.
Ti piace il libro? Perché? Perché no?
E il film?
Cosa dici della fine del libro?
Su quale aspetti vorresti sapere di più? Perché?
Qual è secondo te la presentazione più informativa/bella/divertente? Perché?
Quale presentazione non hai capito bene? Spiega le tue difficoltà!
In generale: ti è piaciuto il lavoro in questo progetto?
Hai un’idea per una possibile ripetizione nel prossimo corso Q2? Che cosa si potrebbe fare meglio?
Nach jeweils ca. drei Minuten rücken die im Außenkreis Stehenden einen Platz weiter und sprechen mit einem anderen Gegenüber über die nächste Frage, die jeweils von der Lehrkraft vorgegeben wird. Dieses formal inszenierte Gespräch dient zum einen der Förderung der Mündlichkeit im Omniumkontakt, zum anderen liefert es Ansatzpunkte für den Austausch über die Arbeitsweise in diesem Unterrichtsvorhaben.14
Die Kriterien der Leistungsfeststellung und Bewertung sind den Lernenden von Beginn an transparent. Bewertet werden Engagement im Arbeitsprozess einschließlich der Feedbackphasen (als Grundlage dienen neben den Notizen der Lehrkraft die individuellen Arbeitstagebücher und Lernprotokolle einschließlich der in Eigenregie geführten Wortschatzlisten der Schülerinnen und Schüler) sowie die Qualität des Lernprodukts (insbesondere inhaltliche Komplexität, sachliche Richtigkeit, Darstellungsleistung einschließlich Sprachrichtigkeit). Herausforderungen in der Bewertung liegen allerdings in der Schwierigkeit, zwischen Einzel- und Gruppenleistung zu unterscheiden und inhaltlich, sprachlich, methodisch differente Anspruchsniveaus gerecht zu beurteilen. Dass individueller und sozialer Bezugsnorm hier ein größeres Gewicht vor kriterialer Orientierung eingeräumt wird, mag gerade in der gymnasialen Oberstufe unüblich erscheinen. Die individuelle Passung von Lernaufgabe und Leistungsvermögen hat in diesem Unterrichtsvorhaben jedoch Vorrang vor der Orientierung am bzw. an der imaginären Durchschnittslernenden. Gleichwohl erwachsen aus der weitreichenden Individualisierung Probleme in der Leistungsbewertung – und dies nicht nur im Blick auf die Konzeption der einen, gleichen Klausur für alle. Diese Schwierigkeiten werden größer, je häufiger differenzierende Lernarrangements im Unterricht eingesetzt werden, ohne dass es im Rahmen der schulischen Bewertungspraxis grundsätzliche Lösungen gäbe, erst recht nicht im stark verrechtlichten Bereich der Qualifikationsstufe. Durch die erfolgreiche Bewältigung selbst gesetzter Anforderungen wächst jedoch bei leistungsschwachen wie -starken Schülerinnen und Schülern das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, und ihre Lern- und Leistungsmotivation nimmt in der Regel zu. Beides sind wichtige Voraussetzungen für den Kompetenzerwerb in einem Kurs, in dem der Lernerfolg so offensichtlich von kontinuierlichem Arbeitsaufwand und selbstständiger Sprachverwendung abhängt, wie das in einer spät einsetzenden Fremdsprache mit steiler Progression der Fall ist.
Bibliographie
BARICCO, Alessandro. 1994. Novecento. Un monologo. Milano: Feltrinelli (UEF 1302).
BARICCO, Alessandro. 1999. Die Legende vom Ozeanpianisten. München: Piper (dt. Übers. von E. Christiani).
BARICCO, Alessandro. 2012a. Novecento. Un monologo. Stuttgart: Klett (mit Zeilenzählung und wenigen Vokabelangaben in der Fußzeile).
BARICCO, Alessandro. 2012b. Novecento. Un monologo. Stuttgart: Reclam (ebenfalls mit Zeilennummern und deutlich mehr annotazioni; zudem Nachwort, Literaturverzeichnis, Informationen zur Verfilmung).
DE FLORIO-HANSEN, Inez 2014. Fremdsprachenunterricht lernwirksam gestalten. Tübingen: Narr.
MINISTERIUM FÜR SCHULE UND WEITERBILDUNG. 2013. Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Gymnasium/Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen. Italienisch.
VON DER GROEBEN, Annemarie & KAISER, Ingrid. 2012. Werkstatt Individualisierung. Mühlheim/Ruhr: Bergmann & Helbig.
WEINERT, Franz E. 1997. „Notwendige Methodenvielfalt. Unterschiedliche Lernfähigkeiten erfordern variable Unterrichtsmethoden“, in: Friedrich Jahresheft. Lernmethoden – Lehrmethoden – Wege zur Selbstständigkeit, 50-52.
Film
La leggenda del pianista sull’oceano. 1999. Verfilmung von Giuseppe Tornatore.
Materialien
Scheda di protocollo
tema: ________________________ autori: ______________________
prodotto: ____________________________________________
data
compito/obiettivo
materiale
commenti/il prossimo passo
Mat. 1: Maske für das Arbeitsprotokoll, das jedes Team ausfüllt
Datum
anwesend?
Arbeitsunterlagen vollständig?
Vorbereitung vollständig?
Intensität der Mitarbeit?
Konzentration und Effizienz?
Bin ich mit meiner eigenen Leistung heute zufrieden?
Meine Aufgaben heute: Bemerkungen
Mat. 2: Falls notwendig: Bogen zur (Selbst-)Kontrolle des Arbeitsverhaltens
Selbsteinschätzung Hörverstehenund Hörsehverstehen
+
~
-
Bemerkungen
Vorsätze
+
~
-
1.
2.
Ich kann dem Unterrichtsgespräch auf Italienisch folgen und verstehe
alle Anweisungen und Aufgabenstellungen
die meisten Gesprächsbeiträge
Ich frage nach, wenn ich nicht alles verstanden habe.
Ich kann Filmszenen verstehen
fast komplett
nur sinngemäß
kaum.
Ich kann Inhalte der Präsentationen von Mitschüler*innen verstehen, auch wenn ich nicht an demselben Thema gearbeitet habe:
ohne Schwierigkeiten
nur wenn es geschriebene oder bildliche Hilfen gibt.
Ich frage nach, wenn ich nicht alles verstanden habe.
Verbessern möchte ich mich in…
Wie? …
Gelungen??
Mat. 3: Bogen zur Vorher-/Nachher-Einschätzung in einer ausgewählten funktionalen kommunikativen Kompetenz
Team A berichtet:
Team B hört zu, fragt nach:
Abbiamo scelto questo tema perché…
Finora abbiamo fatto…
Ci piace…
Il problema ora è…
Una domanda che vi facciamo…
- Nachfragen:
Non ho capito perché…/potete spiegare…?
- Bezug nehmen:
a proposito di…/per quanto rigurada…
- Werten und Kommentieren:
tener conto di qc
a prima vista
a mio parere
sotto questo aspetto
si può dire in generale che…
ho l’impressione che…
- Vorschläge machen:
bisogna fare…
vorrei far notare che…
vorrei richiamare la vostra attenzione su…
Mat. 4: Beispiel für sprachliche Hilfen zum Geben und Entgegennehmen von Feedback
1 Der „Teufelskreis des Misslingens“ muss durchbrochen werden (vgl. von der Gröben 2012, 34).
2 Neu einsetzend mit Beginn der Oberstufe, d.h. in NRW mit vier Wochenstunden.
3 In Baden-Württemberg z.B. Partire o restare? (mit Novecento als Pflichttext in 2018); in NRW z.B. (ehemals) Migrazione; in Rheinland-Pfalz z.B. Immigrazione e emigrazione (mit Novecento als Leseempfehlung).
4 Das mag nach schneller Kapitulation klingen, doch passt sich die Aufgabenstellung nur der Realität schulischer Praxis an. Leseunlust oder mangelnde Lesekompetenz in der Fremdsprache sollen nicht gleich zu Anfang des Unterrichtsvorhabens eine Teilmenge von Schülerinnen und Schülern ausschließen. Es erweist sich im weiteren Verlauf ohnehin als unumgänglich, sich auch mit dem italienischen Originaltext auseinanderzusetzen; die Bereitschaft dazu wächst, wenn nicht bereits am Beginn ein Misserfolgserlebnis steht.
5 Alternativ ist auch eine Präsentation im Rahmen eines Themenabends für einen anderen Italienischkurs denkbar.
6 Operatoren hier orientiert am Kernlehrplan für die Sek. II (NRW 2013).
7 Hier auf Deutsch; am Schluss italienische Titel bzw. Überschriften zu wählen, ist Teil der Aufgabe der Autoren- und Autorinnenteams.
8 Vgl. Material 3 im Anhang.
9 In dieser Spalte ist der ungefähre Zeitbedarf in Unterrichtsstunden zu 45 min. angegeben.
10 Vgl. Material 1 im Anhang.
11 Vgl. Material 2 im Anhang.
12 Vgl. Material 3 im Anhang.
13 Falls die Teams mit den schwierigsten oder umfangreichsten Produkten leer ausgehen, muss die Lehrkraft für Ausgleich sorgen.
14Die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer beurteilten das Projekt Novecento überwiegend positiv; es habe die Zusammenarbeit gefördert, sei jedoch „anstrengender“ als „normaler“ Unterricht gewesen; es gefiel insbesondere den leistungsstarken Schülerinnen und Schülern, habe jedoch auch auf niedrigerem Niveau Lernfortschritte ermöglicht. Dass die Erstlektüre notfalls auch auf Deutsch habe erfolgen dürfen, sei hilfreich gewesen, um sich dem Text überhaupt nähern zu können, auch wenn man schließlich doch mit dem italienischen Text habe arbeiten müssen.
LehrerInnenbildung NEU: storie transculturali nella didattica della letteratura di lingua straniera
Simona Bartoli Kucher (Graz)
1. “Was lernt man, wenn man Sprachen lernt?” (Krumm 2009, 104)
Da quando la realtà della scuola è caratterizzata da classi eterogenee, è fuori dubbio la necessità di riflettere sul collegamento tra lingue e culture diverse, sulla possibilità di un rapporto dialogico che, proprio nell’insegnamento delle lingue straniere, potrebbe assumere la funzione di sensibilizzare gli apprendenti nei confronti della pluralità e dell’ibridità di culture, di lingue – e quindi di identità – determinate dai processi migratori.
Per questo partiamo dal presupposto che, confrontarsi con autori, personaggi e testi nati e cresciuti nell’in-between, nello
Zwischenraum der Kulturen, die sich zwischen verschiedenen kulturell geprägten Identifikationsangeboten (Werten, Traditionen, Lebensstilen, Rollen und Lebensentwürfen) entscheiden können und bisweilen auch müssen (Freitag-Hild 2010, 55)
possa motivare gli studenti – all’università durante la formazione, e a scuola come insegnanti di lingue straniere – a riflettere e far riflettere sul métissage culturale della società e sui processi identitari, anche conflittuali, tipici dei processi transculturali (Schumann 2008, 82).
Dando al contempo risposta alla domanda – posta da Hans-Jürgen Krumm (2009) – a proposito dei contenuti nell’insegnamento delle lingue straniere.
1.1 Insegnamento integrativo della lingua e della letteratura
Da quando la pubblicazione del QCE/GeR e la diffusione dei Bildungsstandards hanno dato nuovi impulsi alla ricerca nell’ambito della didattica delle lingue moderne, si lamenta spesso il vuoto di contenuti su cui poggia l’insegnamento tradizionale delle lingue moderne (Lüger & Rössler 2008; Reimann 2014, 12).
L’obiettivo delle critiche sono in particolare i testi didattizzati, costruiti ad hoc per i manuali: testi strutturati per venire decodificati e compresi quasi al cento per cento, perché lessico e strutture della lingua di ogni unità didattica costituiscono, nella progressione del sillabo, i presupposti per l’unità successiva (Hermes 1998, 233).
Insegnare le lingue straniere sulla base anche di testi letterari e/o film inseriti in scenari didattici orientati all’azione e alla produzione, costituisce invece un’alternativa efficace per rendere possibile lo sviluppo integrativo di tutte le competenze linguistico-comunicative, in stretta connessione con competenze testuali, competenze narrative e culturali (Nünning & Surkamp 2006, 29).
Al dilemma sui contenuti la didattica della letteratura di lingua straniera può offrire risposta, a patto che, in una prospettiva di Content and Language Integrated Learning, metta a disposizione degli insegnanti in formazione, e degli insegnanti in servizio, modelli e metodi concreti per integrare i contenuti con l’insegnamento comunicativo delle lingue moderne (Krumm 2009, 107).
È proprio questo che il seguente contributo intende mettere a fuoco, proponendo scenari didattici per la formazione degli insegnanti di lingua, in cui la competenza linguistico comunicativa sia strettamente collegata alla competenza di lettura, alla competenza estetico letteraria e alla competenza interculturale/transculturale1, attraverso una rete intertestuale al cui centro sta il testo letterario (Surkamp & Nünning 2009).
2. Scelta dei testi
Se nell’insegnamento delle lingue straniere si vuole dare ai testi letterari un posto di primo piano, è fondamentale scegliere quelli più idonei per motivare gli apprendenti – sia all’università che a scuola – alla lettura in lingua straniera (Surkamp 2012, 80). Tenendo presente la crescente estraneità dei giovani alla lettura, si dovrà pensare allo stesso tempo al canone nel suo significato etimologico di
strumento di selezione e valutazione di testi, autori, saperi che sono dentro o fuori della cultura tradizionale, «classica» di una società in un certo momento storico (Benvenuti & Ceserani 2012, 168).
Su questo sfondo, si ritiene importante proporre testi della letteratura contemporanea, della letteratura transculturale (Kleinhans & Schwaderer 2013) e postcoloniale, se presentano aspetti e caratteristiche di interesse per il lettore apprendente della lingua straniera, se lo invitano a confrontarsi con la lingua e/o a riflettere in lingua straniera su un tema del discorso culturale attuale (Hallet 2007, 33).
Tra queste caratteristiche testuali, rientrano senza dubbio alcuni aspetti pragmatici come la lunghezza e la complessità linguistica, e soprattutto il legame del testo con la realtà degli apprendenti, oltre che la possibilità di collegarlo con altri testi che trattano lo stesso argomento. Infatti:
Erst durch die intertextuelle Arbeit beim Vergleich verschiedener Texte können Lernende erarbeiten, welche Wahrnehmungsmuster oder Kollektivvorstellungen in einer bestimmten Gesellschaft oder Kultur existieren und auf welch unterschiedliche Weise sie in literarischen Werken verarbeitet werden (Nünning & Surkamp 2006, 43).
Perché la classe di lingua straniera funga da ‘terzo spazio’ in cui le attività comunicative diventano “cross cultural activities” (Kramsch 1993, 231), è fondamentale scegliere testi autentici: letterari, filmici e giornalistici.
Testi che possono creare collegamenti con il vissuto degli apprendenti e con la cultura di chi li ha prodotti, sottraendosi così alle regole nazionalculturali di gerarchizzazione a cui viene di solito sottoposta la scelta del canone.2
Ecco perché la mia proposta è di dare ampio spazio a testi caratterizzati, sul piano testuale, da una lingua relativamente semplice, sul piano narratologico da storie vicine a quelle della realtà, narrate in testi brevi oppure in romanzi di cui, a seconda del livello linguistico e delle esigenze del gruppo classe, possono essere letti singoli capitoli o singole sequenze. Una condizione rappresentata da molti testi della letteratura transculturale italofona, la cui lingua è
un italiano più semplice, ma d’altra parte anche più pulito […], cioè meno colonizzato dall’enfasi della tradizione […] o dal vizio molto radicato, non solo in letteratura, di una sintassi pomposa (Brogi 2011a, 6).
Che questi testi letterari siano più semplici dal punto di vista della lingua, non riduce in nessun modo il loro valore estetico: lo dimostrano anche molti esempi della letteratura transculturale francofona di sfondo maghrebino3, oltre che la letteratura di lingua tedesca con background migratorio, che ormai da anni ha assunto un peso notevole nel panorama letterario germanofono.4
3. Competenza visiva e didattica delle immagini: proposte applicative
Sia il giallo interculturale Divorzio all’islamica a viale Marconi di Amara Lakhous (2010), che il romanzo per ragazzi Oggi forse non ammazzo nessuno. Storie minime di una giovane musulmana stranamente non terrorista di Randa Ghazy (2007) hanno un titolo e una copertina accattivanti: in chiave didattica un ottimo impulso per accedere, attraverso le immagini, ai ‘mondi’ che i testi rappresentano (Hallet 2010b, 51).
Non serve insistere sul fatto che il rapporto tra immagine e testo mette in azione nel lettore processi affettivo-emotivi che generano sia possibilità di identificazione che di rifiuto, suscitando al contempo sentimenti legati a esperienze e a ricordi individuali (Hecke 2010, 68).
In prospettiva di analisi culturale, è altrettanto chiaro che le immagini fanno sempre parte di un contesto discorsivo il cui significato è costituito anche da altri segnali, per lo più verbali. Per questo motivo, lavorare con copertine come quelle dei testi letterari da cui siamo partiti, potrebbe servire a sviluppare anche la capacità discorsiva multimodale in lingua straniera (Hallet 2010b, 52).
Fig. 1: Copertina di Divorzio all’islamica a viale Marconi, Amara Lakhous
In una classe di principianti, basterebbe cominciare dalla lettura del paratesto del romanzo di Lakhous (copertina animata, titolo) e dalla co-lettura di altri, semplici testi informativi (p.e. una cartina del quartiere, cfr. bibliografia), per calare il giallo nel suo contesto storico e culturale (tecnica del wide reading). Contestualizzare il luogo evidenziato dal titolo del romanzo è già un inizio significativo. Viale Marconi è l’indirizzo di un microcosmo popolare della capitale in cui, insieme a italiani provenienti da diverse parti d’Italia, interagiscono molti cittadini provenienti da altre culture:
Ci sono fisionomie di tutti i tipi: giovani neri e asiatici che vendono merce contraffatta sui marciapiedi, bambini arabi che passeggiano con il papà e la mamma col velo, fimmini rom con gonne lunghe che chiedono l’elemosina. Insomma, sono nell’Italia del futuro, come dicono i sociologi (Lakhous 2010, 12).5
Sono riflessioni del protagonista maschile Christian, tra italiano standard e siciliano (sottolineato nella citazione), mentre passeggia avanti e indietro nel quartiere cercando di calarsi nella parte dell’immigrato tunisino Issa.
Se gli scolari o gli studenti vogliono saperne di più, la lettura dei primi due capitoli evidenzia che la storia di Christian/Issa si incrocia – anche dal punto di vista della tecnica narrativa – con quella di Safia, una donna con background egiziano, diventata Sofia da quando si è trasferita a Roma in seguito al matrimonio combinato con un architetto egiziano, emigrato in Italia per fare il pizzaiolo.
Dopo la lettura della copertina animata, i brevi capitoli in prima persona – intitolati una volta “Issa”, quella successiva “Sofia” – permettono di concretizzare in lingua straniera il significato della focalizzazione multipla, attraverso cui “lo stesso avvenimento può essere evocato diverse volte a seconda del punto di vista dei numerosi personaggi corrispondenti” (Genette 1976, 237).
Fig. 2: Copertina di Oggi forse non ammazzo nessuno, Randa Ghazy
La copertina animata del romanzo per adolescenti di Randa Ghazy6 mette al centro lo sguardo sicuro di una giovane donna, convintamente avvolta in un hijab nero, che porta altrettanto convintamente occhiali da sole dalle lenti nere e dalla montatura rossa. Sotto il volto, iscritto nella sagoma di una teiera, il titolo del romanzo, che contiene un potenziale implicito di forte provocazione: Oggi forse non ammazzo nessuno. Una frase completa, che suggerisce che l’attività consueta della giovane donna velatasia quella di uccidere, evocando con ciò il pregiudizio latente del potenziale di violenza dei cittadini musulmani. Al titolo segue un sottotitolo con funzione contrastiva, stampato in caratteri più piccoli, ma evidenziato dal colore rosso: Storie minime di una giovane musulmana stranamente non terrorista.
Il collegamento tra i segnali visivi delle immagini della copertina, e gli ambivalenti segnali testuali offre tutta una serie di stimoli linguistici multimodali e culturali: una tempesta di cervelli può servire a raccogliere le impressioni e le percezioni a favore della protagonista o contro di lei.
In ogni caso una copertina del genere stimola a fare previsioni sulla base delle proprie conoscenze pregresse, forse sulla base di pregiudizi latenti. Senza dubbio, per quanto riguarda le competenze, entrano in gioco ambiti diversi: quello della riflessione e della sensibilizzazione (attraverso l’analisi dei segnali divergenti), il che può diventare anche occasione di produzione scritta e di produzione orale, consentendo di integrare il livello emotivo, motivazionale, con quello linguistico funzionale.
Come sottolinea Hallet, la viewing culture è una competenza ancora mancante, ma necessaria sia nella formazione degli insegnanti, che nella didattica delle lingue straniere, al fine di sviluppare la capacità discorsiva multimodale,
damit das Sehen als wichtige kulturelle Praxis eine reflexive Dimension gewinnen und Teil einer umfassenderen diskursiven Partizipationsfähigkeit werden kann, die das Ziel aller schulischen Bildung ist (Hallet 2010b, 52).
La tabella che segue è una proposta di attività didattiche per apprendenti principianti, volte a potenziare – a partire dal paratesto o dall’incipit di testi letterari – la competenza linguistico comunicativa, parallelamente alla competenza interculturale/transculturale e a quella estetico letteraria:
Primo/secondo anno di studio
COMPETENZE LINGUISTICO DISCORSIVE
Attività di pre lettura
Gli apprendenti, prima di leggere il testo:
fanno previsioni sul contenuto sulla base di immagini, del cover, di videoclip, di articoli di giornale
si confrontano con elementi lessicali e sintattici
collegano elementi/temi del testo con il loro mondo
attivano le loro preconoscenze sul tema
attivano e attualizzano, su input dell’insegnante, le loro conoscenze culturali (sul tema specifico, sul periodo storico, sull‘autore)
Attività durante la lettura
PRODUZIONE SCRITTA
Gli apprendenti, dopo aver capito il testo:
formulano semplici dialoghi tra i personaggi
redigono un diario di lettura (prime impressioni sul testo)
descrivono persone, luoghi immagini
fanno un glossario dei nuovi termini
PRODUZIONE ORALE
Gli apprendenti, dopo aver capito il testo:
discutono sulle prime impressioni
mettono in scena un breve dialogo tra i personaggi
verificano la comprensione del testo sulla base di domande guida o altre attività di comprensione proposte dall’insegnante o suggerite da altri alunni (Bredella 2004, 140-142)
Attività dopo la lettura
Gli apprendenti, dopo aver letto il testo:
scrivono una breve continuazione
immaginano una storia
Gli apprendenti, dopo aver letto il testo:
mettono in scena la storia
simulano semplici dialoghi
COMPETENZA ESTETICO-LETTERARIA
Gli apprendenti compilano una semplice tabella:
autore
titolo
anno di edizione/produzione
personaggi/attori
genere letterario/cinematografico
individuano la voce del narratore (chi racconta?)
COMPETENZA INTERCULTURALE/TRANSCULTURALE
Gli apprendenti:
preparano un poster culturale o una bacheca elettronica (raccolgono termini, temi o fatti individuati nel testo letterario o filmico per contestualizzarlo, corredando ogni definizione con un’immagine o un link per avere ulteriori informazioni, approfondimenti)
confrontano la situazione, la storia del testo letterario/del film con le vicende del loro mondo
4. Attivare il discorso comunicativo transculturale nella classe di lingua straniera
La trama del giallo multietnico di Lakhous (2006) anticipava in maniera lungimirante la realtà contemporanea. Nella scuola superiore se ne possono proporre anche brevi sequenze o singoli capitoli, in base ai quali enucleare le principali coordinate narrative tramite un’interpretazione immanente/close reading (Hallet 2010a, 294).
La fabula del romanzo riflette e interpreta tutta una serie di situazioni e di conflitti, delicati e sensibili, che ne fanno un caso esemplare di come la letteratura transculturale contemporanea possa attivare, nella classe di lingua straniera, un dialogo creativo tra culture, lingue e testi letterari (Eisenmann 2015, 221).
2005, Roma: un’informativa dei servizi segreti ha messo le forze di polizia sulle tracce di un attentato organizzato dalla comunità islamica della capitale. L’indiziato numero uno è il titolare del Call Center “Little Cairo”, la cui insegna è visibile già sulla copertina del romanzo. Il giovane siciliano Christian – che per la storia migratoria della sua famiglia di origine padroneggia l’arabo tunisino, ed è laureato in lingua e letteratura araba – viene infiltrato, nei panni del tunisino Issa, disoccupato e senza fissa dimora, nel quartiere multiculturale di viale Marconi, dove presto trova un posto libero in un appartamento di 60 metri quadri (cucina, bagno, due camere da letto), in cui vivono già otto egiziani, un senegalese, un marocchino e un bengalese, tutti musulmani.
In prospettiva didattica, si offre la possibilità di insegnare a descrivere abitazioni, oltre che per proporre aggettivi di nazionalità difficilmente reperibili nei manuali di lingua, per lo più eurocentrici.
Safia, in tasca una laurea in lingue che non le è mai interessata molto, aveva scelto di sposare un giovane emigrato in Italia, dopo che lui aveva sborsato un bel po’ di quattrini per la shebka.Lakhous usa in questo caso l’espressione araba, il sostantivo che si riferisce ai gioielli con cui si omaggia la fidanzata prenotata. Un sostantivo che “però assomiglia a shabaka, un’altra parola che significa rete, come quella del pescatore” (Lakhous, 37): in questo caso una vera e propria trappola.
Safia aveva interpretato il trasferimento nella Mecca della moda come un segno del maktùb, del destino (op. cit. 38). Vivere a Roma le avrebbe permesso di realizzare il sogno coltivato fin dall’infanzia, nonostante le recriminazioni del padre per la sua scarsa ambizione: quello di diventare parrucchiera. Se non che il sogno si era infranto quando il promesso sposo, qualche giorno prima del matrimonio, le aveva imposto di portare il velo.
Come si può riconoscere già dalle poche informazioni e dalle coordinate del romanzo, nel suo testo Lakhous affronta volutamente – in un impianto linguistico plurilingue – aspetti culturali di carattere controverso, adatti per la motivazione e per la comunicazione in lingua straniera su temi della vita contemporanea; la diffusa paura del diverso, dello straniero, immagini stereotipate del mondo occidentale relativamente alla pericolosità di tutto ciò che diverge dalla norma e segnala, già in un nome straniero, una sorta di non appartenenza di carattere strutturale:
La prima domanda che ti fanno sempre è: come ti chiami? Se hai un nome straniero si crea immediatamente una barriera fra il “noi” e il “voi”. Il nome ti fa sentire subito se sei dentro o fuori, se appartieni al “noi” o al “voi”. Un esempio? Se vivi a viale Marconi e ti chiami Mohamed vuol dire automaticamente che non sei un cristiano o un ebreo, ma un musulmano. Giusto? Molto probabilmente non sei nemmeno italiano perché i tuoi genitori non lo sono. E allora? Allora niente. Non conta se sei nato in Italia, se hai la cittadinanza italiana, parli perfettamente l’italiano eccetera eccetera. Mio caro Mohamed, agli occhi degli altri non sei (e non sarai mai) un italiano doc, un italiano al cento per cento, un italianissimo. Diciamo che il nome è il primo marchio della nostra diversità (Lakhous, 22-23).
Queste riflessioni, che non sono solo percezioni fittizie di un personaggio del romanzo, ma indirettamente esprimono anche quelle meno fittizie dell’autore (di cui, in rete, si possono trovare molte interviste e videoclip), continuano con i primi ricordi di Safia riguardo ai primi mesi successivi all’arrivo in Italia. Ne fanno parte sia riserve mentali relative alle esperienze della vita sociale quotidiana, che difficoltà legate al fallimento della comunicazione, contestualizzate però in modo ironico. Questo si riferisce in particolare alla paura della gente nei confronti di una donna velata, che non soltanto viene indirettamente respinta, ma anche sovraccaricata del ruolo di potenziale simpatizzante del terrorismo:
I primi tempi in Italia sono stati durissimi. Quando uscivo per strada la gente mi guardava con una morbosità quasi ossessiva. […] negli occhi delle persone vedevo spesso fastidio, disagio, insofferenza e timore. E mi chiedevo: perché hanno paura di me? […] Ero sempre a braccetto con tanti accompagnatori fantasma: i loro nomi? Jihad, guerra santa, kamikaze, undici settembre, terrorismo, attentati, Iraq, Afghanistan, Torri gemelle, bombe, undici marzo, al-Qaeda, talebani. […] Insomma ero una sorta di Bin Laden, travestito da donna! (op. cit. 62)
In questo contesto si possono affrontare e discutere anche tradizioni quotidiane del mondo arabo, che rappresentano problemi e generano conflitti tra i cittadini arabi stessi, oltre che uno specifico uso della lingua, come emerge dalle riflessioni di Safia a proposito di sua figlia Aida:
Il nostro vicino di casa al Cairo, lo zio Attia, diceva: «Avere figlie è come tenere delle bombe a mano: è meglio sbarazzarsene in fretta!». A chi gli chiedeva quanti figli avesse, lui rispondeva sempre: «Tre maschi, quattro bombe a mano (da sistemare da qualche parte, insciallah) e due bombe atomiche (una zitella e una divorziata)» (op. cit. 29).
Le motivazioni con cui Safia/Sofia spiega la sua solidarietà con il velo, nata dopo aver subito a Roma un triste episodio di razzismo quotidiano – un signore cinquantenne aveva preteso di essere servito prima di lei al mercato, insultandola: “Una mummia che parla! Perché non te ne torni nel tuo paese? Perché venite qua da noi a fare casini, a diffondere fanatismo e a mettere le bombe, eh?” (Lakhous, 105) – si può leggere come un’argomentazione in chiave sociologica, una risposta al problema del velo. In un certo senso una replica al modo in cui una parte del mondo politico e della società sta affrontando la questione, scorporandola da aspetti identitari:
È vero che all’inizio non l’ho scelto, però adesso è il simbolo della mia identità, anzi è la mia seconda pelle. E allora? Allora niente. Non solo devo accettarlo, ma difenderlo pubblicamente. Non è più una questione di velo, di vestito, di tessuto, ma di dignità. Se non accettano il mio velo, vuol dire che rifiutano la mia religione, la mia cultura, il mio paese di origine, la mia lingua, la mia famiglia, in breve la mia intera esistenza. E questo è inaccettabile (op. cit. 105-106).
Per sottolineare ancora l’importanza della funzione educativa (e di conseguenza della funzione didattica) che i testi letterari possono rappresentare per la scuola, si riportano proprio le parole di Lakhous che, nel suo romanzo fa riferimento a problematiche attuali, presenti nella vita quotidiana della scuola, p.e. a proposito dell’abbigliamento:
La presenza dei musulmani in Italia e in Europa è una grandissima sfida per verificare lo stato della democrazia e il rispetto delle leggi. La costituzione italiana garantisce le libertà individuali, ma sul piano della realtà i musulmani si sentono discriminati perché non riescono ad avere luoghi di preghiera decenti. Sofia si chiede: perché le altre donne possono andare in giro semisvestite mentre lei deve combattere quotidianamente per il suo velo (Brogi 2011b, 8)?
Testi, o sequenze testuali come quelli presentati, contestualizzano un dibattito attuale, sempre più presente nelle classi multiculturali. Una rete intertestuale – che partendo da un testo letterario, lo mette in collegamento con interviste autentiche a uno scrittore con esperienze migratorie, per riflettere poi su altri materiali di attualità – potrebbe rendere più oggettivo, in una classe di lingua straniera, a scuola e all’università, un dibattito che invece, nella realtà, assume spesso toni molto emotivi, rischiando di portare i singoli a barricarsi su posizioni estreme relative alla cultura italiana, o a quella araba, per esempio.
Discutere in lingua straniera su diversi punti di vista può aiutare a mettere in primo piano non tanto le diversità, quanto piuttosto il diritto alle libertà individuali, garantito dalla Costituzione, che spesso non è invece garantito nella prassi, e che per questo può determinare impressioni di marginalizzazione, diventando terreno fertile per fraintendimenti culturali e conflitti. Proporre in classe punti di vista diversi, proprio a partire dall’input di un testo letterario, potrebbe contribuire a sviluppare negli apprendenti “die Fähigkeiten und die Bereitschaft zum Perspektivenwechsel, zur Perspektivenübernahme und zur Perspektivenkoordinierung” (Nünning 2007, 124).
Segue una proposta di attività didattiche per studenti universitari o scolari di livello progredito:
Quinto/sesto anno di studio/università
COMPETENZE LINGUISTICO DISCORSIVE
Attività di pre-lettura
Gli apprendenti, prima di leggere il testo
sulla base di immagini fornite dall’insegnante, del cover del testo letterario o del film, sulla base di articoli di giornale o di videoclip fanno previsioni sui contenuti, individuano il tema
si confrontano con elementi lessicali e sintattici
collegano elementi/temi del testo con il proprio mondo
attivano le loro preconoscenze sul tema, sul testo
attivano le loro conoscenze culturali (sul tema, sul periodo storico, sull’autore)
Attività durante la lettura
PRODU-ZIONE ORALE
PRODUZIONE SCRITTA
li apprendenti scrivono:
semplici dialoghi tra i personaggi
PRODUZIONE ORALE
redigono un diario di lettura (impressioni di lettura, collegamenti con altri testi letti, o con situazioni della propria vita)
dopo aver letto una sequenza, ne scrivono una continuazione
fanno un glossario dei
nuovi termini
discutono sulle prime impressioni
mettono in scena un breve dialogo tra i personaggi
descrivono immagini sul tema
parlano di problemi connessi al tema





























