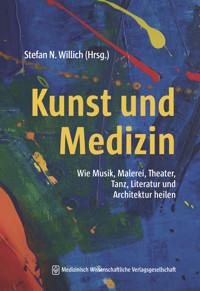
Kunst und Medizin E-Book
59,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Kunst, Medizin und Gesundheit haben vielfältige Berührungspunkte und eine lange Tradition. Schon in der griechischen Mythologie war Apollon der Gott der Künste. Künstlerische Therapieansätze (einschließlich bildende und darstellende Künste, Musik, Tanz und Literatur) werden seit vielen Jahrhunderten angewandt und auch heute noch in einigen medizinischen Einrichtungen angeboten. Trotz dieser langen praktischen Erfahrung gibt es bisher nur wenige wissenschaftliche Belege für ihre Wirksamkeit. Eine wichtige Grundlage für die Kunsttherapie bietet die Grundlagenforschung mit interessanten neuen Ansätzen zur Untersuchung möglicher Wirkmechanismen. Darüber hinaus ist die gesamtgesellschaftliche Bedeutung von Kunst für die Gesundheit ein wichtiges Thema, insbesondere im Hinblick auf präventive Effekte für die Bevölkerung. Das Buch bietet einen umfassenden Überblick, wie Kunst als gesundheitsfördernde Ressource genutzt werden kann und beleuchtet verschiedene Forschungsansätze. Darüber hinaus wird ein kurzer Rückblick auf die historische Entwicklung der Kunst in der Medizin gegeben. Erstmals wird aufgezeigt, welchen Einfluss Musik, Malerei, Tanz, Literatur und Architektur auf den Gesundheitszustand des Menschen haben und welche heilende Wirkung sie entfalten können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Stefan N. Willich (Hrsg.)
Kunst und Medizin
Wie Musik, Malerei, Theater, Tanz, Literatur und Architektur heilen
mit Beiträgen von
S. Bauer | A. Büssing | K. Dannecker | M. David | S. Diehm | P. van der Eijk | S. Elm | O. Ette | L. Feireiss | K. Grebosz-Haring | I. Grüner | H. - J. Hannich | S. - B. Hanser | K. Heid | U. Herrmann | M. Hildebrandt | C. Kaiser | J. Kinnen | W. Klitzsch | S. - C. Koch | G. Koppen | G. Kreutz | S. Matthys | C. Montag | K. Neumann | M. Ossowski | M. Paul | A. Pirmorady Sehouli | H.-P. Schmiedebach | L. Schwab | S. Scileppi | J. Sehouli | D. Vetter | T. - C. Vollmer | S. - N. Willich
Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft
Der Herausgeber
Prof. Dr. med. Stefan N. Willich, MPH, MBA
Charité – Universitätsmedizin Berlin
Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und
Gesundheitsökonomie
Berlin
MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
Unterbaumstr. 4
10117 Berlin
www.mwv-berlin.de
ISBN 978-3-95466-931-8 (eBook: PDF) ISBN 978-3-95466-932-5 (eBook: ePub)
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Informationen sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Berlin, 2025
Dieses Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Im vorliegenden Werk wird zur allgemeinen Bezeichnung von Personen nur die männliche Form verwendet, gemeint sind immer alle Geschlechter, sofern nicht gesondert angegeben. Sofern Beitragende in ihren Texten gendergerechte Formulierungen wünschen, übernehmen wir diese in den entsprechenden Beiträgen oder Werken.
Die Verfasser haben große Mühe darauf verwandt, die fachlichen Inhalte auf den Stand der Wissenschaft bei Drucklegung zu bringen. Dennoch sind Irrtümer oder Druckfehler nie auszuschließen. Daher kann der Verlag für Angaben zum diagnostischen oder therapeutischen Vorgehen (zum Beispiel Dosierungsanweisungen oder Applikationsformen) keine Gewähr übernehmen. Derartige Angaben müssen vom Leser im Einzelfall anhand der Produktinformation der jeweiligen Hersteller und anderer Literaturstellen auf ihre Richtigkeit überprüft werden. Eventuelle Errata zum Download finden Sie jederzeit aktuell auf der Verlags-Website.
Produkt-/Projektmanagement: Theresa Koch, Anja Faulenbach, Berlin
Copy-Editing: Monika Laut-Zimmermann, Berlin
Layout & Satz: zweiband.media, Agentur für Mediengestaltung und -produktion GmbH, Berlin
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
Cover: Pixabay © Steve Johnson
Zuschriften und Kritik an:
MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Unterbaumstr. 4, 10117 Berlin, [email protected]
Geleitwort
„Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele. “ (Pablo Picasso)
Diese bedeutende Erkenntnis des berühmten Malers Pablo Picasso mag den Anstoß dazu gegeben haben, sich intensiv und systematisch mit dem Einsatz künstlerischer Mittel im Gesundheitswesen auseinanderzusetzen. Denn ganz offensichtlich lohnt es sich – im individuellen wie im gesamtgesellschaftlichen Kontext.
Mein Vater war niedergelassener Allgemeinmediziner und Psychotherapeut in Münster. Seinen ganzheitlichen therapeutischen Ansatz hat er mit der Bemerkung begründet, in seiner Praxis sehe er Erkrankungen, die zu fast 80% psychosomatisch begründet seien – er kannte bei fast allen seiner Patienten die familiären und sozialen Hintergründe. Vielleicht ist es deshalb kein Zufall, dass seine Tochter, meine Schwester, nach einer Phase als professionelle Tänzerin heute als Tanztherapeutin in einer Reha-Klinik auf Usedom arbeitet. Ein Patient bedankte sich für die Betreuung zum Beispiel wie folgt: „Mein Dank gilt der Tanztherapie: ich habe eine alltagstaugliche Methode kennengelernt, um konstruktiv mit meiner Krankheit und mit meiner Wut umgehen zu können.“ Alltagstauglich und konstruktiv – das ist doch ein schöner Dank.
Und in der Tat: Auch in der Gesellschaft als Ganzem ist es nicht zuletzt die Kultur, die für ein gesundes Gemeinwesen sorgt. In Deutschland jedenfalls hat die Kultur in den vergangenen Jahrhunderten immer eine bedeutende Rolle gespielt. Sie war das geistige Band gerade in jenen Zeiten, in denen die staatliche Einheit noch nicht verwirklicht war. Ein föderaler Staat und auch eine heterogene Gesellschaft brauchen diese kulturelle Klammer, um die eigene Herkunft und das Erbe, das uns prägt, wertzuschätzen. Bereits Wilhelm von Humboldt wusste: „Nur wer seine Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft.“ Vergangenheit und Zukunft, Vielfalt und Identität spiegeln sich in der Kultur eines Landes – ähnlich wie im Leben eines Individuums.
Nationale Identität wächst vor allem aus dem Kulturleben eines Landes. Dazu gehört nicht allein das kulturelle Erbe vergangener Zeiten, sondern vor allem auch das Neue, die Avantgarde. Damit dies möglich wird, müssen Kunst und Kultur unabhängig sein vom Zeitgeist und von Geldgebern, sie brauchen Freiraum, um sich entfalten zu können. Sie benötigen Inspiration, Anstöße und den öffentlichen Diskurs. Was sie nicht brauchen, sind autoritative Vorgaben. Eine sich frei gebärdende Kunst muss dann auch nicht unbedingt gefallen, sie darf und muss zuweilen auch Zumutung sein. Auch dieses Wissen lässt sich sicher auf den Umgang mit dem einzelnen Menschen übertragen. Freiheit, Inspiration, keine autoritativen Vorgaben – viele Ärzte wissen, wie wertvoll derartige Impulse im Umgang mit gesunden wie mit kranken Menschen sein können.
Die staatliche Fürsorge für die Kultur, die Verteidigung ihrer Freiheit, die mit dem Mut zum Experiment immer auch das Risiko des Scheiterns in Kauf nimmt, dafür aber auch immer wieder beachtliche Leistungen ermöglicht hat, dieses hartnäckige Engagement für die Künste hat entscheidenden Anteil an unserer offenen Gesellschaft, an einem lebendigen Gemeinwesen und nicht zuletzt am hohen Ansehen Deutschlands in der Welt. Das alles kann furchtbar anstrengend sein, es verlangt uns viel Toleranz ab, man muss Zumutungen auszuhalten gewillt sein, das kann man lernen – und am Ende auch viel gewinnen. Denn eine sich derart entfaltende Kultur ist nicht das Ergebnis des Wirtschaftswachstums, sondern sie ist dessen Voraussetzung. Die Kultur, die Künste sind die Avantgarde, sie gehen der gesellschaftlichen Wirklichkeit, auch der Wirtschaft, voraus. Kultur ist deshalb nicht nur eine bedeutende Zukunftsressource, sondern der Umgang mit der Kultur gewinnt an Gewicht, weil gesellschaftliche Prozesse und Konflikte in zunehmendem Maße kulturell grundiert sind. Das Bekenntnis zur Kultur ist so auch immer ein Bekenntnis zu den Wertegrundlagen einer Gesellschaft. Kulturelle Existenz ist keine „Ausstattung“, die eine Nation sich leistet, sondern sie ist eine Vor-Leistung, die allen zugutekommt. Kultur ist kein dekorativer Luxus, sondern ein menschliches Grundbedürfnis. Sie ist nicht nur ein Standortfaktor, sondern sie ist vor allem eins: Sie ist Ausdruck von Humanität.
Wir werden diesem hehren Anspruch vielleicht nicht immer gerecht; aber das Wissen um die Bedeutung der Kultur, um die Kraft der Künste und der Kunst, um das Zulassen eines unbedingten Ausdruckswillens – das alles kann ein wichtiger Antrieb sein, sich um die Verwirklichung eines guten Miteinanders mit genau diesen Mustern und Methoden der Kunst zu bemühen. Ich bin fest davon überzeugt: Kunst, als Ausdruck eines menschlichen Grundbedürfnisses, kann im Großen wie auch im Kleinen heilend wirken.
So wie eine weitere Patientin meiner Schwester für sich ganz persönlich bekannte: „Meine Lebensfreude kehrte erst wieder zurück durch die Freude am Tanz! Diese habe ich mir in der Tanztherapie wieder erarbeitet.“
Und als ganz allgemeine Erkenntnis hat es Oscar Wilde einmal so formuliert:
„Das ist eines der Geheimnisse des Lebens: Die Seele durch die Sinne zu heilen und die Sinne durch die Seele. […] Es kommt darauf an, den Körper mit der Seele und die Seele durch den Körper zu heilen.“
In diesem Sinne wünsche ich dem vorliegenden Buch viele Leserinnen und Leser.
Prof. Monika Grütters
im Januar 2025
Vorwort
Musik kann heilen. Versuchen Sie es: beim Hören des langsamen Satzes aus Beethovens Neunter Sinfonie verändern sich der Blutdruck, Herzschlag und Atmung. Wenn Sie andere Musik bevorzugen, sind die körperlichen Reaktionen ähnlich.
Studien zeigen die Wirkung von Musik auf Frühgeborene. Die Babys reagieren mit Kopfbewegungen, die feinen Klänge haben positive Auswirkungen auf Sauerstoffsättigung und Lungenreifung. Die Verweildauer in der Klinik verkürzt sich. Manche Rehabilitationszentren bieten für Patienten mit Krebs, Herzkreislauf- oder neurologischen Erkrankungen regelmäßig Mal-Workshops, Klangmeditationen und Tanztherapien an. Mit Kunst die Gesundheit verbessern, mit Kunst der Medizin die Seele zurückgeben, mit Kunst moderne Medizin mitgestalten: darum geht es in diesem Buch, damit haben sich unsere Autorinnen und Autoren aus verschiedenen Fachbereichen auseinandergesetzt.
Wir alle wissen: Kultur und Kunst haben einen wichtigen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Konzerte, Theater, Museen und Bücher bieten bereichernde und beglückende Erfahrungen. Darüber hinaus aber, und dies ist viel zu wenig bekannt, können Musik, Malerei, Tanz und Literatur die Gesundheit verbessern und zur Heilung beitragen. Dieses Potenzial wird bisher kaum genutzt, Medizin und Kunst erscheinen getrennt, mit völlig unterschiedlichen Ansätzen. Der eine, so heißt es, sei naturwissenschaftlich effizient, sachlich ausdifferenziert, nüchtern und der andere phantasievoll, mit vielschichtigen Kriterien bewertet und wenig substanziell in der Wirkweise. Ein Irrtum! Beide Bereiche waren in der Medizingeschichte lange traditionell eng verbunden, wie der Ausdruck „Heilkunst“ beweist. In der Antike war der Gott Apollon für beides zuständig, als Gott der Künste und der Heilung. Mittlerweile zeigen viele wissenschaftliche Studien einen gesundheitlichen Nutzen von künstlerischen Therapien. Künste haben viel zu bieten, vor allem für Patientinnen und Patienten, die Diagnosen sind unterschiedlich, die Krankheitsbilder ebenso. Kunst nutzt aber auch den Mitarbeitenden in gesundheitlichen Berufen als Ressource, und nicht nur ihnen. Kunst kann vielen Menschen verschiedener Lebensformen und Berufe helfen, nicht zu erkranken oder mit bestehenden gesundheitlichen Problemen besser umzugehen.
Unsere Gesellschaft leistet sich eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt und gibt viel Geld für Kultur aus. Aber die offensichtlichen Synergien beider Bereiche werden bisher nicht ausgeschöpft, ganz im Gegenteil, die Barrieren für kulturelle Teilhabe sind für viele Bevölkerungsschichten hoch. Kunst und Kultur können und sollten die Gesellschaft und auch das Gesundheitssystem inspirieren und befruchten. In diesem Kontext haben auch Architektur, die Gestaltung von Krankenhäusern, Gesundheitseinrichtungen und Park- und Gartenanlagen eine besondere Bedeutung. Licht, Formen, Farben, Perspektiven und Raumgestaltung spielen für Heilungsprozesse eine wichtige Rolle. Aber es gibt bisher nur wenige Kliniken, die solche baulichen und atmosphärischen Aspekte berücksichtigen. Die meisten Klinikbauten sind nüchtern und funktional konzipiert, haben den zweifelhaften Charme von Fabriken, mit abwaschbaren weiß gestrichenen Wänden, Behördenfußbodenbelägen, kühl flimmerndem Neonlicht.
Es ist höchste Zeit, diese Themen voranzubringen. Vor allem im Sinne von Patientinnen und Patienten mit chronischen oder lebensbedrohlichen Erkrankungen. Hier geht es neben der bestmöglichen konventionellen Therapie auch um verbesserte Lebensqualität, um sinnstiftende Perspektiven, Mobilisierung der persönlichen emotionalen Ressourcen. Besonders deutlich sind diese Bedürfnisse, wenn man Patienten fragt, welches Ambiente und welche Betreuung sie sich beim Sterben wünschen. Aber auch für die Mitarbeitenden in Gesundheitsberufen und anderen Sektoren können künstlerische Angebote einen hohen Stellenwert haben.
Die schmerzhaften Pandemiejahre waren geprägt von enormen gesundheitlichen Gefahren und Belastungen einerseits. Andererseits waren Kulturveranstaltungen wie Konzerte, Opern, Theater, Lesungen oder der Besuch von Museen verboten. Ohne künstlerische Ressourcen waren das Leiden der Betroffenen und die Anspannung des Gesundheitswesens umso gravierender. Nach diesen bitteren Erfahrungen ist es geboten, die Bereiche Medizin und Kunst zusammenzuführen und künstlerische Angebote in die moderne Medizin und unsere Gesundheitsversorgung zu integrieren. Dieses Buch widmet sich mit spannenden Beiträgen führender Autorinnen und Autoren den entscheidenden thematischen Facetten. Außerdem werden interessante, umfassende und genussvolle Einblicke in das wichtige Potenzial von Kunst für die Medizin gegeben. Das Werk erläutert die historischen Entwicklungen und erklärt die allgemeinen Grundlagen der Kunst in der Medizin. Danach folgen genaue Einblicke in die künstlerischen Sparten: Musik, bildende Kunst, darstellende Kunst, Literatur und Film. Es werden auch die attraktiven Möglichkeiten für Künstlerinnen und Künstler im Gesundheitssektor offensichtlich. Künstlerische Aktivität verbunden mit therapeutischer Empathie eröffnen viele neue berufliche Perspektiven. Ebenso von großer Bedeutung sind die Bereiche Kunst und Public Health sowie Architektur und Medizin. Hierbei wird auf die gesundheitliche Relevanz von Kunst, Garten- und Parkgestaltung im öffentlichen Raum eingegangen und die enorme Wichtigkeit der Krankenhausgestaltung betont. Zwei besondere Exkursbeiträge schmücken das Buch und runden den Inhalt ab: über die persönlichen Verbindungen als Arzt und Dirigent bzw. bildender Künstler.
Im Hinblick auf eine konsequente Etablierung von Kunst in der Medizin könnte der Einwand kommen, ob hierdurch nicht weitere Kosten auf das Gesundheitssystem zukommen. Zur definitiven Klärung wären gesundheitsökonomische Analysen notwendig, die den Aufwand z.B. durch Kunsttherapien ins Verhältnis setzen zum gesundheitlichen Nutzen. Bisherige Einschätzungen deuten eine hohe Kosteneffektivität an, d.h. die Investitionen sind lohnend. Zudem ergibt sich im Hinblick auf die anstehenden Krankenhausreformen das Potenzial, mit der Integration von Kunst in Krankenhäusern nicht nur Patientinnen und Patienten zu helfen, sondern auch die Zufriedenheit und Resilienz von Mitarbeitenden zu stärken – Kunst als kompetitiver Vorteil im zunehmenden Wettbewerb klinischer Einrichtungen.
Ich bedanke mich bei den großartigen Autorinnen und Autoren für viele fruchtbare Diskussionen und die spannenden und visionären Texte. Dieses Buchprojekt ist zeitlich und fachlich angelehnt an die Entwicklung des innovativen Netzwerks Kunst und Medizin an der Charité und der neuen International Society for Artsand Medicine (ISfAM), den thematisch engagierten Kolleginnen und Kollegen und Kooperationspartnern verdanke ich viele Anregungen und Ermutigung. Mein besonderer Dank gilt dem Verleger Dr. Thomas Hopfe, der dieses Projekt auch zu seiner Herzensangelegenheit machte. Obwohl sich unser Buchprojekt während der Pandemiejahre durch meine vielseitigen Aufgaben als Epidemiologe verzögert hat, blieb Herr Hopfe immer am Ball als umsichtiger und konstruktiver Verlagspartner. Ein großer Dank gilt den Mitarbeitenden der Medizinisch Wissenschaftlichen Verlagsgesellschaft, allen voran Theresa Koch und Anja Faulenbach für die konstruktive, unterstützende und zuverlässige Umsetzung.
Ihnen wünsche ich beim Lesen viel Genuss, gute Gedanken und viele unterhaltsame und informative Anregungen. Ich bin überzeugt, dass die Künste in der modernen medizinischen Versorgung der Zukunft eine wichtige Rolle spielen und zu unserer Gesundheit beitragen werden.
Stefan N. Willich
im Januar 2025
Inhalt
IHistorische Entwicklungen
1Geschichten, Aphorismen und andere Kunstformen in der antiken MedizinPhilip van der Eijk
2Die Gärten des Äskulap – heilsame Räume im antiken Griechenland und RomSusanna Elm
3Kunst und Medizin seit der Renaissance – eine SkizzeHeinz-Peter Schmiedebach
IIGrundlegende Betrachtungen
1Kunst, die verlorene Seele der Medizin – eine soziologische BetrachtungWolfgang Klitzsch
2The Healing Arts – Begegnungen zwischen Wissenschaft und WissenskunstLukas Feireiss
3Medizin und Kultur – eine untrennbare VerbindungAdak Pirmorady Sehouli
4Kunstbetrachtung und psychische GesundheitUwe Herrmann
IIIMusik und Medizin
1Musiktherapie in der NeonatologieStephanie Scileppi
2Integrative MusiktherapieSuzanne B. Hanser
EXKURS:Medizin und Musik – Betrachtungen eines Arztes und DirigentenStefan N. Willich
3Musiktherapie in der PsychosomatikSusanne Bauer
4Musik und MedizinStefan N. Willich
5Singen und GesundheitGunter Kreutz und Katarzyna Grebosz-Haring
IVBildende Kunst und Medizin
1Kunsttherapie in der MedizinKarin Dannecker
2Kunsttherapie in der Psychiatrie und PsychotherapieChristiane Montag
3Kunst und ChirurgieDiana Vetter
EXKURS:Medizin und Kunst – Arzt und Bildender KünstlerKlaus Heid
4Bilder von Krankheit und HeilungMartin Hildebrandt
VDarstellende Kunst und Medizin
1Theater und Heilung – die geschichtliche Entwicklung ihrer VerbindungCéline Kaiser
2Theatertherapie zur Resilienzstärkung bei Kindern nach der Flut im Ahrtal 2021Sabine C. Koch und Julie Kinnen
3Wirkfaktoren der Tanz- und Bewegungstherapie aus Sicht der PatientenLaura Schwab und Sabine C. Koch
4Tanz und BewegungstherapieArndt Büssing
VILiteratur und Medizin
1Poesie heiltMaria Ossowski
2Die heilende Kraft der Literatur – von Tausendundeiner Nacht bis David WagnerOttmar Ette
3Gesundheitsförderndes Kreatives SchreibenSusanne Diehm
4Literatur und Medizin – Parallelwelten oder Teil eines ganzheitlichen medizinischen AnsatzesJalid Sehouli
VIIFilm und Medizin
1Trauma, Tabu, Tragödie – Medizin im Film am Beispiel SchwangerschaftsabbruchMatthias David
2Medizin im Spielfilm als Projektionsfläche der GesellschaftMartin Paul
VIII Kunst und Public Health
1Kunst und GesundheitsförderungHans-Joachim Hannich
2Die Bedeutung der Gartenkunst als Bestandteil der GesundheitskulturKlaus Neumann
IXArchitektur und Medizin
1Kunst und Krankenhausbau – eine heilende Symbiose?Stefanie Matthys
2Healing Art – wie die Verbindung von Kunst, Klinikarchitektur und Gesundheit gelingen kannIsabel Grüner
3Baukunst als HeilkunstTanja C. Vollmer und Gemma Koppen
IHistorische Entwicklungen
1Geschichten, Aphorismen und andere Kunstformen in der antiken Medizin
Philip van der Eijk
Die Einführung des neuen Studiengangs Narrative Medicine an der medizinischen Fakultät der Columbia Universität in New York im Jahr 2000 war ein wichtiger Schritt hin zu einem neuen Bewusstsein für die Rolle von Sprache und Literatur in der Medizin und für den narrativen Charakter medizinischer Kenntnisse und Erfahrungen. Seitdem hat sich die narrative Medizin an vielen medizinischen Fakultäten, auch in Deutschland – und auch in Berlin – weiterentwickelt und als Disziplin etabliert (Wohlmann et al. 2022). Dieses Bewusstsein hat aber eine lange Vorgeschichte, die bis in die Antike zurückgeht, als das Erzählen und überhaupt die literarische Darstellung von Gesundheit und Krankheit eine wichtige Rolle im medizinischen Denken und Handeln spielte.
1.1Die antiken Wurzeln der narrativen Medizin
Bereits in den Schriften, die dem griechischen Arzt Hippokrates (460–370 v. Chr.) zugeschrieben werden – die aber in Wirklichkeit das Werk mehrerer medizinischer Autoren sind, die hauptsächlich aus dem 5. und 4. Jh. v. Chr. stammen und miteinander in engem Kontakt standen –, finden wir zahlreiche Geschichten, die den Verlauf einer Krankheit bei konkreten, manchmal mit Namen angegebenen Patienten (Männer, Frauen und Kinder) belegen. Diese Fallgeschichten waren ursprünglich vermutlich an erster Stelle für den Arzt selbst als aide mémoire bei seinen Krankenbesuchen gedacht. Im Austausch mit Kollegen dienten sie dann aber bald auch einem auf Erkenntniszuwachs hin gerichteten Ziel, indem klinische Beobachtungen fixiert und mit anderen Ergebnissen in Verbindung gebracht wurden. Das in dieser Form gesammelte Wissen, welches auf einer Kombination empirischer Beobachtungen und theoretischer Konzepte beruhte, konnte so induktiv zu allgemeineren Einsichten führen und die Grundlage für eine umfassendere medizinische Versorgung bilden, wie es an einer Stelle heißt, wo der Arzt schreibt: „Meine Beurteilung basierte auf der individuellen Natur jedes einzelnen Patienten und auf der gemeinsamen Natur aller Patienten“ (Hippokrates 2022).
Kennzeichnend für die ‚hippokratischen‘ Fallgeschichten ist ihre nüchterne Schlichtheit (Notizenstil), die allerdings auch eine geschickte, bewusst gepflegte Schmucklosigkeit ist und ein gewisses ärztliches Berufsethos zum Ausdruck bringt (Hellweg 1985). Der Verlauf der Erkrankung wird von einem auf den anderen Tag beschrieben. Der Text erwähnt manchmal auch Symptome, die der Arzt nur mündlich vom Patienten selbst hat erfahren können und reflektiert somit indirekt auch die Perspektive des kranken Menschen (Thumiger 2016). Auffällig ist, dass viele dieser ‚hippokratischen‘ Fallgeschichten mit dem Tod des Patienten enden: es sind also keineswegs immer success stories.
Typisch für die griechische Medizin dieser Zeit ist ein sachlicher Realismus, der die Grenzen und Misserfolge ärztlichen Handelns nicht verschweigt.
Ganz anders sehen die Fallgeschichten im Werk des großen Mediziners und Philosophen Galen von Pergamon (129–215 n. Chr.) aus. Galen, der der Leibarzt des römischen Kaisers Mark Aurel war und eine extrem erfolgreiche Karriere durchlaufen hatte, liebte die Anekdote und es gibt hunderte solcher Geschichten in seinem umfangreichen Œuvre (Mattern 2008; Golder 2020). Im Gegensatz zu den hippokratischen Fallgeschichten, in denen der Autor anonym bleibt und der Patient an zentraler Stelle steht, ist Galen selbst der Hauptprotagonist seiner eigenen, in die Ich-Form gesetzten Narrative. Er beschreibt wie er als Arzt die Situation einschätzt, wie er mit schwierigen, anspruchsvollen oder widerstrebenden Patienten umgeht und wie der Verlauf der Erkrankung ihm in seiner Diagnose recht gibt, entweder dadurch, dass der Patient geheilt wird – denn hier sind die meisten Fälle tatsächlich Erfolgsgeschichten – oder die Situation sich gemäß Galens Erwartung – und oftmals wegen der Missachtung seiner Ratschläge durch die Patienten und ihre Angehörigen – verschlechtert. Die Fallgeschichten dienen hier also nicht so sehr der selbstlosen Wahrheitsfindung und dem weiteren Aufbau eines immer wachsenden Wissensbestandes, sondern eher der rhetorischen Selbstdarstellung und Selbstrechtfertigung des Arztes (Lloyd 2009). Dies hat damit zu tun, dass die Medizin in der Zeit Galens ein sehr kompetitives Feld war, in dem unterschiedliche Schulen und Denkrichtungen miteinander konkurrierten und gegeneinander polemisierten. Galen schildert auch mehrmals, wie er sich anhand konkreter Einzelfälle mit anderen Ärzten auseinandersetzt.
Wieder eine andere Funktion haben die Fallgeschichten bei unserem dritten Beispiel, diesmal aus der Spätantike, nämlich bei Stephanos von Alexandrien (6.–7. Jh. n. Chr.). Stephanos war Professor für Medizin und Philosophie an der dortigen Universität, die eines der wichtigsten Forschungszentren der Alten Welt war. Für seine Lehrtätigkeit benutzte Stephanos das Format des Kommentars zu den Werken berühmter Vorgänger, d.h. Hippokrates und Galen für die Medizin sowie Aristoteles und Platon für die Philosophie. Stephanos war aber auch praktizierender Arzt und seine klinische Erfahrung war für ihn eine wichtige zusätzliche Informationsquelle. In seinen Kommentaren zu Hippokrates und Galen finden wir daher auch viele Fallgeschichten. Diese erfüllen eine klare didaktische Funktion, indem sie Medizinstudenten anhand konkreter Beispiele folgendes vor Augen führen:
wie man einen Patienten untersuchen und welche Fragen man ihm stellen muss,
auf welche Symptome man besonders achten soll und
was man tun muss, wenn ein Patient so oder so auf die Behandlung reagiert.
Manche dieser Fallbeschreibungen bezeichnet Stephanos als hypothetisch, d.h. sie beschreiben keinen realen casus, sondern eine imaginäre, für didaktische Zwecke konstruierte Situation. In diesen Fallgeschichten wird manchmal der gute, hippokratische, d.h. wissenschaftliche und vorbildliche Arzt dem schlechten, oberflächlichen und nur auf äußeren, augenscheinlichen Erfolg ausgerichteten Arzt gegenübergestellt.
1.2Texte von Ärzten für Ärzte und Patienten
In den oben beschriebenen Fällen haben wir es mit Texten zu tun, die von Ärzten geschrieben sind und literarische Qualität beanspruchen. Dieses Phänomen des schreibenden Arztes ist uns aus der Neuzeit bekannt: zu denken wäre an Arthur Schnitzler im 19., Gottfried Benn im 20., oder – um ein Berliner Beispiel zu nennen – den Charité-Onkologen Jalid Sehouli im 21. Jahrhundert. Es war aber auch in der Antike schon weit verbreitet. Der Arzt musste nicht nur ein kompetenter Fachmann, sondern auch ein Wortkünstler sein, der sich literarisch geschickt, zielsicher und elegant ausdrückte, um effektiv mit Kollegen und Schülern, aber auch mit (potenziellen) Patienten zu kommunizieren, ihr Verständnis für ihre eigene Situation zu fördern, ihr Vertrauen zu erwecken und sie somit von der Wichtigkeit ihres Mitwirkens bei der Behandlung zu überzeugen. Denn das Publikum dieser Texte waren nicht nur andere Ärzte oder Medizinstudenten, sondern in manchen Fällen auch der Typus von Patient, den es für den Arzt in dem genannten kompetitiven Setting zu überzeugen galt und der sich bei seiner Wahl eines Arztes gern gut informieren ließ. Ärzte in der Antike hielten rhetorisch ausgefeilte öffentliche Vorträge – die auch für Nichtfachleute verständlich und für Zuhörer, die nicht lesen konnten, zugänglich waren – und schrieben künstlich gestaltete Briefe. Eine weitere beliebte literarische Gattung war der Aphorismus, in dem der Arzt sein Erfahrungswissen ganz knapp und virtuos auf den Punkt bringen konnte.
Unter dem Namen von Hippokrates sind mehr als vierhundert Aphorismen überliefert: kurze, prägnante Sprüche, die Weisheit zum Ausdruck bringen, welche auf Lebens- und Berufserfahrung gegründet ist.
Durch ihre Knappheit sind die meisten Aphorismen einfach im Gedächtnis zu behalten, und sie waren daher auch für den medizinischen Unterricht sehr geeignet. Viele Aphorismen sind aber nicht eindeutig, möglicherweise absichtlich rätselhaft. Aus eben diesem Grund boten sie von Anfang an viel Spielraum zur Interpretation. Auch im Mittelalter (Maimonides), in der Frühen Neuzeit (Hermann Boerhaave) und im 20. Jahrhundert (William Osler) war die Gattung des Aphorismus bei Ärzten sehr populär.
Was dieser medizinischen schriftstellerischen Tätigkeit auf einem tieferen Niveau zugrunde lag, war das Bewusstsein einer Parallele zwischen der ärztlichen und der literarischen Beobachtung und der Gedanke, dass die literarische Form nicht nur eine ästhetische, sondern auch eine kognitive Funktion erfüllt, indem die textliche Darstellung eine Ordnung, Sinngebung und Deutung der medizinischen Sachverhalte mit sich bringt (s. Abb. 1). Das Erzählen eines Krankheitsverlaufs zwingt ja zur Identifizierung, Benennung, hierarchischen Gliederung und zeitlichen Ordnung der Phänomene und manchmal auch zur Herstellung eines kausalen Zusammenhangs und kann sowohl für den Arzt als auch für den Patienten ein Weg sein, die Erkrankung genauer zu erfassen und geistig zu bewältigen.
Eine ähnliche Doppelfunktion kommt auch der Kurzform des Aphorismus zu: das Erfinden und Formulieren von Aphorismen kann eine Methode zur Schärfung der diagnostischen Fähigkeiten des Arztes sein und darum auch eine wichtige Rolle in der medizinischen Ausbildung erfüllen (Levine u. Bleakley 2012). Aber auch für den Patienten kann es erhellend sein, seine Situation in Form einer knappen, prägnanten Aussage dargestellt zu bekommen und es kann sogar motivierend und anregend sein – im Sinne von Empowerment –, selbst aktiv das eigene Erleben dieser Situation in Form eines Aphorismus zum Ausdruck zu bringen.
Abb. 1 Die kognitive Funktion der medizinischen Literatur: lesender Arzt in seiner Werkstatt (Relief auf einem römischen Sarkophag 4. Jh. n. Chr.)
1.3Die Perspektive des Patienten
Das bringt uns zur Perspektive des Patienten und zur Frage nach seinem Erleben und Praktizieren von künstlerischen Äußerungen und Formen. In der Antike gab es ein starkes Bewusstsein der gesundheitsfördernden und therapeutischen Wirkung von Literatur (‚die Therapie des Wortes‘), aber generell auch von Musik, Theater, Tanz, bildender Kunst und Architektur. Die Wirkung von Musik auf die menschliche Seele war den meisten griechischen und römischen Ärzten bekannt und Musiktherapie wurde bei der Behandlung einer Reihe von v.a. psychosomatischen Krankheiten eingesetzt (West 2000; Kümmel 1977). Sie wurde mit theoretischen Annahmen (die man z.B. bei Platon und Pythagoras findet) über das Verhältnis zwischen verschiedenen Tonarten und Musikinstrumenten einerseits und bestimmten seelischen Zuständen andererseits begründet. Auch das Hören und Lesen von Erzählungen und Gedichten wurde von mehreren antiken Ärzten als eine gesundheitsfördernde Maßnahme und in der Behandlung von konkreten Erkrankungen empfohlen – unwillkürlich denkt man hier an die Märchentherapie, die heutzutage bei bestimmten psychiatrischen Krankheiten eingesetzt wird. Das Selbst-Lesen, das in der Antike meistens ein lautes Vorlesen war, erfüllte hier nicht nur eine die Seele betreffende, kognitive Funktion – z.B. durch die Lektüre absichtlich falsch geschriebener Texte, um die mentale Fähigkeit des Patienten zu testen –, sondern sollte manchmal auch eine den Körper betreffende, stimmbildende, dem Singen verwandte Wirkung ausüben (von Staden 2002). In diesem Zusammenhang ist die Auffassung von Aristoteles (384–322 v. Chr.) zu erwähnen, dass Menschen während eines Theaterbesuchs, bei der Aufführung einer Tragödie – einem Geschehen, das mit Gesang und Tanz und zahlreichen visuellen und akustischen Effekten einherging – eine gefühlsmäßige Läuterung, eine katharsis, erleben können, die ihnen wohl tut, weil sie nicht nur bestimmte Emotionen hervorbringt, sondern auch zu ihrer Auflösung und somit zur Entspannung, Erleichterung, Erholung und Beruhigung beiträgt. Es geht hier vor allem um die Emotionen von Mitgefühl und Angst, die sich aus der Identifizierung mit dem Protagonisten in seiner Situation und in dem, was ihm widerfährt, ergeben und oft mit körperlichen Erscheinungen (Zittern, Weinen) einhergehen.
Der Begriff katharsis stammt aus der Medizin und bedeutet Reinigung, meistens im ganz konkreten, körperlichen Sinne.
Es geht hier also um ein richtiges „Ausheulen“. Aristoteles war der Sohn eines Arztes und kannte sich in der Medizin gut aus. Er geht sogar so weit, dass er dieses kathartische Potenzial auch der Erzählung selbst zuschreibt, also ohne theatralische Inszenierung: allein das Lesen oder Hören vom Schicksal eines Ödipus kann schon ein Zittern hervorbringen und zu einem intensiven emotionalen Erlebnis führen.
1.4Patienten als Künstler
Die meisten der bisher genannten Beispiele betreffen das eher passive Erleben und Genießen von Kunst, das Hören von Musik und von Erzählungen oder das Zuschauen im Theater. Weniger bekannt ist, dass es in der Antike auch schon Formen einer aktiven Kunsttherapie gab, vergleichbar mit den Behandlungsweisen, wie wir sie heute kennen, in denen die Patienten selbst kreativ tätig sind und so an der Genesung mitwirken. So finden wir bei Galen Hinweise auf das, was man heutzutage als gesundheitsförderndes kreatives Schreiben bezeichnen würde. An einer Stelle in seiner Abhandlung über die Gesundheit, wo er über die Behandlung psychosomatischer Erkrankungen spricht, verweist er auf die Asklepiosmedizin, mit der er aus seiner Heimatstadt Pergamon sehr gut bekannt war und der er aufgeschlossen gegenüberstand. Er schreibt, dass Asklepios mehrere seiner Patienten beauftragt hatte, Lyrik zu schreiben, Skizzen von Komödien zu entwerfen und Gesänge zu komponieren, um so das seelische Ungleichgewicht, das bei ihnen auch zu körperlichen Schäden geführt hatte, zu korrigieren (Galen 2023). Leider haben wir keine weiteren Informationen über die Art dieser Therapie. Sie findet aber eine Bestätigung in dem Bericht eines Zeitgenossen Galens, Aelios Aristides – des einzigen Patienten aus der Antike, aus dessen Mund wir ausführliche, wenn auch literarisch sehr stilisierte Berichte über das Erleben seiner Krankheit haben – der von sich selbst erzählt, dass er im Rahmen seiner Erkrankung und deren Behandlung ebenfalls von Asklepios beauftragt wurde, Lyrik zu komponieren (Aelios 1968). Dass in der Asklepiosmedizin Kunst generell eine wichtige Rolle spielte, wird durch die Anwesenheit von Theatern in oder bei den Asklepiosheiligtümern (z.B. in Epidauros oder Kos) belegt. Galen aber empfiehlt auch im Rahmen seiner eigenen medizinischen Praxis eine Art Schreibtherapie zum Bewahren des seelischen Gleichgewichts und zur Bewältigung von emotionalen Störungen, z.B. durch ein Tagebuch, in dem man sein eigenes Erleben und Verhalten des vorangegangenen Tages reflektiert. Die Wichtigkeit der aktiven Beteiligung des Patienten an der Therapie und die Bedeutung des Selbst-Erzählens, die in der heutigen narrativen Medizin immer mehr Beachtung findet, wurde also bereits in der Antike anerkannt und das kreative Schreiben wurde sowohl präventiv als auch in der Behandlung von Störungen und Erkrankungen eingesetzt.
Literatur
Aelios A (1968) Heilige Reden. In: Behr C (Hrsg.) Aelius Aristides and the Sacred Tales. Hakkert Amsterdam
Asper M (2020) Thinking in Cases. Ancient Greek and Imperial Chinese Case Narratives. De Gruyter Berlin
Galen (2023) Über die Gesundheit. In: Singer PN (Hrsg.) Galen. Writings on Health. 153–403. Cambridge University Press Cambridge
Golder W (2020) Medicus Narrator: Untersuchungen zur sprachlichen Gestaltung und argumentativen Funktion der Fallbeschreibungen im Corpus Galenicum. Humboldt-Universität Berlin
Hellweg R (1985) Stilistische Untersuchungen zu den Krankengeschichten der Epidemienbücher I und III des Corpus Hippocraticum. Habelt Bonn
Hippokrates (2022) Epidemien I. In: Brodersen K (Hrsg.) Hippokrates. Sämtliche Werke, Band I, 173–198. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt
Kümmel W (1977) Musik und Medizin. Ihre Wechselbeziehungen in Theorie und Praxis von 800 bis 1800. Alber Verlag Freiburg und München
Lain Entralgo P (1970) The Therapy of the Word in Classical Antiquity. Yale University Press New Haven and London
Levine D, Bleakley A (2012) Maximising medicine through aphorisms. Medical Education 46, 153–162
Lloyd GER (2009) Galen’s un-Hippocratic case histories. In: Gill C, Whitmarsh T, Wilkins J (Hrsg.) Galen and the World of Knowledge. 115–131. Cambridge University Press Cambridge
Mattern S (2008) Galen and the Rhetoric of Healing. Johns Hopkins University Press Baltimore
Thumiger C (2016) Patient function and physician function in the Hippocratic cases. In: Petridou G, Thumiger C (Hrsg.) Homo patiens – Approaches to the Patient in the Ancient World. 107–137. Brill Leiden
von Staden H (2002) La lecture comme thérapie dans la médecine gréco-romaine. In: Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 146, 803–822
West M (2000) Music therapy in antiquity. In: Horden P (Hrsg.) Music as Medicine. The History of Music Therapy since Antiquity. 51–68. Aldershot Ashgate
Wohlmann A, Teufel D und Berberat PO (2022) Narrative Medizin. Praxisbeispiele aus dem deutschsprachigen Raum. Böhlau Verlag Köln
Prof. Dr. Philip van der Eijk
Philip van der Eijk ist Alexander von Humboldt-Professor für Klassische Altertumswissenschaften und Wissenschaftsgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit der Geschichte der Medizin in der Antike, insbesondere in ihren philosophischen und literarischen Aspekten. Er ist Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und leitet dort das Akademienvorhaben „Galen als Vermittler, Interpret und Vollender der antiken Medizin“. Er ist Herausgeber der „Cambridge Galen Translations“ (Cambridge University Press) und der „Studies in Ancient Medicine“ (Brill Verlag). Seit Oktober 2024 leitet er mit seinen HU-Kollegen Oliver Overwien und Markus Asper das DFG-Langfristvorhaben „Galens Kommentar zu den hippokratischen Aphorismen“, in dem die Gattung des medizinischen Aphorismus eine zentrale Rolle spielt.
2Die Gärten des Äskulap – heilsame Räume im antiken Griechenland und Rom
Susanna Elm
In den letzten Jahrzehnten gab es wichtige evidenzbasierte Entwicklungen hinsichtlich der Auswirkungen von architektonischer Gestaltung auf gesundheitliche Ergebnisse (Lawson 2010). Studien haben gezeigt, dass die Wahl von Farben, Räumen mit Aussicht und natürlichem Licht, die Integration von Innen- und Außenräumen mit besonderem Augenmerk auf die Natur und sogar das Vorhandensein von Zimmerpflanzen und Naturmotiven an Wänden und Böden einen erheblichen Unterschied bei den gesundheitlichen Ergebnissen ausmachen und das Wohlbefinden von Personal und Patienten verbessern können. Räume, Orte und ihre Gestaltung wirken sich, kurz gesagt, sowohl negativ als auch positiv auf die Heilung aus.
Ausgehend von diesen evidenzbasierten Ergebnissen werden im Folgenden die heilenden Wirkungen untersucht, die in der antiken griechischen und römischen Medizin mit besonderen Orten in Verbindung gebracht wurden, insbesondere mit Tempelhainen, Gärten, Bädern und künstlerischen Elementen wie Mosaiken und Wandgemälden, die die Natur darstellen. Obwohl Wissenschaftler die heilende Wirkung der Inkubation, also des Schlafs in Erwartung eines göttlichen Orakels oder heilenden Traums, eingehend untersucht haben, insbesondere im Hinblick auf mögliche Placebo-Effekte (Ehrenheim 2021), wurde der heilenden Kraft von Hainen, Gärten, Statuen und Gemälden, die ebenfalls mit den antiken Heilgöttern in Verbindung gebracht werden, weit weniger Aufmerksamkeit geschenkt.
2.1Kann ein angenehmer Raum heilsam sein?
2.1.1Äskulap
Die antike, griechische und römische Medizin ist eng mit der Figur des Äskulap, Gott der Heilung und Medizin, verbunden. Obwohl er bereits in Homers Ilias als heldenhafter Heiler erwähnt wird, der die griechischen Streitkräfte unterstützte (Latacz u. Bierl 2009, 193) begann die Verehrung des Äskulap als Gott im 5. Jahrhundert v. Chr. in Epidaurus. Hier und in mehreren anderen griechischen Heiligtümern wie Korinth verdrängte die Verehrung des Äskulap bald die seines Vaters, des Heilgottes Apollon, dem diese Heiligtümer ursprünglich geweiht waren (Edelstein u. Edelstein 1998, 2–121). Von Epidaurus aus, welcher als Geburtsort des Äskulap gilt, breitete sich die Verehrung des Gottes während des klassischen und hellenistischen Zeitalters aus und führte zu einem Netz von Heiligtümern von Kleinasien bis ins frühe römische Italien. Mit der Ausdehnung des römischen Reiches verbreitete sich die Verehrung des Äskulap, die zunehmend mit der seiner Tochter Hygieia verbunden war, noch weiter. Bereits in der Ilias wird die Verbindung von Äskulap mit der Kriegsführung betont. Im römischen Reich war der Gott bei der Armee besonders beliebt. Heiligtümer entstanden in den Grenzprovinzen, vor allem in Gallien (dem heutigen Frankreich), auf dem Balkan und entlang der Donau, am Euphrat und in Nordafrika. Die Verbindung von Äskulap mit der Armee bedeutete auch, dass er von den meisten römischen Kaisern, denen das Wohlergehen ihrer Truppen sehr am Herzen lag, bevorzugt behandelt wurde (Ploeg 2018, 6–17, 166–214).
Die zunehmende Verbreitung dieser Heiligtümer über mehrere hundert Jahre und in einem dramatisch veränderten politischen Umfeld führte zu zahlreichen lokalen Variationen durch die Verbindung von Äskulap und Hygieia mit regionalen Heilgöttern. Dennoch behielten die Äskulap-Heiligtümer mehrere erkennbare, zusammenhängende Merkmale bei. Erstens reisten diejenigen, die die Hilfe des Gottes suchten, in der Regel zu den Heiligtümern, oft über recht weite Strecken. Nach ihrer Ankunft führten sie eine Reinigungsprozedur durch und brachten dem Gott Opfer dar. Als Nächstes unterzogen sich die Bittsteller einer Inkubation. Die Inkubation bedeutete, dass man sich im Tempel schlafen legte, in der Hoffnung, der Gott würde im Traum erscheinen und orakelhafte Ratschläge geben. Im Falle des Äskulap würde dieser Rat im Idealfall eine Heilung der Beschwerden des Bittstellers beinhalten. Wenn eine solche Heilung im Schlaf stattgefunden hatte, gedachten die dankbaren Bittsteller oft auf offiziellen Tafeln oder Stelen (iamata), in Gemälden oder Skulpturen oder mit weniger haltbaren Materialien, wenn ihnen die wirtschaftlichen Mittel fehlten, und machten so den privaten Akt der Heilung durch ihren Dank öffentlich.
Die Inkubation, d.h. das Schlafen in einem Tempel oder dessen Umgebung, um eine göttliche Mitteilung zu erhalten, war eine weit verbreitete Praxis, an der viele Götter beteiligt waren und die ursprünglich nur Priestern oder Angehörigen der Eliten offenstand. Die mit Äskulap und seinen Helfern assoziierten Inkubationen weiteten sich jedoch allmählich auf alle aus, die Hilfe suchten (Ehrenheim 2023). Die Betroffenen blieben oft monatelang, und viele Heiligtümer konnten große Gruppen aufnehmen. Zunehmend umfassten die Heiligtümer separate Schlafräume, in denen der Gott im Traum erschien, um Ratschläge, Rezepte und gelegentlich auch sofortige Heilung anzubieten. Zu den Heilmitteln gehörten neben dem Schlaf auch leichte Übungen, spezielle Diäten und Salbungen oder Massagen (Ehrenheim 2021, 99–101). Die Votivgaben und iamata bestätigen die Doppelnatur des Äskulap.
Der Gott Äskulap führte Operationen und andere medizinische Eingriffe wie Schröpfen und Aderlass durch, heilte aber auch durch Veränderungen dessen, was wir heute als Lebensstil bezeichnen würden.
Vor allem aber feierten viele Votivgaben die wundersamen Heilungen, die Äskulap allein durch seine göttlichen Kräfte bewirkt hatte.
2.1.2Die Bedeutung der Natur – Haine und Gärten
Die Heiligtümer boten etwas Besonderes: Statt einen Arzt zu Hause zu konsultieren, musste man an einen bestimmten Ort, den Tempelbezirk, pilgern. Dort fanden die Opfer und die Rituale rund um die Inkubation in einer besonderen Umgebung statt, mit Schlafsälen, Tempelhainen und Gärten, in denen man in Gemeinschaft mit anderen Leidenden lebte, umgeben von den sichtbaren Zeichen früherer Heilungen. Sicherlich bedeutete die große Zahl derer, die sich in diesen Heiligtümern aufhielten, dass es sich nicht unbedingt um ruhige Orte handelte, aber allein die Tatsache, dass man aus seinen gewöhnlichen Lebensumständen an einen Ort gebracht wurde, der der Heilung gewidmet war, mit Statuen, Inschriften und Wandmalereien, hatte eine Wirkung; zumindest erlebten die Leidenden ein starkes Gefühl des gemeinsamen Ziels.
Wie Plinius der Ältere deutlich machte, galten viele Bäume und Pflanzen als heilig und wurden oft mit bestimmten Göttern in Verbindung gebracht.
„Verschiedene Arten von Bäumen werden ständig ihren eigenen Gottheiten geweiht, zum Beispiel die Eiche dem Jupiter, der Lorbeer dem Apollo“ (Plinius der Ältere, Naturgeschichte 12.2.3 nach König u. Winkler 1997]).
Archäologische Funde zeigen, dass formale Gärten mit Wasserbecken und Podien, Pflanzreihen und Hainen integrale Gestaltungselemente vieler Tempel waren, besonders in der römischen Zeit. Heiligtümer des Äskulap befanden sich oft auf dem Lande in der Nähe der Städte, aber auch innerhalb der Städte, am berühmtesten auf der Tiberinsel in Rom. Tempelbezirke boten somit Grünflächen in dichten städtischen Gebieten, insbesondere für diejenigen, die sich keine eigenen Gärten leisten konnten (Carroll 2017). Diese Grünflächen wurden mit dem Göttlichen in Verbindung gebracht, was ihre Kräfte, auch die der Heilung, verstärkte.
Die großen Privathäuser der Eliten, die domus, liefern im Gegensatz zu den Tempeln die meisten Informationen zu römischen und griechischen Ansichten über die Natur und ihre Kräfte: Die Besitzer betonten die Allgegenwart der Natur, der Gärten und der Landschaft durch Räume, die sich direkt zu den Gärten hin öffneten, und durch die Darstellung von Naturszenen im Inneren (s. Abb. 1).
Abb. 1 Wandgemälde 50–79 n. Chr. (Archäologisches Nationalmuseum, Neapel)
Alle römischen Elitehäuser, vor allem in den Städten, integrierten Gärten durch bepflanzte Innenhöfe (Peristyl, Viridarium), zu denen sich offizielle Empfangsräume und private Räume öffneten. Zu den Gartenhöfen gehörten:
Teiche und Becken,
Wandelgänge,
Altare,
Statuen,
Liegeflächen,
Blumenbeete und
schattenspendende Bäume (die sehr Reichen hatten sogar angrenzende „Wälder“ oder
silvae
).
Solche Gartenhöfe sowie Terrassen-, Senk- und Gemüsegärten wurden überall im Römischen Reich gefunden, auch in den nördlichen Provinzen (Morvillez 2018). Häufig korrespondierten die Bodenmosaike und Wandmalereien im Inneren mit dem Stil der Hofgärten und verstärkten ihn, sodass der Innenraum nahtlos mit der geschaffenen Natur im Freien verschmolz (s. Abb. 2).
Abb. 2 Wandgemälde Prima Porta 1. Jh. n. Chr.
2.1.3Die Äskulap-Thermen
Eingangshallen mit Gartenelementen gab es auch in den insulae oder Wohnkomplexen für die weniger Begüterten, aber ihre Häufigkeit nahm mit zunehmender städtischer Dichte ab. Vor allem in der römischen Kaiserzeit boten jedoch öffentliche Bäder (thermae) und Übungsplätze (palaestrae) der Allgemeinheit etwas von dem Vergnügen und der gesundheitsfördernden Wirkung, die Gärten den privaten Besitzern boten. Alle Bäder und Übungsplätze oder Palästraen standen unter der göttlichen Obhut von Äskulap und Hygieia und galten als unerlässlich für die Gesundheit (salubritas) der Stadt und ihrer Bewohner. Häufige Umbauten, das Überleben römischer Städte bis in die Neuzeit und die Komplexität der Ausgrabung von Gärten erschweren eine genaue Rekonstruktion, aber literarische Quellen legen großen Wert auf die gesundheitsfördernden Eigenschaften und die ländlichen Assoziationen der weitläufigen Grünflächen, die mit den Thermen verbunden waren (Delaine 2018, Morvillez 2018). Die Caracalla-Thermen in Rom sind das beste Beispiel dafür, wie kaiserliche Bäder private Gärten öffentlich machten, was wichtig ist, weil ihr Entwurf für andere Städte kanonisch wurde. Die Caracalla-Thermen wurden auf dem Gelände eines früheren elitären Anwesens errichtet, das über ausgedehnte Gärten (horti) verfügte. Diese sind in den Bereichen um die inneren Becken erhalten geblieben. Die Bereiche wurden lichtdurchlässig gestaltet und mit Pflanzgefäßen und Blumenbeeten geschmückt. Die äußeren Bezirke waren sorgfältig gestaltete Freiflächen mit Gehwegen und dekorativen Wasserbecken, in denen sich Bibliotheken, Kunstgalerien und Vortragsräume befanden, aber auch Bereiche für körperliche Ertüchtigung und sportliche Vorführungen. Die Palästraen oder Übungsräume befanden sich im Inneren und weisen keine Spuren von Pflanzen auf, aber sie zeigen Mosaike und andere Arten von dekorativen Fußböden, oft mit Sport- und Kampfmotiven, da Palästraen mit der Ausbildung von Soldaten in Verbindung gebracht wurden. Im zweiten und dritten Jahrhundert n. Chr. gab es in Kleinasien und Nordafrika Bäder mit Palästraen im Freien neben den Schwimmbecken (natationes). Auch hier finden sich Hinweise auf eine Bepflanzung, wenngleich Pflasterung üblicher war. In den Innenräumen befanden sich außerdem Räume für Ärzte, die medizinische Eingriffe vornahmen, und andere Bademeister. Häufig waren die Innenräume mit Ranken, Akanthusblättern, Bäumen usw. geschmückt, sodass man, um Plinius den Jüngeren zu zitieren, „liegen und sich in einem Wald wähnen kann, aber ohne die Gefahr von Regen“ (Kasten 2003, Ep. 5.6, 39).
Statuen waren in allen Bädern allgegenwärtig, auch wenn nicht alle so prächtig waren wie die in den Bädern des Caracalla. Wie Delaine gezeigt hat (Delaine 2018, 176–77) überwogen in den öffentlichen Bädern und im Gegensatz zu den privaten Gärten in Landvillen und städtischen domus die Statuen des Äskulap und der Hygieia in erheblichem Maße (s. Abb. 3).
Vergleichbar mit den Statuen des Äskulap und der Hygieia sind die des Herkules in den italienischen Bädern, wo er als gesundheitsfördernde Gottheit der heißen Quellen galt.
Abb. 3 Äskulap von Farnese (Archäologisches Nationalmuseum, Neapel)
2.2Gesundheitsfürsorge für die Armee
Die Vorbilder des Äskulap, der Hygieia und des Herkules lassen wenig Zweifel daran, dass die römischen Kaiser den Zusammenhang zwischen Bädern, Natur und Gesundheit des Körpers sehr ernst nahmen. Ob diese Bäder, die sicherlich nicht den modernen hygienischen Standards entsprachen, Krankheiten eher verursachten als linderten, ist eine andere Frage, ebenso ob die dicht gedrängten Schlafsäle den Husten, der Aelius Aristides ins Äskulap-Heiligtum brachte, vielleicht nicht wirklich „geheilt“ haben (Schröder 1986, [4] 64).
Diejenigen, die diese Stätten besuchten und die Bäder aufsuchten, hatten das Gefühl, dass ihre Beschwerden gelindert wurden.
Der Aufenthalt in schönen Grünanlagen, die mit Pflanzen, Kunst und Unterhaltung gefüllt waren, sowie die Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen, sorgten für die Wiederherstellung der Gesundheit; zumindest bestätigen dies alle unsere literarischen Quellen. Die römischen Kaiser stimmten dem zu: Sie gaben immense Summen für solche Bäder in den Städten des gesamten Reiches aus. Darüber hinaus waren Palästraen, Schwimmbäder im Freien, und Freiflächen zur körperlichen Ertüchtigung, sogenannte campi, ein wesentlicher Bestandteil der Gesundheitsfürsorge für die römische Armee.
Die enge Verbindung zwischen Äskulap und dem Heer wurde bereits erwähnt. Sie wird durch zahlreiche Inschriften an den Gott bezeugt, die in Militärlagern, in valetudinaria oder Lazaretten und in campi gefunden wurden (Ploeg 2018, 166–214). Ebenso gibt es zahlreiche Belege dafür, dass römische Soldaten von Ärzten behandelt wurden, die direkt mit der Armee verbunden waren und Titel wie medicus chirurgus, medicus clinicus oder medicus legionis trugen. Archäologen haben im Zusammenhang mit Militärhospitälern medizinische Werkzeuge und Kisten mit Zutaten für Heilmittel gefunden, was ein tatsächliches „medizinisches Korps“ bestätigt, das mit der Gesundheitsversorgung der Soldaten beauftragt war – kein Wunder, wenn man bedenkt, dass die Armee bei weitem die größte Ausgabe des Kaisers war (Israelowich 2016). Weniger beachtet haben die Wissenschaftler jedoch die ebenso zahlreichen Belege für militärische Übungsplätze, die auch von jungen Zivilisten besucht wurden und sich in der Nähe von Heerlagern im ganzen Reich befanden. Einige der oben erwähnten größten Palästren mit Außenschwimmbecken wurden nicht zufällig direkt neben dem Campus der Prätorianergarde in Rom errichtet. Entlang der Nordgrenze des römischen Reiches gab es auch zahlreiche Übungsplätze mit Außenbecken, wobei eine überdachte Basilika oder Halle die Palästra im Freien ersetzte. Wie die oben erwähnten Bäder waren auch diese Anlagen mit Pflanzgefäßen ausgestattet, von Bäumen umgeben und mit Gartenmalereien, Mosaiken mit Delphinen und Nymphen bei Wasserspielen geschmückt: Harte körperliche Ertüchtigung in schöner Umgebung wurde als eminent wichtig für die Kampffähigkeit der römischen Armee angesehen und war die beträchtlichen Kosten wert.
2.3Fazit
Angenehme, schöne Räume, die durch Gemälde und Mosaike sowie Gärten und Haine in jeder Hinsicht an die Natur erinnern sollten, waren fester Bestandteil der griechischen und römischen Medizin und Gesundheitsfürsorge. Da die antike Medizin nur wenig bewirken konnte, boten Tempel und Bäder Grünflächen mit Bewegungsmöglichkeiten für alle, nicht nur für die Eliten, sowohl in dicht besiedelten Städten als auch in Heerlagern. Solche Orte standen ebenso unter der Obhut der Heilgötter, des Äskulap und seiner Helfer, wie die Ärzte, die sich mit spezialisierten medizinischen Aufgaben befassten.
Bäder, Gärten und Haine mit ihren Statuen waren Heilräume.
Lange vor den Nachweisen moderner, evidenzbasierter Forschung, zeigen sie, dass eine architektonische Gestaltung mit Berücksichtigung von Schönheit und Natur heilen kann.
Literatur
Carroll M (2017) Gardens in Gymnasia, Schools and Scholae. In: Jashemski WF, Gleason KL, Hartswick KJ, Malek A-(Hrsg.) Gardens of the Roman Empire. 185–98. Cambridge University Press
Carroll M (2017) Temple Gardens and Sacred Groves. In: Jashemski WF, Gleason KL, Hartswick KJ, Malek AA (Hrsg.) Gardens of the Roman Empire. 152–64. Cambridge University Press
Delaine J (2018) Gardens in Baths and Palaestras. In: Jashemski WF, Gleason KL, Hartswick KJ, Malek AA (Hrsg.) Gardens of the Roman Empire. 165–84. Cambridge University Press
Edelstein EJ, Edelstein L (1998) Asclepius: Collection and interpretation of the testimonies, with new introduction by GB Ferngren. Johns Hopkins University Press
Ehrenheim H (2021) Placebo factors at healing sanctuaries in pagan and early Christian times. Trends in Classics, 95–121. DOI: 10.1515/tc-2021-0004
Ehrenheim H (2023) From Exclusive Dream Oracles to Ubiquitous Incubation Dreams: A Change in the Perception of Divine Healers? Acta Archaeologica 93, 219–33
Israelowich I (2016) Medical Care in the Roman Army during the High Empire. In: Harris WV (Hrsg.) Popular Medicine in Graeco-Roman Antiquity: Explorations. 215–30. Brill Leiden
Kasten C (2003) Plinius der Jüngere: Briefe. De Gruyter Berlin
König R, Winkler G (1997) Plinius der Ältere: Naturgeschichte. De Gruyter Berlin
Latacz J, Bierl A (2009) Homers Ilias 2, 729–33; 4. De Gruyter Berlin
Lawson B (2010) Healing architecture. Arts & Health, 95–108. DOI: 10.1080/17533010903488517
Morvillez E (2018) The Garden in the domus. In: Jashemski WF, Gleason KL, Hartswick KJ, Malek AA (Hrsg.) Gardens of the Roman Empire. 16–71. Cambridge University Press
Ploeg GE (2018) The impact of the Roman Empire on the cult of Asclepius. Brill Leiden
Schröder HO (1986) Publius Aelius Aristides: Heilige Berichte. Winter Heidelberg
Prof. Susanna Elm, FBA
Susanna Elm ist Professorin der Geschichte und Ancient Greek and Roman Studies an der University of California, Berkeley. Zusammen mit Stefan Willich ist sie Herausgeberin von folgenden Werken: „Medical Challenges for A New Millenium“ (2001), „Quo Vadis Medical Healing“ (2009) und „Wer heilt hat Recht? Medizin, Kunst, Ritus“ (2014).
3Kunst und Medizin seit der Renaissance – eine Skizze
Heinz-Peter Schmiedebach
In den letzten 600 Jahren haben Kunst und Medizin in reichhaltiger Vielfalt Zeugnis produktiver Verbindungen hinterlassen. In dem hier behandelten Zeitraum galt die Medizin selbst noch lange Zeit als eine „ars“, was der medizinischen Praxis eine besondere Kunstfertigkeit zusprach. Die naturwissenschaftliche Fundierung der Medizin im 19. Jahrhundert drängte diese Sichtweise an den Rand. Eine im strengen Sinn systematische therapeutische Anwendung von Kunst in der Medizin war in ersten Ansätzen im 19. Jahrhundert auszumachen. Seit den 1920er-Jahren findet sich eine wachsende Einbeziehung von künstlerischen Betätigungen aller Art in verschiedenen medizinischen Bereichen. Ab den 1960er-Jahren ist zudem zu beobachten, wie sich aus den therapeutischen Praktiken eigene künstlerische Richtungen entwickelten, in denen sich von Krankheit Betroffene zu Künstler:innen transformierten. Viele Aspekte des Themas können hier jedoch nicht angesprochen werden. So wird u.a. nicht auf die Bildhauerei und Theater eingegangen, aber auch das Krankenhaus als Kunstraum und die durch künstlerische Ausgestaltung zu erzielenden Heileffekte erhalten keinen Raum.
3.1Anatomie, Malerei und Musik
In der frühen Anatomie kam es hinsichtlich der anatomischen Illustrationen zu enger Zusammenarbeit zwischen Anatomen und Künstlern. So kooperierte der Begründer der neuzeitlichen Anatomie Andreas Vesalius mit dem Maler Jan Stephan von Calcar, einem Schüler Tizians, bei der Herstellung der Holzschnitte des Vesalschen Werkes „De humanis corporis fabrica“ von 1543, was anatomische Abbildungen von hoher Kunstfertigkeit schuf (Canalis u. Ciavolella 2018). Nicht nur der Körper, sondern auch Krankheiten, insbesondere die mit Leid, sozialen und ökonomischen Erschütterungen einhergehenden Epidemien, regten verschiedene Maler an, die menschliche Vergänglichkeit und Sündenhaftigkeit im Angesicht der todbringenden Seuchen auf der Leinwand festzuhalten. Das Gemälde „Pest in Venedig“ von Antonio Zanchi aus dem Jahr 1666 zeigt in düsteren Farben verschiedenste von der Seuche geschlagene Menschen, ein Arrangement von Kranken und Toten auf Brücken, in Straßen und Kähnen. Im 16. Jahrhundert begannen die Maler, die Seuche nicht mehr durch charakteristische Krankheitszeichen am Körper abzubilden, sondern eine besondere Dramatik durch Gesten der Personen zu gestalten. Die Gegensätzlichkeit zwischen den verwesenden Toten und den Lebenden zeigen die zeittypischen Memento Mori-Einstellungen (Bergdolt 2006). Diese Gemälde bezeugen nicht nur Tod und Elend, sondern bieten auch verschiedene Grundmotive an, um das Seuchengeschehen einzuordnen und fassbar zu machen.
Der Einfluss von Musik auf den Körper ist seit Jahrtausenden bekannt. Sie galt dabei sowohl zur Bewahrung der Gesundheit als auch bei Krankheiten aller Art als nützlich, wobei man die diätetische-therapeutische Wirkung im passiven Zuhören sah. Als neues Phänomen im Barock ist ein größeres Interesse an den „physiologischen“ Erklärungen ihrer Wirksamkeit festzustellen. So wurde im 18. Jahrhundert die lösende und schmerzstillende Wirkung der Musik unter anderem damit erklärt, dass sie den Nerv in eine vibrierende Erregung versetzen könne, sodass dieser das schädliche Material leichter abtransportieren könne oder dass sie einen Reiz auf den Nerv ausübe, der eine schmerzhafte Konzentration der „Nervenflüssigkeit“ an bestimmten Stellen verhindere und so Erleichterung verschaffe. Ein systematischer experimenteller Umgang mit Musik bei Kranken ist vereinzelt seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts auszumachen. Seine Versuche, Musik als Heilmittel bei psychischen Krankheiten einzusetzen, bezeichnete der Psychiater Jean-Etienne Esquirol 1838 jedoch als erfolglos. Eine moderne Musiktherapie hat sich erst im 20. Jahrhundert durchgesetzt (Kümmel 1977). In Deutschland ist Musiktherapie seit 1979 Hochschuldisziplin.





























