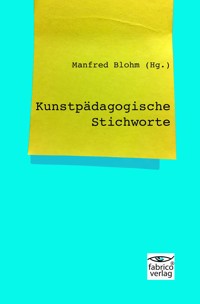
Kunstpädagogische Stichworte E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: fabrico verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kunstpädagogische Stichworte umfasst eine Sammlung unterschiedlichster Begriffe, die in der Kunstpädagogik und für die Kunstpädagogik bedeutsam sind: Die 41 Begriffe reichen von Architektur über Ästhetische Forschung, Atmosphäre, Benotung & Bewertung, Kompetenz, Kreativität, Schulerfolg & Kunstunterricht, Unterrichtsplanung bis hin zu Zeichnen & Zeichnung und Zeit/Zeitrhythmen. Die Autorinnen und Autoren schreiben über die von ihnen gewählten Begriffe entweder eher aus (schul)praktischer oder theoretischer Sicht. Das Buch wendet sich an alle Kunstpädagoginnen und Kunstpädagogen, besonders aber an Studierende sowie Referendare und Referendarinnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
#Vorwort
Der vorliegende Band „Kunstpädagogische Stichworte“ umfasst eine Sammlung unterschiedlichster Begriffe, die in der Kunstpädagogik und für die Kunstpädagogik bedeutsam sind. Es handelt sich hierbei nicht um den Anspruch einer vollständigen oder abgeschlossenen Sammlung. Vielmehr kann und soll diese erweitert werden.
Eingeladen wurden Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz aus ihren Spezialgebieten Begriffe auszuwählen und sie hier aus ihrer Perspektive vorzustellen. Das Konzept ist, eine Sammlung kurzer einführender Texte zu den Begriffen mit Hinweisen zum vertiefenden Weiterlesen zu erstellen. Die Autorinnen und Autoren schreiben entweder eher aus (schul-)praktischer oder theoretischer Sicht sowie aus der Perspektive ihrer eigenen Arbeitszusammenhänge. Dass in den Texten auch die Positionen der einzelnen Autorinnen und Autoren zu den gewählten Begriffen einfließen, ist Teil des Konzeptes! Der Herausgeber hat zwar eine Rahmung vorgegeben, keineswegs aber die Texte formal oder inhaltlich geglättet oder angeglichen. Die Entscheidung für den Buchtitel „Kunstpädagogische Stichworte“ (ein Vorschlag von Maria Peters, der ich dafür danke) impliziert zwei Aspekte: Zum einen den, dass relevante Begriffe des Faches hier für die Leserinnen und Leser entwickelt werden und zum anderen, dass die Kunstpädagogik selbst Stichwortgeber sein kann und auch sein sollte.
Das Buch wendet sich an alle Kunstpädagoginnen und Kunstpädagogen, besonders aber an Studierende sowie Referendare und Referendarinnen.
Ich danke allen Autorinnen und Autoren für ihre Beiträge und der Studentin Caroline Panozzo für das kritische Kommentieren der meisten Texte.
Manfred Blohm Flensburg/Hannover März 2016
#Inhalt
#Architektur
Wolfgang Richter
#Ästhetische Erfahrung
Kathrin Herbold
#Ästhetische Forschung
Christine Heil
#Atmosphäre
Andreas Rauh
#Außerschulischer Lernort
Werner Fütterer
#Beobachten, Einschätzen, Fördern
Elisabeth Gaus-Hegner & Anja Morawietz
#Bewertung & Benotung
Georg Peez
#Bildanalyse
Michael Grauer
#Gender & Kunstunterricht
Esther Richthammer
#Prinzip Hommage
Klaus Küchmeister
#Inklusion & Kunstunterricht
Andreas Brenne
#Interface
Marc Fritzsche
#Jugendkulturen/Jugendszenen
Jutta Zaremba
#Können
Gila Kolb
#Kompensatorischer Kunstunterricht
Manfred Blohm
#Kompetenz
Edith Glaser-Henzer
#Kontext/Kontextanalyse
Ernst Hochrainer
#Kreativität
Constanze Kirchner
#Künstlerische Bildung
Carl-Peter Buschkühle
#Künstlerische Feldforschung
Andreas Brenne
#Kunstgeschichte
Ernst Wagner
#Kunsttherapie
Markus J. Herschbach
#Lehrerrolle
Michael Grauer
#Lehrplan/Curriculum
Ernst Wagner
#Mapping
Rudolf Preuss
#Medienkunst
Martina Ide
#Multimodalität/Multimodality
Franz Billmayer
#Performative Verfahren im Kunstunterricht
Maria Peters
#Portfolio (KEPP)
Christina Inthoff
#Regeln, Routinen & Rituale
Sabine Sutter
#Schreiben & Kunstunterricht
Maria Peters
#Schulerfolg & Kunstunterricht
Michael Meier
#Selbstorganisiertes Lernen (SOL)
Regina Köllner-Kolb
#Sprechen über Kunst
Johannes Kirschenmann
#Unterrichtsmethoden
Fritz Seydel
#Unterrichtsplanung
Fritz Seydel
#Visualisierungen
Lars Zumbansen
#Werkstattbuch
Petra Kathke
#Zeichnen & Zeichnung
Regina Zachhalmel
#Zeit/Zeitrhythmen
Manfred Blohm
#Architektur
„Die architektur erweckt stimmungen im menschen. Die aufgabe des architekten ist es daher, diese stimmung zu präzisieren. Das zimmer muss gemütlich, das haus wohnlich aussehen. Das justizgebäude muss dem heimlichen laster wie eine drohende gebärde erscheinen. Das bankhaus muss sagen: hier ist dein geld bei ehrlichen leuten fest und gut verwahrt.“ (Adolf Loos, Architektur, 1910)
Was empfinden wir bei Räumen, Gebäuden, Plätzen, Ensembles, Parks, an Orten, wo wir wohnen, arbeiten, unsere Freizeit verbringen?
Was bedeuten uns Nähe und Distanz, Privates und Öffentliches?
Wie und warum wirken Innenräume auf uns?
In welchem Zusammenhang stehen Maßstäbe und Proportionen?
Welchen Lebensumständen folgt Architektur?
Was macht eine atmosphärische Stimmung aus?
Wie beeinflusst uns Raum?
Wie fördert Raum Kommunikation?
Architektur ist eine Querschnittmaterie. Niemand kann sich ihr entziehen, weil wir in Innen- und Außenräumen leben.
Architektur macht Körper, Dinge und Bedeutungen erfahrbar, sie verteilt, steuert und ordnet.
Architektur unterliegt gesellschaftlichen Einflüssen und formuliert für den Einzelnen anschaulich lesbare Modelle der Welt.
Im Begriff Architektur sind zwei Bedeutungen angelegt: die handwerklich-materielle, und die künstlerisch-ideelle.
Ihre primäre, nützliche Funktion ist der Schutz gegen Wetter und Umwelt. Feste Verbindungen von Materialien zu stabilen Konstruktionen nach mechanisch-technischen Gesetzmäßigkeiten befriedigen meist lebensnotwendige Bedürfnisse. Ihre sekundäre, geistige Funktion ist durch Zweck und Umfang bestimmt. Lebensumstände, Wirtschafts- und Gesellschaftsformen verwandeln das Bauprogramm in die sinnlich wahrnehmbare Gestalt von Körper und Raum, verweisen auf kommunikative und repräsentative Funktionen. Zusammen führt das zur Frage nach dem zeitgemäßen Zusammenwirken gedanklicher, technischer, wirtschaftlicher und sozialer Faktoren.
Architektur repräsentiert gesellschaftliche Zustände und Entwicklungen. Den Auftrag dazu können Einzelpersonen, Gruppen oder Institutionen erteilen. Am Bauprogramm beteiligt sind der Auftraggeber mit seinen persönlichen Vorstellungen und der Architekt. Beide können sich an bewährten Traditionen oder innovativen Lösungen orientieren. Machbar ist schließlich, was die Grenzen des Realisierbaren nicht überschreitet und Material und Konstruktion nicht überfordert. Machbar wird aber auch, was gesellschaftlich durchsetzbar ist: z.B. die Pyramiden der Pharaonen als auf das Jenseits orientierte Grabmäler, die gotischen Kathedralen als Visualisierung des himmlischen Jerusalem, das barocke Schloss mit Prunkstiege, Festsaal und Park als Ausdruck des absolutistischen Zentralismus, das Rathaus als Repräsentation bürgerlicher Macht, Fabriken, Brücken, Bahnhöfe als Symbole der Industrialisierung, öffentlicher Wohnbau als Folge der Ökonomisierung, Hochhäuser der Banken als Zeichen für die Kumulierung des Kapitals.
Architektur als Material und Konstruktion
Beide stehen in einem engen Zusammenhang. Gebrannte Ziegel sind zwar leicht, aber nicht so druckfest wie Stein, dieser wiederum schwer. In beiden Fällen ist die Höhe von Bauten begrenzt, die Mauern müssen dick sein, um Druck und Schub aufzufangen. Für Zugkräfte eignen sich andere Materialien wie z.B. Stahl. Ein konstruktives Skelett aus Holzbalken, später aus Eisen, ein sich gegenseitig unterstützendes Gefüge aus Zug- und Druckkomponenten ermöglicht ein ausgewogenes statisches System. In früheren Zeiten wie in der Gotik wurde in erster Linie mit Stein gebaut, der Druck und Schubkräfte aufnehmen musste. Aus armiertem Beton gegossene Platten, die sowohl Zug wie auch Druckkräfte aufnehmen können, wie auch Schalenkonstruktionen, ermöglichen neue, freiere Formen. Verspannungen und Netze lassen dynamische Konstruktionen zu. Ein neues Feld erschließen Kunststoffe, die für pneumatische Hüllen und Membrane einsetzbar sind.
Architektur als Idee und Plan
meint die Art, wie die einzelnen Elemente des Baukörpers zusammengesetzt sind: Kontrast, Reihung, Symmetrie. Die Spannbreite reicht von additv - stereometrischer Addition, Gruppierung und Durchdringung (z.B. Romanik, aber auch Bauhaus, International Style) bis zu ineinander verschliffenen Formen wie im Barock, im Expressionismus und bei postmodernen Gebäuden.
Damit korrespondiert der Grundriss, der als Verweilraum (Zentralraum) oder Durcheilraum angelegt sein kann.
Als "schön" wurde seit der Renaissance (mit Bezug zur Antike) die Art bezeichnet, wie Grundelemente in ihrer Proportion (Zahlensymbolik, goldener Schnitt) und in der Anordnung strukturiert wurden (z.B. das Dreieck / die Pyramide in Ägypten, Triangulation in der Gotik, der Kreis / die Kugel in der Kuppel des Pantheons in Rom, das Quadrat / der Würfel im gebundenen System der romanischen Kirchen).
Innenräume können in sich ruhen, überschaubar sein oder verwirrend, offen oder hermetisch dicht. Die Atmosphäre eines Raums wird bestimmt durch die Oberflächenwirkung des Baumaterials, durch Licht und Schatten, Farbe, aber auch durch die Akustik, die Temperatur und sogar durch den Geruch.
Als Großformen von Körper und Raum bilden Innenhöfe, Atrien, Plätze, aber auch Straßen, Alleen, Kreuzungen Orte, deren Sinn durch die bewusste Einfassung oder Begleitung durch Bauwerke entstehen kann. Auch für die Planung, die Erweiterung oder Umplanung von urbanen Zonen ist der Außenraum bedeutend, ist es doch die Aufgabe des Stadtplaners, in funktionaler, sozialer und gestalterischer Hinsicht Ordnung zu schaffen. Während gewachsene Städte organisch wirken, folgen schon seit der Antike neu Geplante rationalen Grund- und Orientierungsmustern. Die Herausforderungen unserer Zeit, die Versiegelung von wertvollen Grünflächen auf dem Land durch Zersiedelung und Urbanisierung – schon jetzt leben ca. 50% aller Menschen in Städten, aber auch der Rückbau ganzer Stadtteile sind ein verantwortungsvolles Aufgabenfeld für die Zukunft.
Diskussion
Architektur ist ein hochkomplexes Gebiet, dem man mit einer reinen Stilkunde nicht gerecht wird. Ich finde, man sollte besser über Gebautes reden, z.B. als "anschauliches Ganzes mit gesetzmäßiger Ordnung der Teile" wie Aristoteles. Oder empirisch mit Konstruktions- und Proportionswerten (wie im Mittelalter) experimentieren. Oder (wie Alberti) darüber diskutieren, was zweckmäßig, solide und variabel ist. Beispiele zu suchen für das Auseinanderfallen von Konstruktion und Dekoration, den Beitrag der Architektur zur gesellschaftlichen Entwicklung einzufordern, kann zu spannenden Diskussionen führen.
Und überhaupt sollte man Räume erleben, indem man sie begeht und vor Ort über das redet, was einem an Architektur auffällt.
Um zu erfahren, was Räume und ihre Wirkung ausmacht, finde ich das Bauen von einfachen Arbeitsmodellen als besonders hilfreich: hoch - tief, eng - weit, hell - dunkel, eckig - organisch, das hilft, elementare Wahrnehmungen zu machen. Nach solchen Erfahrungen kann man ganz anders über Architektur reden.
Literatur
Michael Klant, Josef Walch: Grundkurs Kunst 3. Materialien für die Sekundarstufe II.-Hannover (Schroedel) 2005
Wolfgang Kemp:Architektur analysieren – Eine Einführung in acht Kapiteln (Schirmer Mosel), München 2009
Charlotte Malmborg, Wolfgang Richter: Architektur für alle. Anregungen für den Unterricht und Beispiele aus der Praxis für die Sekundarstufe I. Salzburg 2016 (zu beziehen unter: www.at-s.at)
bink – Initiative Baukulturvermittlung für junge Menschen
www.bink.at
strangeness & movement. Begehung des öffentlichen Raums am Beispiel Salzburg: www.youtube.com/watch?v=AWwVkwEdWsw&feature=relatedhttps://www.schule.at/portale/bildnerische-erziehung/be-teilgebiete/architektur.html
Autor
Wolfgang Richter | Dr. | architektur technik + schule Salzburg
http://www.at-s.at
#Ästhetische Erfahrung
Einordnung
Die aktuelle Kunstpädagogik im deutschsprachigen Raum zeichnet sich weniger durch systematische Gesamtentwürfe als durch eine Vielfalt von Positionen aus. Die ästhetische Erfahrung ist jedoch ein Begriff, den alle Kunstpädagogen thematisieren. Sie gilt als entscheidende Voraussetzung für ästhetische Bildungsprozesse und taucht nicht nur in den Rahmenplänen verschiedener Schulstufen auf, sondern wird in nahezu jedem kunst-, museums- und kulturpädagogischen Diskurs verhandelt. Der „Bezug zur ästhetischen Erfahrung“ kann als Konsens im Fach und als „zentrale Voraussetzung ästhetischer Bildungsprozesse“ gesehen werden (Peez 2008, 26ff).
Spätestens seit Kant wird davon ausgegangen, dass das ästhetische Urteil von einer Erfahrung des Subjekts ausgeht. Er versuchte, die Unbegründbarkeit von ästhetischen Beurteilungen nachzuweisen, indem er eine Theorie der ästhetischen Erfahrung ausarbeitet, die Urteile über ‚schöne’ Gegenstände nicht auf deren objektive Dingqualitäten zurückführt, sondern auf Strukturmerkmale einer (ästhetischen) Erfahrung selbst, das psychologische Erfahren der Schönheit.
Exklusiv – Inklusiv
Die Abhängigkeit ästhetischer Erfahrungen vom Subjekt lässt die Frage aufkommen, ob nur eine ästhetisch versierte Person oder jeder ästhetische Erfahrungen machen kann. Die Antworten auf diese Frage haben zu zwei unterschiedlichen Auffassungen von ästhetischer Erfahrung geführt: Zum einen zu einem exklusiven Begriff von ästhetischen Erfahrungen, der davon ausgeht, dass sie sich lediglich in der Begegnung mit Kunst vollziehen. Beim Rezipienten werden dazu Kennerschaft als eine ästhetisch intelligente Wahrnehmungs- und Handlungsfähigkeit wie auch die Fähigkeit zur bewussten Distanzierung zu den Dingen des eigenen Erlebens und zu sich selbst vorausgesetzt (vgl. Mattenklott 2004, S. 18ff). Fähigkeiten, die beispielweise Kindern teils aus entwicklungspsychologischen Gründen noch fehlen, teils erst erlernt werden müssen. Diese Auffassung betont eine scharfe Differenz zwischen ästhetischem und alltäglichem Erleben (Mattenklott 2004, 14): Ästhetische Erfahrungen sind demnach Erfahrungen, die durch die erfassbaren Qualitäten der Kunst initiiert werden. Kunstwerke sind danach die eigentlichen Objekte der ästhetischen Erfahrung, da sie Eigenschaften des Zeigens und Darbietens besitzen (vgl. Baumeister 1994, 33). Zum anderen arbeiten Kritiker dieser Auffassung mit einem inklusiven Begriff der ästhetischen Erfahrung, der lebensweltliche Erfahrungen einschließt – etwa Dewey, der entsprechend die „Kontinuität zwischen der ästhetischen Erfahrung und den gewöhnlichen Lebensprozessen“ wiederherstellen wollte, indem er ästhetische Erfahrung als eine vom Bewusstsein gesteuerte Interaktion mit der Umwelt definiert, die in einem „befriedigenden Abschluss“ endet (Dewey 1988, S. 18, S. 43). Der Einbezug der Lebenswelt wird möglich, wenn die Begriffe ‚aisthesis‘ und ‚Ästhetik‘ vorschnell synonym verwendet werden. Dieser Fehlschluss geht zurück auf die unhistorische Wiederbelebung des ursprünglichen Wortsinnes von ‚aisthesis‘ und hat sich auch in der Kunstpädagogik verbreitet (vgl. Parmentier 2009, S. 56). So gehen viele Kunstpädagogen davon aus, dass ästhetische Erfahrungen nicht unbedingt etwas mit Kunst zu tun haben müssen, sondern der ästhetische einen generellen, auch bzw. gerade die Kindheit auszeichnenden Weltzugang darstelle. Ästhetisch ist hier oftmals alles, was die Sinne betrifft und ästhetische Bildung kann als eine Art Sinnesschule alles Mögliche sein. Reine Sinnlichkeit und Sinneslust haben aber mit ästhetischer Erfahrung und Bildung wenig gemein.
Überwältigung und Glück
Die Theorien zur ästhetischen Erfahrung bewegen sich also in einem weiten Spektrum zwischen der Auffassung, es gäbe eine Kontinuität zwischen alltäglicher und ästhetischer Erfahrung, und der Position, ästhetische Erfahrung sei eine voraussetzungsreiche anspruchsvolle, aber erlernbare Kulturtechnik und eher ein seltenes Phänomen des menschlichen Lebens, das sich von dem alltäglichem Erleben deutlich hervorhebt.
Im Überwältigungskontext durch „schöne Lust“ werden ästhetische Erfahrungen als seltene Augenblicke intensiver Gegenwart beschrieben, die sich gerade durch ihre plötzliche Diskontinuität zum alltäglichen Erleben auszeichnen (Kern 2000). Ästhetische Erfahrungen sind nach Welsch „Blitz, Störung, Sprengung, Fremdheit“ (Welsch 1998, S. 39), während sich Deweys ästhetische Erfahrungen allmählich entfalten. Es ist insbesondere Nietzsche gelungen, charakteristische Merkmale dieser Form ästhetischer Erfahrung deutlich hervorzuheben (vgl. Nietzsche 1980, S. 339f). Bei ihm werden die besondere Leibgebundenheit, die intensive innere Bewegung, das Gefühl der eigenen Passivität und auch zeitlichen Ermächtigung besonders deutlich. Die ästhetische Erfahrung überwältigt körperlich spürbar und plötzlich. Für Adorno reduziert man sich im Moment der ästhetischen Erfahrung auf einen „Grenzwert“ (Adorno 1973, S. 250). Im „ästhetischen Zustand“, so fasst es auch Schiller zusammen, „ist der Mensch also Null“ (Schiller 2010, S. 83).
Dieses Glück, das einem hier widerfährt, ist Bestandteil der ästhetischen Erfahrung und kann, zumindest als ästhetische Wirkung jeden unverhofft treffen. Doch scheint gerade die Kunst das Werkzeug zu sein, die dem interessierten Betrachter dabei helfen kann, den ästhetischen Zustand willkürlich herbeizuführen (vgl. Parmentier 2009, S. 58). Kunstwerke sind demnach die eigentlichen Objekte der ästhetischen Erfahrung, da sie „ihre Eigenschaften exemplifizieren, den Charakter des Zeigens und Darbietens haben, und darin als erschütternd, als herzerfrischend, amüsant, bewundernswert, erstaunlich erfahren werden können.“ (Baumeister 1994, S. 149). Für die Kunstpädagogen ergibt sich daraus die anspruchsvolle Aufgabe, Heranwachsende nicht nur in ihrem Werkverstehen (Rezeption) und ihrem Ausdrucksvermögen (Produktion) zu unterstützen, sondern ihr Interesse an Kunst zu wecken, damit ihnen auch ästhetische Erfahrungen, diese besonderer Form des Glücks möglich werden: „Dieses Glück ist schlechterdings unvergleichbar. Das heißt, es ist autonom und braucht keine externe Rechtfertigung.“ (Parmentier 2009, S. 59).
Literatur
Adorno, Theodor W.: Ästhetische Theorie. Frankfurt am Main 1973.
Baumeister, Thomas: Ästhetische Erlebnisse. In Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft. Heft 39 / 2, 1994, S. 145–161.
Dewey, John: Kunst als Erfahrung. Frankfurt am Main 1988.
Kern, Andrea: Schöne Lust. Eine Theorie der ästhetischen Erfahrung nach Kant. Frankfurt am Main 2000.
Mattenklott, Gundel: Zur ästhetischen Erfahrung in der Kindheit. In: Mattenklott, Gundel / Rora, Constanze (Hg.): Ästhetische Erfahrung in der Kindheit. Theoretische Grundlagen und empirische Forschung. Weinheim u. München 2004, S. 7–23.
Nietzsche, Friedrich: Ecce homo. Wie man wird, was man ist (1888). In: KSA Band 6, 1980, S. 255–374.
Parmentier, Michael: Der ästhetische Zustand oder: Die Pause im Bildungsprozess. In: Diskussion Musikpädagogik, Sonderheft 1 „Musiktheaterpädagogik“, Hamburg 2009, S. 50–59.
Peez, Georg: Einführung in die Kunstpädagogik. Stuttgart 2008.
Schiller, Friedrich: Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen. Stuttgart 2010.
Welsch, Wolfgang: Ästhetisches Denken. Stuttgart 1998.
Autorin
Kathrin Herbold | Dipl.-Päd., M.A. Kunstpädagogik | Pädagogische
Hochschule Nordwestschweiz
#Ästhetische Forschung
Ästhetische Forschung ist ein kunstpädagogisches Konzept für forschendes Lernen in Verschränkung mit ästhetisch-künstlerischer Praxis an der Schule und an der Hochschule. Kernidee ist die Vernetzung unterschiedlicher Bezugsbereiche aus Alltag, Kunst und Wissenschaft. Verwandte didaktische Konzepte im Kontext der Kunstpädagogik mit einem forschenden Ansatz sind u.a. Biografisches Arbeiten, Displacement, Kartierung, –> künstlerische Feldforschung, –> Mapping, Performance Studies. Helga Kämpf-Jansen (2000, 2001) entwickelte das Konzept der Ästhetischen Forschung in den 1990er Jahren an der Hochschule. An Formen der Übersetzung in Schulunterricht wird nach wie vor gearbeitet. Zentral sind das Arbeiten in Projekten und die angestrebte Eigenverantwortlichkeit der Forschenden und zugleich Lernenden gegenüber ihrem Wissen und Können.
Das Ästhetische der Ästhetischen Forschung ist wesentlicher Bestandteil der Handlungs-, Entscheidungs- und Denkprozesse. Auch hässliche oder unangenehme Dinge können ästhetische Wahrnehmungen auslösen und zum Gegenstand Ästhetischer Forschung werden. Es geht darum, ästhetische Dimensionen für den Erfahrungs- und Erkenntnisprozess ernst zu nehmen und auf das „Wie“ des Herstellens, Herausfindens und Sammelns zu achten und dabei Assoziationen, Erinnerungen und Gefühle, die auftauchen, mit in den Arbeitsprozess einzubeziehen. Der „Eigensinn“ der ästhetisch Forschenden ist ein wichtiger Ausgangspunkt: „Es geht dabei […] um individuellen Sinn, der nicht dem Zwang unterliegt, übertragbar sein zu müssen, und der nicht einmal vollständig verbalisierbar sein muß.“ (Blohm 1995: 6) In ästhetischen Forschungsprojekten werden ungewöhnliche und auch eigensinnige Vorgehensweisen bewusst ausprobiert, um genau zu beobachten, was sie bewirken. Erst in den folgenden nächsten Schritten entscheiden die Forschenden/Lernenden, ob sie weiter so vorgehen oder etwas ändern. Individuell und situativ hergestellter Sinn und ästhetische Wahrnehmungen sind flüchtig. Es bedarf vielfältiger Aufzeichungsformen und Dokumentationsmethoden, die den Prozess auch nachträglich reflektierbar und kommunizierbar machen. Für Ästhetische Forschungen werden vier Bezugsfelder benannt, die alle in einem Forschungsprozess eine Rolle spielen: „Kern Ästhetischer Forschung ist die Vernetzung vorwissenschaftlicher, an Alltagserfahrungen orientierter Verfahren, künstlerischer Strategien und wissenschaftlicher Methoden.“ (Kämpf-Jansen 2001: 274) Zum Bezugsfeld der Alltagserfahrung gehören Dinge, Sammlungen, Biografisches, Selbstorganisation. Zur Alltagserfahrung gehört auch, Alltägliches auf neue Weise zu betrachten und Zufälle zuzulassen und aufzugreifen. Das Bezugsfeld Kunst umfasst aktuelle und historische Kunst. Wichtig ist, dass der Kunstbezug nicht zum bloßen Nachahmen führt, sondern Impulse für neue Möglichkeiten künstlerisch zu arbeiten gibt. Im Bezugsfeld Wissenschaft werden Wissen und auch methodisches Vorgehen (u.a. Recherche, Interview, Feldforschung, Kartografie) aus Fachtexten, Modellen, Archiven, Nachschlagewerken, aber auch aus der Literatur aufgegriffen. Im Bezugsfeld ästhetische Praxis werden alle Felder künstlerisch handelnd verknüpft. Entscheidend ist, dass immer mehrere Bereiche aufeinander bezogen sind.
Ästhetische Forschung findet in einem offenen Bildungsraum statt, der auf Erweiterung hin gedacht wird. Der Lehrer oder die Lehrerin stellt Rahmungen bereit und wird Initiator_in und Begleiter_in von individuellen ästhetisch forschenden Prozessen, die sich optimalerweise in der Lerngruppe kollaborativ vernetzen.
Die Lernenden suchen sich ihre Fragen, Anlässe und Interessen selbst, möglichst in einem gemeinsamen Themen- oder Bezugsfeld einer Lerngruppe. Die Suche nach solchen Interessen ist bereits Teil des Ästhetischen Forschungsprozesses. Es geht für Lernende auch darum, nach und nach zu ihrer eigenen Frage zu finden. Gute Forschungsfragen kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten und sie führen zu weiteren Fragen.
Die Projekte „Kultur. Forscher!“ und „Kulturagenten“ beispielsweise erreichen eine Öffnung des Schulunterrichts, indem Schulen mit Kulturpartnern kooperieren. Der Klassenraum öffnet sich in den Stadtraum und in andere institutionelle Räume wie Museen, Theater, oder durch die Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern.
Gelingensbedingungen
Lehrende wie Lernende nehmen eine ästhetisch-forschende Haltung ein oder bilden diese allmählich aus. Beide Seiten benötigen aus unterschiedlichen Standpunkten heraus Neugierde und Unternehmungsgeist. So kann aus Prozessen des Fragen-Stellens und Antworten-Suchens und dem Suchen nach geeigneten ästhetisch-künstlerischen Realisierungsformen Gewinn und auch Genuss gezogen werden.
Lehrende in Ästhetischen Forschungsprozessen eröffnen neue Felder und interessante Orte für die Lernenden und Forschenden. Sie schaffen Situationen und Rahmungen, die individuelle Prozesse anstoßen und Zwischenergebnisse einfordern. Sie ermöglichen und planen Feed-Back-Formen, wie Einzel- und Gruppen- und Peer-Beratungen, sie machen Forschertagebücher oder Prozessdokumentationen interessant und helfen, dass solche Aufzeichnungen und Zwischenergebnisse zum Medium der individuellen Reflexion und der Kommunikation mit anderen werden können. Sie kooperieren mit Kolleginnen und Kollegen, der Schulleitung, anderen wichtigen Menschen wie der Haustechnik und mit Kulturpartnern. Die Frage des Lehrenden lautet: Wie finden Schüler_innen zu einer Frage?
Je offener der Bildungsraum und die Arbeitsprozesse sind, desto mehr werden produktive Rahmungen und verlässliche Strukturen benötigt. Das Konzept des –> Selbstorganisierten Lernens (SOL) kann hier hilfreich sein. Wer als Pädagoge oder Pädagogin offene Prozesse verantworten will, muss auch heterogene Lerngruppen in individuellen Arbeitsprozessen begleiten und auf Unvorhergesehenes und singuläre Entdeckungen oder entstehende Unsicherheiten antworten können.
Diskussion
In Ästhetischen Forschungen geht es um das bewusste Aufsuchen und produktiv Machen unterschiedlicher Wissens- und Institutions- und Kultur-Kontexte. Nicht alles ist Ästhetische Forschung, nur weil ästhetisch-praktisch oder künstlerisch gearbeitet wird. Nicht jede Collage oder jede Theateraufführung ist bereits Produkt ästhetischer Forschungsprozesse. Die Frage nach Unterschieden zu anderen Projekt- und Arbeitsformen der Kunst- und Kulturpädagogik ist auch für die Selbstreflexion in Ästhetischen Forschungsprozessen erhellend.
Kunst und insbesondere aktuelle Kunst ist ein zentrales Bezugsfeld der Ästhetischen Forschung und stellt die Verknüpfung zu zeitgenössischen Fragestellungen her. Insofern müsste sich auch das, was wir heute unter Projekten Ästhetischer Forschung verstehen, mit der Zeitgenossenschaft aktueller Kunst verändern. Kämpf-Jansen beschrieb für die Kunst der 1990er Jahre thematische Schwerpunkte wie den Körper, die Transformation der Dinge zu Objekten der Kunst oder die Archive. So könnten es heute vielleicht verstärkt der urbane Raum, das Social Web, die Grenzüberschreitung oder die Frage „Wie wollen wir leben?“ sein. Wie Ästhetische Forschungen heute und in Zukunft praktisch aussehen können und um welche Fragen es den Forschenden/Lernenden dabei geht, wird mit jedem Projekt neu beantwortet.
Literatur
Blohm, Manfred (1997): Die Documenta X als Feld für ästhetische Forschungsprojekte von Schülerinnen und Schülern. In: BDK-Mitteilungen Heft 3/1997, S. 24–28
Blohm, Manfred/ Heil, Christine/ Peters, Maria/ Sabisch, Andrea/ Seydel, Fritz (Hg.) (2006): Über ästhetische Forschung. Lektüre zu Texten von Helga Kämpf-Jansen. München
Kämpf-Jansen, Helga (2000): Ästhetische Forschung. Aspekte eines innovativen Konzeptes ästhetischer Bildung. In: Blohm, Manfred (Hg.): Leerstellen. Perspektiven für ästhetisches Lernen in der Schule. Köln, S. 83–11
Kämpf-Jansen, Helga (2001): Ästhetische Forschung. Wege durch Alltag Kunst und Wissenschaft. Zu einem innovativen Konzept ästhetischer Bildung. Köln
Leuschner, Christina/ Knoke Andreas (Hg.) (2012): Selbst entdecken ist die Kunst. Ästhetische Forschung in der Schule. München
Internetseiten
http://www.kultur-forscher.de/
http://www.kulturagenten-programm.de
Autorin
Christine Heil | Prof. Dr. | Universität Duisburg-Essen |
http://udue.de/heil
#Atmosphäre
Begriff und Phänomen
Aus seinem ursprünglich meteorologischen Kontext zur Kennzeichnung der Dunstkugel (atmos-sphaira) eines Himmelskörpers, transportiert der Atmosphäre-Begriff vor allem zwei Eigenschaften in den ästhetischen Diskurs. Zum einen umhüllt die Atmosphäre allseitig, sie umgibt Menschen, Dinge, Situationen und ist damit sowohl nicht bloß Subjekten als auch nicht bloß Objekten zuzurechnen. Zum anderen hat die Atmosphäre eine Wirkung, sie prägt Räume mit einer emotionalen Tönung und macht affektiv betroffen.
Erlebten Raum als Atmosphäre aufzufassen ist aus dem alltäglichen Sprechen bekannt: In Konferenzräumen herrschen angespannte oder eisige Atmosphären, Urlaubsresorts werben mit Atmosphären zum Wohlfühlen, das Klassenklima ist von konzentrierten Lernatmosphären geprägt. Theoretisch wurzelt die Atmosphäretheorie in der Leibphänomenologie und ökologischen Naturästhetik. Gernot Böhme definiert Atmosphäre als die „Beziehung von Umgebungsqualitäten und menschlichem Befinden. Dieses Und, dieses zwischen beidem, dasjenige, wodurch Umgebungsqualitäten und Befinden aufeinander bezogen sind, das sind die Atmosphären.“ (Böhme 2013, S. 22f.) Das unscheinbare ‚Und’ im Bezug von Umgebung und Befinden ist symptomatisch für die Stellung des Atmosphärethemas im wissenschaftlichen Diskurs wie auch für die ontologischen Eigenschaften der Atmosphäre. Als kleines ‚Und’ zwischen vermessbaren Objektkonstellation sowie befragbaren Subjekten wird die Atmosphäre als Epi- oder Folgephänomen übergangen. Dieses Übergehen könnte aber auch mit der ontologisch schwer greifbaren Zwischenstellung zusammenhängen, wobei die Atmosphäre nicht nur zwischen Subjekt und Objekt zu erspüren ist, sondern zugleich von beiden konstituiert wird (vgl. Fischer-Lichte 2004, S. 202). Damit scheint sie eher in deskriptiven als in normativen Kontexten relevant und kennzeichnet als im Raum schwebende Gefühle oder Stimmungen etwas reichlich Vages – was sich auch in der Definition von Hermann Schmitz andeutet: „Gefühle sind räumlich, aber ortlos, ergossene Atmosphären“ (Schmitz 2009, S. 23).
Die Atmosphäre ist ein ‚Und’ von Umgebungsqualität und eigenem Befinden – sie ist kein ‚Oder’ der entschiedenen Zuwendung zu bloß einer der sie konstituierenden Faktoren. Diese Beziehung von Umgebung und Befinden herrscht immer und überall in je charakteristischer Ausprägung und Intensität. Sie lässt sich affektiv wahrnehmen wie eigenständige und im Raum schwebende Gefühle.
Wahrnehmung
Monet spricht das In- und Miteinander von Umgebung und Befinden in einigen Briefen als „alles umhüllenden Umschlag“ (Mahayni 2002, S. 62f.) an. Wichtiger als das augenscheinliche Motiv sei ihm, dasjenige zu reproduzieren, was zwischen dem Motiv und ihm selbst ist, dasjenige, was er als umhüllenden Umschlag erfühlt. Seine Kathedralen-Serie versucht demnach mehr zu zeigen, als es ein einzelnes Bild oder eine Architekturzeichnung der Kathedrale vermögen. Im Sinne des Umschlags ist der Gegenstand seiner Gemälde-Serie nicht 20-mal dieselbe Kathedrale, sondern es sind 20 verschiedene Atmosphären, in denen die Kathedrale auf 20 Weisen erscheint: z.B. verheißungsvoll, zurückweisend, ungewiss, geborgen. Es bereitet dem Künstler Schwierigkeiten, die Perspektive der Ergriffenheit von diesen Atmosphären auf die Bilder zu bannen. Die Schwierigkeiten bestehen darin, dass das Zwischen kein statisches Phänomen darstellt, das man distanziert betrachten und malen könnte. Es bildet sich vielmehr im jeweiligen Hier und Jetzt der gemeinsamen Wahrnehmungswirklichkeit des ‚Und’.





























