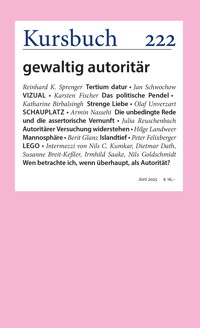
Kursbuch 222 E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kursbuch Kulturstiftung gGmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Autoritäre ist weltweit auf dem Vormarsch. Autokratische Regierungen, autoritäre Politiker und Manager, toxische Männlichkeit, um nur einige Schlagwörter zu nennen. Das Autoritäre ist eine Durchsetzung ohne Zustimmung, Autorität eine Zustimmung ohne Durchsetzung. Es geht um das richtige Ausbalancieren von Möglichkeiten. Oder um das Finden von Kompromissen als einziges "Gegengift" gegen das Autoritäre. Bemerkenswert ist das Interview mit der britischen Lehrerin Katharine Birbalsingh, die als Großbritanniens "strikteste Lehrerin" gilt. Sie arbeitet an einer Schule in einem verarmten Innenstadtviertel und pflegt einen autoritären Stil in dem Sinne, dass sie ihren Schutzbefohlenen sehr direktiv viel abverlangt. Ihre Methode ist sehr erfolgreich und führt bis zu 80 Prozent ihrer migrantischen, unterprivilegierten Klientel an führende Universitäten des Landes. In den fünf Intermezzi wiederum antworten Nils C. Kumkar, Dietmar Dath, Susanne Breit-Kessler, Irmhild Saake und Nils Goldschmidt auf die Frage, wen sie, wenn überhaupt, als echte Autorität betrachten würden. Jan Schwochow rekonstruiert grafisch die Geschichte der Oligarchisierung der Tech-Branche in den USA, Olaf Unverzarts Bilder aus Moldawien aus diesem Jahr markieren gewissermaßen die Gegenseite dieser High-End- und High-Tech-Welt. Anmerkung: Der Fotograf wollte eigentlich in die USA reisen, jedoch wurde ihm die Einreise verweigert, weil er vor acht Jahren im Iran ein Radrennen fotografiert hatte. Stattdessen reiste er an den Rand Europas, auf den Spuren sowjetischer Architektur und ihrer gegenwärtigen Adaption. Berit Glanz' "Islandtief beschäftigt sich mit Literaturtourismus, den sie als attraktive Alternative zum reinen Naturtourismus nach Island darstellt. Beschlossen wird dieses Kursbuch durch die erste Buchkolumne von Peter Felixberger. Er bespricht das Buch "Das ideologische Gehirn" von Leor Zmigrod. Seine Kolumne heißt LEGO. Das hat nichts mit dänischem Spielzeug zu tun, sondern ist lateinisch und heißt: Ich lese. Das sollte man dieses Kursbuch auch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Armin Nassehi Editorial
Reinhard K. SprengerTertium daturÜber das Autoritative im Management
Jan SchwochowVIZUALEinflussreich
Karsten FischerDas politische PendelDie ewige Konkurrenz zwischen freiheitlicher und autoritärer Herrschaft
Intermezzo Wen betrachte ich, wenn überhaupt, als echte Autorität?Nils C. Kumkar
Katharine BirbalsinghStrenge LiebeEin Interview von Jochen Bittner
SCHAUPLATZDie Fotokolumne von Olaf Unverzart
Armin NassehiDie unbedingte Rede und die assertorische VernunftSechs Motive
Intermezzo Wen betrachte ich, wenn überhaupt, als echte Autorität?Dietmar Dath
Intermezzo Wen betrachte ich, wenn überhaupt, als echte Autorität?Susanne Breit-Keßler
Julia ReuschenbachAutoritärer Versuchung widerstehenEin Plädoyer für mehr Kompromisse, Ausgleich, Verhandlung und Demokratie
Intermezzo Wen betrachte ich, wenn überhaupt, als echte Autorität?Irmhild Saake
Hilge LandweerMannosphäreDer autoritäre Kampf gegen die »Entmännlichung« der Gesellschaft
Intermezzo Wen betrachte ich, wenn überhaupt, als echte Autorität?Nils Goldschmidt
Berit Glanz | Islandtief (14)Literaturstädte und Buchtouristen Die Berit-Glanz-Kolumne
LEGODie Buchkolumne von Peter Felixberger
Die Autoren und Autorinnen
Impressum
Armin Nassehi Editorial
Das Autoritäre kehrt wieder. Man kann den Satz für naiv halten, als sei es je verschwunden, als habe die Kultur- und Gesellschaftsgeschichte nicht Alternativen zu autoritären Formen der Ordnung entwickelt. Man denke an die Gewaltenteilung und die Demokratie im politischen Feld, an kulturellen und künstlerischen Pluralismus und eine gerade dort relevante Kritikkultur, man denke an symmetrischere Verhältnisse zwischen Männern und Frauen, zwischen Eltern und Kindern, zwischen Professionellen und ihren Klienten, man denke daran, dass sich religiöse Moralvorstellungen nicht mehr in derselben Weise autoritär durchsetzen können, man denke an deliberative Öffentlichkeiten, in denen die freie Rede so weit fortgeschritten ist, dass sogar Teilnehmer solcher Deliberationen behaupten können, sie könnten nicht offen reden. So etwas kann man nur in Sphären tun, die nicht autoritär strukturiert sind. In autoritären Strukturen so etwas zu behaupten, wird zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung.
Noch einmal: Das Autoritäre war nie verschwunden, aber es kehrt auch dort wieder, wo man es, wenn nicht überwunden, so wenigstens abgemildert und vor allem skandalisier- und kritisierbar gemacht hat. Vielleicht ist der Begriff der Gewaltenteilung der entscheidende – er ist üblicherweise reserviert für die Differenzierung von Recht und Politik, für die Trennung von Legislative, Exekutive und Judikative. Man zitiert gerne John Locke und Montesquieu als Urheber, aber der Gedanke findet sich bereits viel früher. Man kann den Gedanken formalisieren als das Auseinandertreten von unterschiedlichen Aufgaben, Perspektiven, Einflussnahmen und Formen, die sich wechselseitig nicht nur voraussetzen, sondern auch Zentralperspektiven verhindern. Diese Figur findet sich überall, in der Wissenschaft ebenso wie in Kunst und Kultur, in Familien und Organisationen und so weiter. Womöglich muss man den wettbewerbsorientierten Markt auch als so etwas Ähnliches beschreiben – nicht umsonst werden Kartellsituationen auf Märkten als Störung und Gefahr angesehen.
Diese Art von »Gewaltenteilung« erhöht wechselseitige Abhängigkeiten und vor allem den Kooperations- und Koordinationsbedarf, und es verlängert die Wege. Das Autoritäre nimmt die gerade Abkürzung, es legitimiert sich selbst, in diesem Sinne ist es eben autokratisch. Die Beiträge dieses Kursbuchs widmen sich alle diesem Verhältnis zwischen zu geraden und wechselseitigen Wegen. So weist Reinhard K. Sprenger darauf hin, wie Führung das Verhältnis von Durchsetzung und Zustimmung bearbeitet. Das Autoritäre nennt er eine Durchsetzung ohne Zustimmung, Autorität sei Zustimmung ohne Durchsetzung, das Autoritative sei in der Lage, Zustimmung und Durchsetzung zu kombinieren. Er plädiert für ein Balancieren von Möglichkeiten. Karsten Fischers Rekonstruktion der politischen Alternativen zwischen autoritären und freiheitlichen Formen bewegt sich auf einem ganz anderen Feld, aber nimmt ebenfalls eine Phänomenologie autoritärer und nicht-autoritärer Herrschaftsformen vor, einschließlich eines Hinweises auf eine Renaissance des Autoritären. In ein ähnliches Horn stößt Julia Reuschenbach, die den politischen Kompromiss, jene »lästige« Erfahrung des Mühsamen, als einziges »Gegengift« gegen das Autoritäre herausarbeitet. Hilge Landweer widmet sich den spezifisch männlichen Konnotationen autoritärer Herrschaft, die stets mit der Abwertung von Frauen und von Schwachen einhergehen. Mein eigener Beitrag fragt nach den kommunikativen Formen des Autoritären und nimmt eine Kritik der assertorischen Vernunft vor.
Bemerkenswert ist das Interview mit der britischen Lehrerin Katharine Birbalsingh, die als Großbritanniens »strikteste Lehrerin« gilt. Sie arbeitet an einer Schule in einem verarmten Innenstadtviertel und pflegt einen autoritären Stil in dem Sinne, dass sie ihren Schutzbefohlenen sehr direktiv viel abverlangt. Ihre Methode, die vor allem von jenen, die man in Deutschland »Kulturlinke« nennt, oft abgelehnt wird, ist sehr erfolgreich und führt bis zu 80 Prozent ihrer migrantischen, unterprivilegierten Klientel an führende Universitäten des Landes. Mein Lieblingssatz aus dem Interview: »In vielen Schulen heißt es: ›Wir dürfen ihnen nicht zu viel Shakespeare beibringen, weil die armen schwarzen Jungen sich unmöglich mit Shakespeare identifizieren können.‹ Das ist meiner Meinung nach Rassismus: Man hat geringere Erwartungen an Kinder, weil sie nicht weiß sind.« Das Interview führte der ZEIT-Journalist Jochen Bittner.
In den fünf Intermezzi haben wir den eher positiven Bedeutungsgehalt des Wortes Autorität aufgenommen und unsere Autorinnen und Autoren Nils C. Kumkar, Dietmar Dath, Susanne Breit-Keßler, Irmhild Saake und Nils Goldschmidt gebeten, die Frage zu beantworten, wen sie, wenn überhaupt, als echte Autorität betrachten.
Jan Schwochow rekonstruiert grafisch die Geschichte der Oligarchisierung der Tech-Branche in den USA, Olaf Unverzarts Bilder aus Moldawien aus diesem Jahr markieren gewissermaßen die Gegenseite dieser High-End- und High-Tech-Welt. Aber es gibt sogar eine gewisse Verknüpfung der beiden Themen: Der Fotograf wollte eigentlich in die USA reisen, jedoch wurde ihm die Einreise verweigert, weil er vor acht Jahren im Iran ein Radrennen fotografiert hatte. Stattdessen reiste er an den Rand Europas, auf den Spuren sowjetischer Architektur und ihrer gegenwärtigen Adaption. Welche Art von Verfall hätte er wohl in den USA fotografiert?
Berit Glanz’ »Islandtief«, ihr 14. Beitrag für das Kursbuch, beschäftigt sich mit Literaturtourismus, den sie als attraktive Alternative zum reinen Naturtourismus nach Island darstellt – inspiriert durch eine eigene Reise nach Bath auf den Spuren von Jane Austen.
Beschlossen wird dieses Kursbuch durch die erste Buchkolumne von Peter Felixberger. Er bespricht das Buch Das ideologische Gehirn von Leor Zmigrod. Vorher hat Peter das Buch gelesen. Seine Kolumne heißt »LEGO«. Das hat nichts mit dänischem Spielzeug zu tun, sondern ist lateinisch und heißt: Ich lese.
Das sollten Sie, liebe Leserinnen und Leser, auch tun. Viel Vergnügen mit diesem Kursbuch!
Reinhard K. SprengerTertium daturÜber das Autoritative im Management
Das Autoritäre
Einen bestimmten Führungsstil durchsetzen ist das Anliegen vieler Unternehmen. Gedacht wird dabei an ein stabiles Verhaltensmuster der Führungskräfte, das auf Produktivitätssteigerung der Mitarbeiter zielt. Ein verschriftlichtes und in Seminaren eingeübtes Führungsleitbild gilt als geeigneter Hebel. Die Inhalte der dort beschriebenen Führungsstile sind ausnahmslos idealtypische Überhöhungen scheinbar positiver menschlicher Eigenschaften, die in wirtschaftsfernen, aber pädagogikaffinen Bildungskreisen zu Leitbegriffen erhoben wurden. Insofern sind sie überraschungsfrei, firmieren jedoch unter verschiedenen Etiketten. Es gibt den demokratischen Führungsstil, den partizipativen, kooperativen, mitarbeiterorientierten, situativen, transformativen, transaktionalen und den Laisser-faire-Führungsstil – wahrscheinlich noch einige mehr. Gemeinsam ist dieser Melange aus sozialer Intelligenz, Teamfähigkeit und Empathie der Gegenentwurf: die autoritäre Führung. Vorausgesetzt werden dabei zwei Entscheidungen: Das Autoritäre ist a) alt und b) schlecht. Mit einer Ausnahme: Gegen das Autoritäre ist nichts zu sagen, solange es antiautoritär ist.
Bei Führungsstilkonzepten geht es im Kern um das Maß an Entscheidungsbeteiligung, das Unterstellten zugestanden wird. Der autoritäre Führungsstil betont die hierarchiegebundene Alleinentscheidung. Ein Vorgesetzter (im Wortsinn) trifft die wesentlichen Entscheidungen und kaskadiert entsprechende Aufgaben nach unten. Mitarbeiter erhalten nur jene Informationen, die sie brauchen, um ihre Aufgaben zu erledigen. Zugespitzt: Mitarbeiter sollen machen, nicht denken.
Für die Praxis ist vor allem interessant, mit welchen Konsequenzen ein Führungsstil zu rechnen hat. Die Vorteile autoritärer Führung liegen auf der Hand: klare Rollen, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten. Nicht unwesentlich ist auch der Anteil jener Mitarbeiter, die die psychologische Sicherheit präziser Vorgaben schätzen. Die Nachteile autoritärer Führung wurden erstmals durch eine Studie Kurt Lewins an der Universität von Iowa im Jahr 1939 beschrieben. Lewin konnte den negativen Einfluss autoritären Führungsverhaltens auf die Produktivität von Kindergruppen nachweisen. Bei Erwachsenen sind die Nachteile autoritärer Führung bis heute mehr gefühlt als empirisch untersucht. Als da wären: Potenziale der Mitarbeiter bleiben ungenutzt; sie handeln nicht unternehmerisch-selbstverantwortlich und situativ flexibel; bei Abwesenheit der Führung kommt es zu Lähmungserscheinungen. Beobachtet wurden vereinzelt höhere Fehlzeiten und Mitarbeiterfluktuation.
Ein eindeutigeres Urteil verhindern weitere Differenzierungen, die sich unter der Überschrift »autoritär« finden – etwa, wenn die Einstellung des Vorgesetzten zum Mitarbeiter zwischen »Kontrolle« und »Misstrauen« mikroskopisch schwankt. Mag der theoretische Gehalt dieser Differenzierungen bedeutend sein, in praktischer Hinsicht ist er zu vernachlässigen. Es ist unwahrscheinlich, dass zwei Personen, die denselben Begriff nutzen, darunter genau dasselbe verstehen. Kurz, was als »autoritär« erlebt wird, ist beobachterabhängig.
Zudem ist es keineswegs evident, dass eine autoritäre Führung unter allen Umständen erfolgloser ist. Bei Polizei, Feuerwehr, Militär, bei Gefahrengütern und in traditionellen Schornsteinindustrien ist der autoritäre Führungsstil durchaus nicht anachronistisch. Wer Kreativagenturen als positiv konnotierten Gegenpol in Stellung bringt, übersieht, dass gerade der nicht-formalisierte Umgang oft zu Phänomenen wie ungezügeltem Zorn, rüdem Sprachverhalten und sexueller Übergriffigkeit führt.
Der autoritäre Führungsstil ist traditionell gebunden an Hierarchie, an die »heilige Ordnung« des griechischen Denkens. Sie weist Menschen einen Hochstatus oder einen Tiefstatus zu. Heute hat sie unter den Auspizien verinnerlichter Demokratie keinen guten Ruf, gilt als dünkelhaft und elitär. Und dennoch wird es Hierarchie in Unternehmen immer geben. Dafür sorgen schon Eigentumsrechte. Keine Kooperation funktioniert langfristig, wenn darüber keine Führung mit Gewaltmonopol liegt. Die Verhältnisse im Unternehmen sind eben nicht herrschaftsfrei, nicht symmetrisch, nicht, wie man es heute gerne bebildert, »auf Augenhöhe«. Unbestreitbar ist zudem die hervorstechende Befähigung der Hierarchie, schnell entscheiden zu können. Einfach kraft Position. Insofern verspricht Hierarchie das Ende der Ambivalenz; auf diese Weise sichert sie die Handlungsfähigkeit des Unternehmens. Eine wichtige Funktion: Hierarchie befriedet. Diese disziplinierende Wirkung entsteht allerdings nur, wenn der Kern der »heiligen Ordnung« gewahrt bleibt: nämlich, Entscheidungen nicht rechtfertigen zu müssen. Sonst hat Hierarchie zu viele gute Gründe, wegzusehen. Oder sie reagiert zu langsam oder delegiert die Entscheidung an Unternehmensberatungen. Cover your ass: McKinsey hat gesagt … Pontius Pilatus winkt von ferne.
Die Autorität
»Erst das Zeitalter der Entdeckungen befreite sich von seiner Autorität.« Unter dem Stichwort »Aristoteles« steht dieser Satz im Tusculum-Lexikon, dem unersetzlichen Hilfsmittel des Altertumsforschers. Autorität wäre danach etwas, was die Freiheit einschränkt. Das wirft Fragen auf: Sollte nicht Philosophie von aller Autorität frei, ja geradezu ein Gegenunternehmen zur Autorität sein? Ist Vernunft gar eine Negation von Autorität? Wirken viele nur groß, weil andere sich ducken?
Wenn wir als Gegenbegriff gegen das »Autoritäre« hier die »Autorität« ins Spiel bringen, dann zunächst aufgrund der Tatsache, dass beide Begriffe dem Bereich des Sozialen entstammen. Sie kennzeichnen verschiedene Weisen der Beeinflussung. Sodann müssen wir konzedieren, dass »Autorität« als Substantiv im Unternehmen unbedeutend ist; sie lässt sich nicht organisatorisch verfassen. Auf verdeckte Weise ist sie aber eingeflochten in moderne Organisationsformen, die unter Adjektiven wie »agil«, »flexibel«, »fluide«, »ambidexträr« oder »holokratisch« erprobt werden.
Diese Hintergründigkeit von Autorität kann man verdeutlichen durch die Frage: Was macht eine Führungskraft zur Führungskraft? Nicht zu einem »Vorgesetzten«, auch nicht zu einer »guten« Führungskraft. Sondern zu einem Menschen, der kraftvoll eine Gruppe von Menschen in die Zukunft führt – wie es dem Wort »Führungskraft« entspricht.
Für eine Antwort sollten wir Persönlichkeitseigenschaften ausblenden und stattdessen »Erfolg« zum entscheidenden Führungskriterium machen. So kommen die Geführten in den Blick. Und dann ist evident: Führende haben Folgende. Eine Führungskraft wird erschaffen durch die Entscheidung der Mitarbeiter, ihr zu folgen. Und dieses Folgen muss freiwillig er-folgen. Die Akzeptanz einer Führungskraft ist daher nicht zwingend an ein Amt gebunden, ist auch unabhängig von der Position im Organigramm, wird nicht notwendig hierarchisch legalisiert. Sondern legitimiert. Die Legitimation erfolgt »von unten«. Damit ist Autorität die Fähigkeit, die zwanglose Zustimmung anderer zu gewinnen.
Warum aber sollten Geführte der Führung zustimmen? Warum sollten sie folgen? Man kann argumentieren: Autorität bedeutet, dass etwas Grund ist, was nicht recht begründet werden kann. Kandidaten dafür wären Charisma, Parkettfähigkeit, Erfahrung, ein Schöpfermythos, dynastische Herkunft, die oft unterschätzte Körpergröße. Oder das Alter: Cicero lässt den alten Cato über das Alter sprechen, »damit dadurch die Rede größere Autorität habe«. Heute wird für Autorität auch die relevante Sachkompetenz gefordert. In Zeiten sich überschlagender Neuerung ist beispielsweise junge, digital-native Expertise gefragt.
Modellieren wir das Unternehmen als Kooperationsarena, dann ist Autorität in den Worten Hannah Arendts die »menschliche Fähigkeit, nicht nur zu handeln oder etwas zu tun, sondern sich mit anderen zusammenzuschließen und im Einvernehmen mit ihnen zu handeln«. Zusammen! Einvernehmen! Wenn es also die zentrale Aufgabe von Führung ist, Zusammenarbeit zu organisieren, dann ist Vertrauen dafür die unersetzliche Voraussetzung. Sich führen lassen heißt, sich jemandem anvertrauen. Dieses Vertrauen ist aber nicht naiv, allumfassend und grenzenlos, sondern spezifisch – es hat eine Richtung.
Der Blick in die Anthropologie ist dafür illustrativ: Überschaut man den Hauptstrom der einschlägigen Forschung, hat es bei Jägern und Sammlern bereits Führung gegeben. In diesen Epochen war es keine generalisierte Führung, sondern eine situative, die für eine bestimmte Aufgabe gebraucht wurde. Die Gruppe wählte sich einen An-Führer, der für das Lösen dieses Problems geeignet war. Genau dafür genoss er das Vertrauen der Gruppe. Dieses Vertrauen war somit an einen besonderen Zweck gebunden. War der Zweck erfüllt, verlor der Anführer seine Rolle, aber nicht seine Autorität.
Dieser historische Hinweis ist ernst zu nehmen. Vertrauen bezieht sich auf einen signifikanten Beitrag, der für die Empfänger von Führung vorteilhaft ist. Was immer das sei: Arbeit, Einkommen, Sicherheit, Erfolg, Freiheit, Nahrung, Orientierung, Wegweisung, Frieden, Gleichberechtigung, Wohlstand, Ruhm, Sinnerfüllung. Das Gewähltwerden des Anführers vollzieht sich pragmatisch, auf natürliche Weise, auf der Grundlage zwanglosen Selbstzwangs.
Die Anerkennung einer Autorität schließt daher Freiheit nicht aus, wie eingangs mit Blick auf Aristoteles gefragt wurde. Im Gegenteil! Autorität ist eben kein Befehl, keine Durchsetzungsgewalt. Sondern sie muss anerkannt werden, wenn sie wirken soll, und diese Anerkennung muss sie immer neu erringen. Das heißt: Die Autorität eines Anerkannten ist auf die Autorität des Anerkennenden angewiesen. Wenn ein Leistungsentstehungsprozess von Autorität getragen wird (und nicht von Hierarchie), dominiert kein Darüber oder Darunter, sondern der Gleichrang wechselseitiger Anerkennung.
Das macht die Autorität so unhandlich für eine auf Prognosesicherheit gebaute Organisation; das amerikanische »how to make sure« kann nicht einmal annäherungsweise beantwortet werden (ob überhaupt, ist eine andere Frage). Wenn man zum unproduktiven Traditionalismus des »einmal Führungskraft, immer Führungskraft« greift, wenn Führung eingerastet oder nur mit erheblichem Aufwand zu beenden ist, schwingt das Pendel in das Gegenteil von Autorität: ins Autoritäre. Menschen, die man nicht infrage stellen kann, sind keine Autoritäten.
Fassen wir zusammen: Das Autoritäre ist monologisch; es zielt auf die Erhaltung der Ordnung um ihrer selbst willen. Der Autorität hingegen ist die Ordnung nicht wichtig; sie kommt ohne harte Macht aus. Noch einmal Hannah Arendt: »Autorität schließt den Gebrauch jeglichen Zwangs aus.« Dieser Zwang fehlt der Autorität im Konfliktfall. Das kümmert jedoch die Autoritäten unter den Führungskräften nicht: sich suchen, nicht zu führen – sie werden gerufen.
Das Autoritative
In einer Gesellschaft der Singularitäten gibt es nicht »den« Mitarbeiter, dem man einen einheitlichen Führungsstil überstülpen kann. Ebenso gibt es keine Organisationsform, die den unterschiedlichen Marktdynamiken gerecht wird. Moderne Unternehmen sind »Zwischen«-Phänomene. Sie müssen sich ständig ändern, weil sich die Umwelt ständig ändert. Sie müssen sich wohlfühlen im Oszillieren zwischen organisatorischer Alternativvernichtung (»Nur so!«) und turbulenter Marktdynamik, müssen hin und her »zappen« können. Deshalb sind sie gut beraten, auf dogmatische Kommunikationen zu verzichten – sowohl sprachlicher wie struktureller Natur. Der äußere Kontext bestimmt, was zu tun und zu lassen ist. Im Grunde führt der Kunde das Unternehmen, nicht das Management.
Eine autoritative Führung greift diese Realitäten auf. Sie unterscheidet sich einerseits von der autoritären Führung durch ein höheres Maß an wechselseitiger Anerkennung und Dialogbereitschaft. Andererseits unterscheidet sie sich von einer Führung durch Autorität durch ein höheres Maß an machtgestützter Eingriffsmöglichkeit – wenn diese notwendig ist. Die autoritative Führung kommt also aus der Logik der Mischungen, sie entsagt der scheinbaren Sicherheit des Eindeutigen. Tertium datur.
Das Autoritative hat historische Vorbilder. Vor allem die Spätphase der römischen Republik ist für eine Legierung von Gewalt und Gewaltlosigkeit informativ. Mit der Erweiterung des Staatsgebietes und der völkerrechtlichen Beziehungen wuchs die Bedeutung des Senats. Erst die von ihm verliehene »auctoritas patrum«, die staatsrechtlich eine »Mehrung« oder »Bestätigung« bedeutete, machte Volksbeschlüsse oder das Handeln der einzelnen Magistrate wirksam. Die römische Republik wurde so in ihrer Blütezeit zu einem Adelsstaat, der von einer traditionsverpflichteten und staatsmännisch erprobten Elite geführt wurde. Die einzelnen Amtsträger besaßen die Amtsgewalt der »potestas« (vom lateinischen potentia, also des Könnens) – heute würden wir Durchsetzungsmacht sagen. Aber die auf »auctoritas« gegründete Macht des Senats ließ diese Amtsträger zu Vollstreckungsorganen des Senats herabsinken. Auch die Volksversammlung wurde auf formale Befugnisse zurückgedrängt, die ohne Bestätigung des Senats wirkungslos blieben. Unter dieser Konstruktion stieg das römische Volk zur hegemonialen Macht im Mittelmeerraum auf. Verfassungsgeschichtlich war das ein einmaliger Vorgang: Ohne rechtliche Grundlage verschob sich die Macht von der »potestas« zur »auctoritas«.
Der Adoptivsohn und Großneffe Cäsars, Octavianus, ging nun einen entscheidenden Schritt weiter. Nach Ausschaltung aller Konkurrenten um die Nachfolge Cäsars zog er sich etappenweise und öffentlichkeitswirksam aus allen Ämtern zurück, setzte formal weiterhin Amtsträger ein (was die altrömische Tradition ehrte), entmachtete faktisch den Senat und vereinigte alle tatsächlich wirksame Macht in seiner Person





























