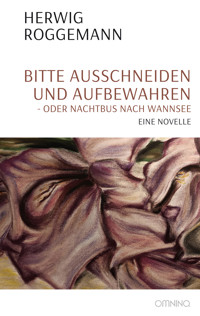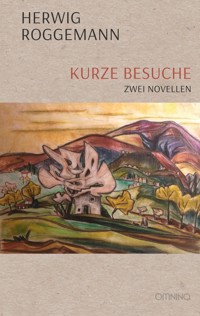
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Omnino Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was bedeutet Krieg? In beiden Geschichten nimmt uns der Autor mit auf eine Reise: Ein Mann und seine Frau besuchen die Eltern eines Freundes im bosnischen Hinterland, wo der Krieg bereits vorbei ist. Ihr Freund Abedin ist noch in Sarajevo als Scharfschütze im Einsatz. „Bosnien“, sagt seine Frau, „bist du verrückt?“ Damit beginnt eine Reise in die bodenlosen Randbereiche des Bosnienkrieges, wo jedes Wort zu viel und eine Geschichte ein Leben wiegen kann. Jenseits illusionistischer Erzählweise bezieht der Autor sich fragend und kommentierend in das Geschehen mit ein. Am Ende bietet er verschiedene Schlüsse an und verlangt damit von seinen Leserinnen und Lesern, was ihm selbst schwerfällt: sich zu entscheiden – und weiter zu schreiben. Ein Professor fährt mit seinen Studenten nach Den Haag zur Gerichtsverhandlung gegen den ehemaligen Präsidenten Jugoslawiens, Slobodan Milošević, vor dem UN-Tribunal. Obwohl sie glauben, alles gut vorbereitet zu haben, müssen sie Erfahrungen machen, denen sie nicht gewachsen sind. Die Seminarexkursion entwickelt sich zum Alptraum. Es geht um nichts weniger als die Frage der Kriege als Männerkriege und die Rolle der Frauen als Opfer und Zeuginnen – und um deren Überleben. Die zu verschiedenen Zeiten entstandenen Novellen führen auf unterschiedlichen Wegen in die Schrecken und Absurditäten des Krieges, hier des Jugoslawienkrieges, hinein. Kriege werden uns weiterhin und intensiver als zuvor beschäftigen. Der Jugoslawienkrieg war bereits eine Zeitenwende – und der Balkan ist nach wie vor ein Pulverfass.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Kurze Besuche
Impressum
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN: 9783958942974
© Copyright: Omnino Verlag, Berlin / 2024
Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen und digitalen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.
Personen, Handlungen und Ereignisse sind mehr oder weniger erdacht und erfunden, auch wenn sie der Realität nahe oder entlehnt scheinen. Für ihre Verwandlung in die neue Wirklichkeit dieser Novellen sind Leser und Leserinnen verantwortlich. Für den Autor bewahrheiten sie sich, indem er sie teilt.
Susanne, Anne und Helmut (1967–2018) zugedacht
NIHIL OCCULTUM
(Nichts ist geheim – geheimnisvoll ist das Nichts)
Petar Hektorović (1487–1572)
Inhalt
Kurze Besuche oder Abedin war mein Freund
Im Tribunal oder Hinter der Glaswand
Kurze Besuche
oder
Abedin war mein Freund
Diese Geschichte hat keinen Anfang. Sie hat auch kein Ende. Sie hat gegenüber Geschichten, die sich Schriftsteller ausdenken, um dann unter Anwendung der verschiedensten Tricks (alte Briefe, Tagebuchfund, Reisebeschreibung, Prozessakten, Schulaufsatz usw.) zu behaupten, sie erzählten die Wahrheit, den weiteren Nachteil, dass sie auf den ersten Blick unglaubwürdig scheint. Wie viele Geschichten, die, wie man so sagt, das Leben schrieb. Denn das ist überraschender und grausamer als unsere Vorstellungskraft. Und kennt im Krieg weder Maß noch Moral. (Nur im Krieg?)
Ich weiß nicht, welches Ende die Geschichte für die nimmt, die sie zu Ende lesen. Denn im Gegensatz zu den Betroffenen, die darin umkommen oder verschwinden, lebe ich in ihr (oder neben ihr?) weiter und überlasse denen, die sich lesend darauf eingelassen haben, die Wahl des Endes – und damit ihres Endes. (Bliebe demnach nicht nur die Zukunft, sondern auch die Vergangenheit für uns ein offenes Buch?)
Abedin war mein Freund. Jedenfalls fragten sie mich nachher in Milna immer wieder: „Wo ist denn dein Freund Abedin?“ Ich weiß nicht, ob er wirklich mein Freund war. Vielleicht hätte er mein Freund werden können, wenn nicht dieser wahnwitzige Krieg gewesen wäre, der erst so viele Dörfer und Städte (Mostar zum Beispiel), dann unsere Familien und am Ende uns selbst auseinanderriss. Was ist ein Freund? Ein Freund, denke ich, ist jemand, dessen Leben man kennt und akzeptiert, jedenfalls zu verstehen meint. Der einem mehr bedeutet als die vielen anderen, an deren Anblick und Gerede man sich täglich und oft unfreiwillig reibt. Jemand, auf den man sich unter allen Umständen wortlos verlassen kann, der einen unter keinen Umständen in die Pfanne haut. Mit dem man ein Stück Leben oder zumindest eine wichtige Erfahrung geteilt, eine gemeinsame Gefahr, einen Krieg wie diesen zum Beispiel, durchlebt hat. Oder jemand, mit dem man einfach gerne zusammen ist (und nicht erleichtert ausatmet, wenn er oder sie wieder geht). Mit dem man zusammensitzen kann, ohne viel Tiefsinn zu reden, oder meint, im Gespräch dauernd Männchen machen zu müssen. Wie so oft in Gesellschaft. Vor allem, wenn Frauen dabei sind. Frauen und Freundschaft? Geht das überhaupt? Oder lebt das nur von unausgesprochenen Erinnerungen oder Erwartungen? (Warum diese skeptische Frage, Hardtfeld, gibt es nicht immer wieder gelingende Beispiele, und hast du nicht selber solche dankbar erfahren und erfährst sie noch?) Die Gegenwart eines Freundes ist nie langweilig. Seine Abwesenheit auch nicht. Denn die handelt von der Anwesenheit seiner Geschichte. Wie diese auch. Aber jede Geschichte (vor allem jede Kriegsgeschichte) ist anders, jedenfalls hört und sieht sie jeder anders (und meint daher, sie anders erlebt zu haben).
Am besten, Abedin erzählte sie selbst. Tauchte eines Tages wieder in Milna auf, wenn wir auch da sind, sagte kako si mi, stari moi, wie geht’s dir, Alter? Und finge an zu erzählen. Als ob nichts gewesen wäre. Kann sein, so kommt es noch. Aber sicher bin ich mir nicht mehr. Ich warte schon zu lange. Helfen Sie mir auf der Suche nach Abedin? Wenigstens auf der Suche nach der Erinnerung an ihn. Warum sollten Sie? Aus Neugier, warum denn sonst. Oder haben Sie was Besseres vor, als jetzt diese Geschichte zu lesen? Ich soll sie Ihnen auch noch vorlesen? Also gut, meinetwegen. Machen wir’s uns einfach. Wenn Sie langsam genug lesen, können Sie mich lesend lesen hören. Aber beschweren Sie sich hinterher nicht wegen der verlorenen Zeit. Oder mit der Behauptung, es sei alles ganz anders gewesen. Waren Sie dabei? Ich schon. Bin es immer noch. Und komme davon nie mehr ganz los. Einmal Kriegskind, immer Kriegskind. Ich warne Sie. Wenn Sie weiterlesen, kann es Ihnen ähnlich gehen.
Wo ich Abedin in den verrückten Jahren des Zerfalls (die wir erst hinterher als solche wirklich wahrzunehmen begannen) kennengelernt habe, weiß ich nicht mehr. War’s auf der Werft, wo einer der Kapitäne schon mal einen Hammel spendierte, wenn sein Schiff nach der jährlichen Überholung wieder zu Wasser gelassen wurde? Damals fuhren noch die alten, hölzernen Ein- und Zweimaster – umgebaute Sandschiffe, Fischkutter, alte Lastensegler aus der Zeit vor den großen Fährschiffen – die Touristen und ihre von Sonne und Alkohol geröteten Gesichter und Bäuche zwischen den Inseln und dem Festland hin und her.
Der Hammel, wenn es einen gab, drehte sich lange vor der Marenda über dem Feuer in der Werftecke hinter dem Waschraum am Spieß. Marenda, das war bei den Arbeitern auf der Werft, in der Fischfabrik und allen anderen, die in Wein- und Olivengärten oder kleinen Werkstätten hinterm Haus hämmerten, hackten, sägten oder sich auf andere Weise geräuschvoll zu schaffen machten, die geheiligte Frühstückspause. Bei Gelegenheiten wie dieser, wenn’s um einen Hammel ging, konnte sich diese Pause auch bis in die Mittagshitze hinziehen. Dann war an Arbeiten ohnehin nicht mehr zu denken. Über demselben Feuer hatten sie vorher das Fischfett erhitzt, um die Bohlen des Helgens für den Stapellauf glatt zu schmieren.
An solchen Tagen verwehte der Maestral zwei ganz verschiedene Gerüche zwischen den aufgebockten Schiffsrümpfen. Den Duft knusprig gesalzener Hammelschwarte. Und den Gestank fauligen Fischtrans. Auch für herumstehende Besucher, die sich als Handlanger nützlich gemacht hatten, konnte dabei ein Stück Fleisch, das vom Hackbeil wegsprang, und ein schräg geschnittener Weißbrotkanten abfallen. Dazu ein Zug aus der Rotweinflasche. So lang, bis nöliger Protest sich räusperte.
Oder war’s vor der Fischfabrik, an deren Schornstein nachts das Wort TITO groß und rot glühte, zwischendurch zuckte, nochmal zuckte und weiterglomm? Den roten Stern darüber hatten sie schon vor Jahren abgeklemmt, nachdem mehrere Zacken ausgefallen waren und sie keine passenden Ersatzteile und wohl auch niemanden fanden, der dieses Symbol aus großer Zeit reparieren konnte. Oder wollte. Kurz vor Beginn des Krieges blieben auch die Buchstaben dunkel, und Reste des Neonschriftzugs hingen nach zwei, drei MP-Schüssen aus der Blechfassung. Soll angeblich die Besatzung eines ablegenden Fischkutters gewesen sein. Sollen noch „Živio Druže Tito!“ gebrüllt haben. Es lebe Genosse Tito! Waren betrunken, hieß es.
„Wieso betrunken?“, fragte Matko und drosch mit wenigen wuchtigen Hammerschlägen den knapp zugemessenen Eichenrahmen in die Lukenöffnung eines Sandschiffs, das damals noch Sand fuhr. (Sandschiffe? Die den schwarzen Flusssand aus der Cetina-Mündung vor Omiš hochbaggerten und dabei auch schon mal eine Amphore im Greifarm hatten (und mir zum Kauf anboten), gibt’s schon lange nicht mehr.) „Wieso denn betrunken? Die waren nicht betrunken, jebentiboga. Die wussten, was sie taten, verdammt noch mal. Die wussten das genau.“
„Und was sie riefen“, sagte Miko, der danebenstand und Matko zusah und der ein letztes Mal vergeblich versucht hatte, den Metallrahmen der Leuchtschrift wieder zusammenzuschweißen.
Astiboga, ja, verflucht, das wussten sie auch.
„Und du? Weißt du es auch noch?“ Und dann hatten beide geschwiegen, und jeder sich seinen Teil gedacht.
Die Blechbuchstaben steckten noch einige Zeit schief in den Schornsteinfugen, bis auch sie eines Nachts verschwunden waren. (Warum eigentlich immer nachts? Tagsüber zu demontieren, woran man Jahrzehnte lang geglaubt hatte, das wagte damals noch niemand.) Soweit war es, als ich Abedin das erste Mal in Milna begegnete, noch nicht. Aber es fehlte nicht mehr viel.
Nach einem guten Fang schob die Besatzung den Werftarbeitern schon mal eine Kiste Sardinen, seltener Makrelen (Glück!) oder an Bord filetierte Seezunge (großes Glück!) über die Bordkante. Damals gab es noch reichlich Fisch in der Adria. Die Italiener hatten mit ihren schnellen Kuttern und überdimensionierten Netzen noch nicht alles leergefischt. (Und die Charterbootbesatzungen hatten mit ihren Harpunen und anderen nautischen „Sportausrüstungen“ noch nicht jede Bucht ausgeräumt.) Dann zog vom abschüssigen Platz vor dem Wächterhäuschen, das überm Wasser an der Fabrikmauer klebte und in dem der Wächter saß, der solche Transaktionen verhindern sollte, der angenehm brenzlige Geruch scharf gegrillter Sardinen durch die Hafenbucht. Und man wusste, woher der Wind wehte und wo sie zu holen waren.
Jetzt lagen dort die chrombeschlagenen, gelackten Plastikyachten der Charterbootkapitäne aus Deutschland, Österreich, Italien und von wer weiß woher. Palmenkübel standen in Katamaransalons. Flachbildschirme flimmerten über weißen Kunstledersesseln, auf denen sich Bikinifrauen und deren halbwüchsige Kids räkelten. Und der junge Direktor des Internationalen Adria Yachtclubs hatte, als er noch Direktor der Fischfabrik war, die Fabrik schließen, die Arbeiter entlassen, die Maschinen verkaufen und den Schornstein abreißen lassen. Oder nein, stand er noch? Als Industriedenkmal vergangener Zeiten und vergangener Hoffnungen? Erinnerung an jahrzehntelange, ehrliche Arbeit der Männer und Frauen des alten Fischerdorfs Milna mit dem Brot des Meeres? Jetzt ist der Direktor der Fischfabrik Direktor des Hotels Excelsior International. Und sitzt mit Sonnenbrille hinter dem Lenker eines Land Rover mit getönten Scheiben, der geräuschlos langsam am Verbotsschild vorbei durch die Fußgängerzone von Milna rollt. (Aber vielleicht ist auch das bald Vergangenheit? Und die Vergangenheit, von der ich in dieser Geschichte rede, wieder Zukunft? Eine Zukunft ohne oder nur noch mit wenigen natursuchenden Touristen? Und ohne an Hummerscheren saugende Marinagäste? Aber wovon dann leben ohne Fischfabrik an einem Meer ohne Fische?)
Oder war’s vor dem Ferienheim der Metallarbeiter aus Kikinda? Vor dem langgestreckten, gelben Bau unter den Palmen mitten im Ort traf man sich abends zum Tanz oder zum Wein oder auch nur, um mit Händen, später auch Fäusten in den Taschen herumzustehen und den Tanzenden zuzusehen, wie sie ihren Ringelreigen zu bosnischer, serbischer oder ungarischer Musik tanzten. Hände auf den Schultern des Vordermanns oder der lachenden Vorderfrau (warum lächeln eigentlich alle Frauen beim Tanzen dasselbe glücklich entrückte Lächeln) ging’s in der Kola um die Palmen, um die Tische, über die Riva bis zum gusseisernen, roten Leuchtfeuer auf der Kaimauer und wieder zurück. Manche der Umstehenden, Touristen vor allem, klatschten im Takt. Oder sangen oder tanzten sogar mit, meine Frau zum Beispiel, die keinen Tanz auslassen kann. Andere fanden das albern oder ärgerlich. Was hatten die hier in Milna überhaupt noch zu suchen mit ihren lächerlichen Tänzen? Für die meisten aber war es in Ordnung. Sollte doch jeder tanzen, was er wollte. Und die Musik hören, die er oder sie wollte. Na und? Sind doch unsere Leute. Oder etwa nicht? Seit wann denn nicht mehr?
„Sag doch selbst“, sagte Abedin, als wir wieder einmal am gelben Haus unter den Palmen vorbeikamen, Zeit hatten und stehen blieben, „sag doch selbst, wir sind doch noch ein Land, oder? Oder wollen die uns jetzt einreden, wir seien nie ein Land gewesen? Jugoslawien, das Land der Arbeiterselbstverwaltung, der Blockfreiheit und der Reisefreiheit? Waren wir nicht wer in diesem damaligen sozialistischen Lager und konnten stolz auf uns sein? Sag doch selbst, war es nicht so? Und jetzt? Auf dem Weg zu einem Haufen kleiner, verfeindeter Nachbarländer. Alle gegen alle. Keiner will mehr die Sprache des Nachbarn verstehen. Wo soll das hinführen? Wenn’s gut geht unter das Dach der EU? Hoffen wir’s. Und wer nicht unter dieses Dach will?“
Ich sah ihm zu, wie er mit zwei Fingern eine Marlboro-Packung aus der Hosentasche zog, sie mit dieser für ihn typischen, kurzen Schlenkerbewegung des Handgelenks aufriss, eine Zigarette herausklopfte, mit zugekniffenem Auge anzündete, sich dabei am gusseisernen Leuchtfeuerfuß abstützte, wieder aufrichtete, eine lange Rauchfahne ausatmete, dem Verschwinden des Rauchs nachsah, lächelnd einen neuen Zug nahm, noch länger ausatmete und sich mir wieder zuwandte und sah, wie ich ihm zusah.
„Što je, stari moj? Was ist, Alter?“ Er fragte mich, dabei war er es, der plötzlich nachdenklich und älter geworden schien. Aber sein junges, schiefes Lächeln saß wie immer in der Mundwinkelfalte.
„Na, was ist? Das sind doch auch unsere Leute. Sind wir noch ein Land? Oder schon nicht mehr? Und wer hat mich eigentlich gefragt, was ich will und wofür ich bin?“ Er nahm wieder einen Zug, und wir gingen weiter.
„Vielleicht besser, dass man mich nicht gefragt hat. Wo ich selber nicht mal genau weiß, was ich bin. Bin ich nun Bosnier oder Kroate? Oder beides? Und meine beiden Alten, was ist mit denen? Die eine Hälfte von der Adria, die andere Hälfte von der Neretva, für uns war das nie ein Problem. Bis jetzt.“
Wir blieben stehen. Und tatsächlich war wieder Musik zu hören. Und getanzt wurde auch wieder. Aber nicht mehr auf der Riva, sondern im Haus. Durch die offenen Fenster hörten wir Gelächter und sahen die Bewegungen. Wenn man nicht die Musik gehört und nicht gewusst hätte, dass sie dort tanzen, man hätte diese schnellen, abgehackten Bewegungen der Silhouetten der Tanzenden hinter den Vorhängen auch für die Pantomime einer Schlägerei halten können. Die Musik brach ab in Applaus und Gelächter, und Abedin und ich gingen weiter. Im Weitergehen sah ich, wie er mit dem kleinen Finger von unten die Asche von der Zigarette schnippte. Diese kleinen, ausgefallenen Gesten, das war echt Abedin. Ich mochte das an ihm.
„Sollen sie doch tanzen, was sie wollen. Arbeiten schließlich das ganze Jahr dafür.“ Er nickte und fasste mich am Arm. „Wart’s ab, mein Freund, bald hat unsere selbstverwaltete Arbeiterklasse nicht mehr viel zu lachen, weder hier in Milna noch anderswo.“
Vor der Kirchentreppe unter den Palmen, über denen und um die herum die Mauersegler ihre atemberaubenden Luftkämpfe vorführten, blieb ich stehen und ließ Abedin weitergehen. Unglaublich, wie diese Vögel ihre Höchstgeschwindigkeitsmanöver spielerisch und doch allem Anschein nach auf eine uns bisher unerklärliche Weise koordiniert vollzogen. Dabei auch auf engstem Raum in Mauerwinkeln, unter Dachvorsprüngen, in schmalen Durchgängen offenbar ohne jedes Kollisionsproblem. Abedin kam zurück, und ich wies nach oben.
„Sieh dir das an“, sagte er und sah weiter diesem wahnwitzigen, von schrillen Schreien befeuerten Luftschauspiel zu. „Alles pensionierte Düsenjägerpiloten, oder?“
„Was ist mit den Frauen“, fragte ich, „fliegen die auch in deiner Luftwaffe? Und wer macht das Geschrei?“ Wir lachten und gingen zusammen weiter Richtung Bushaltestelle, denn Abedin wollte noch mit dem letzten Schiff nach Split und von da aus weiter zu seinen Eltern nach Bosnien. Sein Bruder war aus Belgrad zu Besuch mit seiner jungen Frau. Aber ich greife vor. Soweit war es noch nicht.
Es war wohl auf der Werft, wo Abedin und ich uns das erste Mal trafen. Denn ich weiß noch, wie wir an diesem Abend langsam um die lange Hafenbucht zurück in den Ort gingen. Und einander unser Leben erzählten. Einmal oder sogar mehrmals legte er mir – was ich nicht gewohnt war und bei anderen Gesprächspartnern, außer bei jüngeren Frauen, eher als lästig empfinde – während unseres Gesprächs die Hand auf den Arm. Bei ihm mochte ich das. Dann blieben wir steh’n, und er redete leise weiter.
Das gibt es nur hier. Im Norden, in Bremen, wo ich herkomme, konnte man jahrelang denselben Menschen in derselben Straßenbahn vom Parkviertel in Richtung Domsheide, im Theater am Goetheplatz oder beim Sonntagsspaziergang zur Meierei im berühmten Bremer Bürgerpark begegnen. Und „Guten Tag“ oder kurz und freundlich „Tach“, wie sie dort sagen, war der ganze Gesprächsinhalt, begleitet von ebenso kurzem, nicht unfreundlichem Kopfnicken. Mittags sagte man „Mahlzeit“. Auch wenn niemand aß. Allenfalls noch „Wie geht’s?“. Oder Platt „Wie geit?“. Das war’s dann schon.
Abedin und ich ließen uns Zeit an diesem Abend. Es war Mitte August. Die Steine der Kirchentreppe, auf die wir uns schließlich setzten und redend oder schweigend das schaukelnde Zerfließen der Lichter im Hafenbecken beobachteten, waren lange nach Sonnenuntergang noch warm. Die schrillen Schreie der um die Palmenkronen vor der Kirche flitzenden Mauersegler waren verstummt. Und als wir aufhörten zu reden und noch eine Weile schweigend dasaßen, dem Lichtertanz auf schwarzer Wasserhaut zusahen, dann aufstanden, um in der Kantine der Kikindani noch eine Bevanda zu trinken, weil wir vom Reden durstig waren, wussten wir alles voneinander. Wie meine Kinder in der Schule waren. Dass ich die zweite Frau und mit meiner Tochter Probleme hatte, weil sie vor dem Abitur die Schule abbrechen und mit anderen zusammen eine leerstehende Brauerei besetzen wollte. Klassenkampf, hatte sie mir mit Absender „Sozialistische Demokratische Republik Freies Kreuzberg“ geschrieben, natürlich als kleiner provokanter Scherz gedacht, sei wichtiger als spätbürgerliche Schulabschlüsse. Auf die es jetzt wirklich nicht mehr ankomme. Ich fand das nicht witzig.
„Klassenkampf?“, hatte Abedin gefragt und langsam den Kopf gewiegt, dann energisch hin- und hergedreht. „Klassenkampf? Ihr wisst doch gar nicht, was das ist. Ihr in eurem aufgeräumten Deutschland. Wir hier, in unserm Land, das immer noch oder schon wieder im Aufbau und immer im Abbruch oder Aufbruch zu großen Zielen ist und nie ankommt und nie fertig wird, wir wissen das, auch wenn wir nicht immer davon reden. Wir reden lieber von Antifaschismus.
Und? Wisst ihr denn, was das ist? Und seid ihr euch darüber einig?“
Er lachte und zerdrehte eine Kippe unterm Absatz. Damals konnte man über solche Fragen noch lachen. Später, in den letzten Jahren vor dem neuen Krieg und erst recht in diesem Krieg und danach, gab es da nichts mehr zu lachen. Man musste erneut aufpassen, was man sagte, was man fragte, für wen man Partei ergriff. Und ob man einen Kriegsverbrecher weiter einen Kriegsverbrecher nennen oder nicht besser von Untaten schweigen sollte, wenn man nicht sicher war, um welche Seite es ging und auf welcher Seite der Zuhörer stand. Das hat sich auch zwanzig Jahre nach diesem Krieg und nach vielen Urteilen des Internationalen Jugoslawientribunals in Den Haag, in denen schauerliche Details von weinenden Zeugen und ausländischen Exhumierungsexperten ans Licht der Weltöffentlichkeit gebracht wurden, immer noch nicht geändert. Oder doch? Das Risiko ist, zugegeben, mit jugoslawischen Zeiten nicht zu vergleichen. Die Zeiten von Titos Geheimpolizei Udba und deren Mordkommandos in Deutschland sind endgültig vorbei. Der Rechtsstaat hat sich auch auf dem Balkan durchgesetzt. Und doch.
Und doch geht man hier manchmal noch, bildlich gesprochen, auf dünnem Eis, obwohl Adria, obwohl Sommer, das Bild vom dünnen Eis also nicht passt. Es passt irgendwie doch. Sitzen meine Frau und ich beim Makedonier, der eines Tages oder, genauer, eines Nachts mit Kind und Kegel aus Milna verschwunden, später aber ebenso überraschend wieder aufgetaucht war, beim Eis. Sagt meine Frau: „Sag mal, hast du eigentlich was von Abedin gehört?“
Und bevor ich antworten kann, kommt Don Ivica vorbei, der alte Pfarrer, legt mir die Hand auf die Schulter, sagt, er komme von einer Beerdigung. Beerdigung? Was für eine Beerdigung? Denn normalerweise erfährt hier jeder von jeder Beerdigung.
„Kleiner Kreis“, sagt er, „Kinder, Enkel. Die Freunde“, sagt er, „sind ja alle schon tot. Vor ein paar Monaten fand man in einer Höhle bei Dračevica die Knochen von Miro Pavišić.“
„Miro Pavišić“, frag’ ich, „kenn’ ich den?“
„Wohl kaum“, sagt Don Ivica, „der hatte vor dem Krieg, ich meine den Weltkrieg, den Zweiten, und noch kurz danach das Schiff Triton. Fuhr Baumaterial zu den Inseln. Auch für das neue Dach unserer Kirche.“ Er hob kurz den Arm und wies in Richtung Kirche, die man aber von unserem Platz unter dem neuen Bambusriesenschirm über der neuen Eistheke nicht sehen konnte.
„Die Partisanen“, sagt er leise, „haben ihn 1946 aus seinem Haus in Milna geholt. Hier“, und er zeigt auf das Haus mit den drei runden Türbögen, in dem jetzt der Selbstbedienungsladen ist, vor dem wir sitzen und Eis essen (Magnum mit Nusssplittern in Schokoladenhaut), „hier hat er gewohnt. Sein jüngster Sohn hat jetzt den Laden. Miro blieb verschwunden.
Jahrzehnte lang wusste niemand, wo er war und was man ihm vorgeworfen hatte. Vielleicht seine Arbeit für die Kirche? Oder dass er mal königlicher Kadett oder seine Frau aus Serbien war? Jetzt haben sie ihn gefunden. Durch Zufall. Die Höhle sollte für Touristen zugänglich gemacht werden. Einen Haufen reiner, weißer Knochen, auch den Schädelknochen. Mit Einschussloch.“ Don Ivica sieht sich um. Aber niemand hört zu. Am Tisch hinter uns singen ein paar halbnackte, rotgebrannte Touristen, leider singen sie deutsch. Vor der Bar sitzen Stipe und Miko von der Werft, sehen den singenden deutschen Dickbäuchen zu, rühren mit zu kleinen Löffeln in zu großen Händen in zu kleinen Kaffeetassen und sehen schweigend aufs Meer.
„Die Genanalyse aus Zagreb“, sagt Don Ivica, „hat es bestätigt.“ Genanalyse? Der alte Pfarrer von Milna, hatte der tatsächlich eben so ganz nebenbei „Genanalyse“ gesagt und dazu genickt? (Was würde jetzt wohl noch alles hoch und ans Licht kommen?) „Es sind Miros Knochen“, fährt er fort, „heute haben wir ihn begraben, in geweihter Erde, endlich. In einem ganz kleinen Sarg. War ja nicht mehr viel von ihm da. Und waren, wie gesagt, nur paar Leute dabei. Alles Gute“, sagt er lächelnd, nimmt die Hand von meiner Schulter, richtet sich auf und sieht sich nochmal um, sieht lächelnd über die Touristen hinweg, sagt: „Ich muss weiter, s Bogom, mit Gott.“
Abedins Eltern konnten oder wollten lange nicht verstehen, dass er und sein Bruder sich nicht für den Hof interessierten und nicht in ihrem Dorf bleiben wollten. Er war, wie sein Bruder, nach der Schule zu Titos Armee gegangen, die damals noch Jugoslawische Volksarmee hieß, JNA, die größte und modernste Armee im Südosten Europas. Und jedenfalls die machtvollste Institution und der größte Arbeitgeber im ganzen Land. Und eine gute Adresse für junge Leute, egal aus welcher Ecke des Landes sie kamen. Sie hatten ihren langen Wehrdienst freiwillig verlängert, Geld und kostenlose Ausbildung gerne mitgenommen. Danach war sein Bruder zu seiner Freundin nach Belgrad gezogen, und sie hatten dort geheiratet. Abedin hatte als Elektroingenieur erst in Sarajevo gearbeitet und war dann weiter nach Süden an die Neretva gezogen.
„Bosnien“, sagte er, „Bosnien, dachte ich damals, hat das meiste Wasser und die meisten Wasserkraftwerke. Da findest du immer was.“ Und jetzt war er hier. Auf dieser Insel, wo seine Großmutter herkam. Seine letzte Arbeitsstelle – ein kleines Umspannwerk vor Počitelj, wo die Neretva sich grün über weiße Geröllbänke wälzt, bevor sie aufgestaut durch die Fallrohre auf die Turbinen schießt – war eines Nachts in die Luft geflogen. Das heißt, nur Dach und Fenster flogen weg. Einfach so. Im richtigen Augenblick übrigens. Keine Toten und Verletzten. Auch die Turbinen konnten sie später wieder in Gang setzen. „Muss man auch erstmal so präzise hinkriegen.“ Abedin grinste.
Früher hatten sie zu Hause oft davon gesprochen, einmal wieder auf Nonas Insel Urlaub zu machen, in einem der preiswerten Ferienheime. Die teuren Hotels gab es damals noch nicht. Am besten als Ehemalige im großen Sommerheim der Armee, oben hinter den Olivengärten zwischen Milna und Osibova, wo die Schotterstraße zu den Klippen der unbebauten Südküste abzweigte, bevor sie sich in Pinienwäldern verlor. Das Heim und die Gegend kannten Abedin und sein Bruder aus der Armeezeit. Eine weiträumige Anlage mit Sporthalle, Basketball- und Tennisplätzen, Restaurants und Schlafräumen. Und jetzt? Jetzt war es ein desolates Camp. Ein verlassenes Gefangenenlager in einem schlechten amerikanischen Film. Tore aufgebrochen, Zäune zerschnitten oder zusammengerollt und abtransportiert, die Wächter verschwunden, Fenster zerschlagen, Türen ausgehängt oder samt Zarge herausgebrochen. Gelegentlich kam wer mit dem Wagen vorbei, um zu sehen, was sich noch demontieren und wegschleppen ließ. Vor den fensterlosen Baracken standen riesige Container, aus denen sich bedienen konnte, wer wollte. Man war davongekommen. Doch auch das nur auf Zeit.
Denn der Krieg war zwar auf den Inseln zu Ende, doch im Hinterland noch lange nicht. Und in Bosnien fing er erst richtig an.
Abedin hatte sich erstmal abgesetzt. Für Milošević kämpfen? Womöglich noch unter serbischem Kommando? In diesem Krieg gegen die eigenen Leute? Das kam für ihn nicht infrage.
„Ich bin doch nicht verrückt“, sagte er, „mitmachen in einem Krieg aller gegen alle? Ein Krieg gegen uns selber? Oder sind wir alle schon verrückt?“ Und er war vor mir stehen geblieben, hatte sich zu mir umgedreht, mich an der Schulter gefasst und einmal kurz durchgeschüttelt:
„He, sag mal was, du Deutscher. Sind wir alle verrückt geworden, und niemand hat es gemerkt?“
„Du offenbar nicht“, sagte ich und legte ihm die Hand auf den Arm, „du hast es gemerkt, sonst wärst du ja wohl nicht abgehauen. Sondern hättest diesen Unsinn weiter mitgemacht, oder?“
„Nein“, sagte er, „dafür bin ich nicht in die Armee gegangen und habe gelernt, wie man sich verteidigt“, und spuckte den Streichholzrest aus, auf dem er gekaut hatte, „dafür nicht, jebentiboga.“
Aber das war, bevor der Krieg über die Grenze nach Kroatien kam und dann in Bosnien richtig losging. Zwischendurch war Abedin für ein Jahr nach Deutschland gegangen. Ein Vetter arbeitete als Busfahrer in Berlin. Die Stadt hatte ihm gefallen. Da konnte man leben. Nur zu viele Türken waren da für seinen Geschmack. Und seine Verwandten liefen jede Woche in die Moschee. Die Frauen alle mit Kopftuch. Das kannte er von zu Hause in Bosnien nicht (noch nicht).
„Musste dir mal vorstellen“, hatte er gesagt, „in Berlin, und dann alle mit Kopftuch. Was soll das? Das gab es vor dem Krieg bei uns nicht.“ Seine Mutter trug Kopftuch im Winter oder wenn’s regnete oder im Sommer wegen der Sonne. Das war praktisch und nichts weiter.
Aus Berlin hatte er ihr eins mitgebracht. Grün mit roten Rosen. Sie war damit sofort zu ihrer Nachbarin Aimira gelaufen. Aber nur weil es ein Geschenk von Abedin aus Berlin war. Doch nicht, weil es ein Kopftuch war. Früher liefen in seinem Dorf nur die alten Frauen mit Kopftuch herum, die jungen dachten gar nicht daran. Deren Sorge war eher, ob der Rock kurz genug war. Aber neuerdings trugen sie alle Kopftuch. Und kurze Röcke kamen nicht mehr infrage. Allenfalls in Sarajevo. Da gab es noch beides. Kurze Röcke wippten über langen Beinen. Und daneben diese vom Kopftuch abwärts in knöchellange Gewänder übergehende Verhüllung, unter der dann und wann allenfalls eine Fußspitze hervorstach oder ein wenig Bein durchschimmerte.