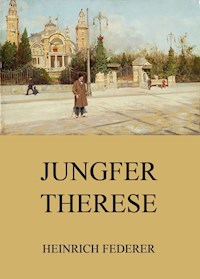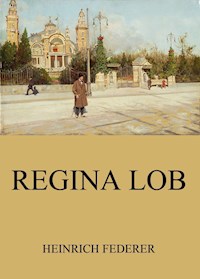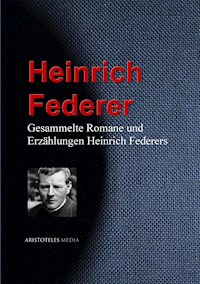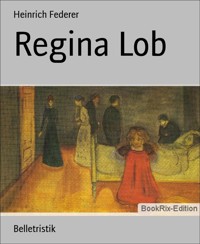0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Lachweiler Geschichten von 1911: Vater und Sohn im Examen, Das Manöver, Unser Nachtwächter Prometheus, Der gestohlene König von Belgien, Der Erzengel Michael
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Lachweiler Geschichten
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenUnser Nachtwächter Prometheus
Kapitel 1
Ich möchte vom Nachtwächter unseres Dorfes erzählen. Er heisst Andreas Marxele, trägt schwarze Hosen, eine geblumte Weste aus Perkal und einen Rock mit zu engen und zu kurzen Ärmeln und mit einem so schmalen Schulterblatt, dass ich immer das Gefühl der Not und Bedrängnis hatte, wenn ich Andreas reden und dazu hantieren sah. Es war dann anzuschauen, als ob er sich aus einem Gefängnis zu befreien suche, aber mit allen sterblichen Anstrengungen weder lösen, noch erleichtern könne. Man dachte, dieser Mann würde Grosses leisten, wenn er nur eine weitere Jacke trüge. Es würde dann die Arme ganz anders ausspannen und es mit dem Leben wie ein Held aufnehmen. Man müsste staunen. So aber hemmt ihn der enge Ärmel am Ellbogen, und sobald er den Nacken strecken und sich gegen die bösen Mächte des Schicksals aufbäumen will, zwängt ihn der schmale Rücken derart ein, dass er sich wieder klein und demütig zusammenduckt.
Wir Studenten nannten ihn daher nur den gefesselten Prometheus. Als uns der Professor an der Lateinschule von diesem wunderbaren Manne der Sage erzählte, der nach dem Glauben der Griechen den Menschen das Feuer vom hellen Olymp auf die schattige Erde herunterholte, damit sie warm und heiter bekämen wie die Götter oben und damit sie nicht mehr im Dunkel sich verlaufen und die Nasen aneinander schlagen müssten, – wie aber dann der besagte Held für seine göttliche Frechheit von Zeus an den Felsen des Kaukasus genagelt wurde und ihm von einem Geier die wachsende Leber immer wieder weggefressen wird: – da rief mein Kamerad aus dem Dorfe, der witzige Jakob Bronn: »Das ist wahrhaftig unser Nachtwächter Andreas Marxele!«
Alles lachte. Wir Lachweiler aber, die den Mann so gut kannten, stimmten, ohne uns weiter zu besinnen, wie von irgend etwas Treffendem in diesem Worte Jakobs unaussprechlich überzeugt, bei: »Ja, das ist der Lachweiler Nachtwächter, Andreas Marxele.«
Erst später erkannten wir, worin der Vergleich so gut war. Abgesehen davon, dass Herr Andreas Marxele in seinen Kleidern wie ein Gefesselter erschien, trug er auch in seinem übrigen Gehaben etwas Prometheushaftes zur Schau. Keiner politisierte im ganze Dorfe so tüchtig, keiner ging so weit aus den alten Geleisen der Überlieferung, keiner begrüsste jede Erweiterung der Volksrechte mit einer so starken, sozusagen wilden Freude, keiner schimpfte gegen den Zaren in Petersburg, den Sultan am Goldenen Horn und gegen die herrenmässigen Reden des deutschen Kaisers so trotzig wie dieser kleine, magere Mann in den zu engen und zu kurzen Ärmeln. Er war der einzige, der im Gasthof zur Krone vor allen Gästen behaupten durfte, die französische Revolution sei alles in allem etwas Gutes gewesen.
»Aber bedenken Sie,« wandte der Schullehrer Philippus Korn ein und schob erregt die Brille zurück, »bedenken Sie den Pöbel von Paris, der den König und die Königin mordete!« – Lehrer Philippus Ignatius Cassian Korn hatte sich eben auf die Weltgeschichte von Jäger abonniert.
»Und bedenken Sie, Herr Magister, diese welschen Könige, die ihr Volk in Luxus und Krieg verdarben.«
»Bedenken Sie dagegen«, wiederholte der Lehrer und schob die Brille wieder vor, »bedenken Sie die Guillotine!«
»Bedenken Sie, Herr Lehrer, die Bastille und die Lettres cachées!« – Der Nachtwächter sagte: lettres kaschesch.
»Und die erschlagenen Grafen, Priester und Damen, bedenken Sie!«
»Und die Millionen armer, geplagter Bauern, den dritten, in den Kot getretenen Stand, bedenken Sie, Herr Lehrer!«
»Ach,« wandte sich Ignatius zu seinem jungen Vetter im Lehrerseminar, der ihn besucht hatte und mit dem er gemeinsam drei Deziliter Landwein trank, »ach, mit solchen Menschen kann man nicht disputieren, – sie kennen keine Pragmatik in der Geschichte.«
»Sie haben keine Seminarbildung,« ergänzte der Kandidat behende.
»Nichts wissen sie von Klio, von Herodot und Thukydides!«
»Es fehlt ihnen das historische Augenmass, sozusagen die Retrospektive in die Vergangenheit,« schloss der Seminarist selbstgefällig. Diese Ausdrücke hatte er von Dr. Mamutius, seinem Professor der Geschichte. Bei passender Gelegenheit brachte er sie gerne wie eine eigene Erfindung über seine achtzehnjährigen Lippen.
Als Andreas von Pragmatik und Thukydides hörte, wurde ihm übel. Er leerte das Glas und ging. Fremdwörter schlugen ihn in die Flucht. Gegen solche Gelehrsamkeit konnte er nicht aufkommen. Dann fühlte er schmerzlicher als je, dass sein Rock zu eng und seine Ärmel zu kurz waren.
Sein Verstand hatte Licht und Schärfe. Aber die Schulung ging ihm ab. Der Pfarrer wollte den geweckten Burschen in die Realschule der Stadt schicken. Aber da kehrte der Vater den Geldbeutel heraus, leer bis zum untersten Zipfel wie er war, und sagte bloss: »Bub, da studier' einmal!«
Und statt der neun Musen hütete Andreas die neun Ziegen des Bauern Chlor. Damals fühlte dieser Prometheus zum erstenmal die Zwangsjacke, und besonders wenn ein Student mit dem Käppi und den Büchern unter dem Arm des Weges kam, wo Andreas weidete, dann drückte das enge Tuch den armen Sehnsüchtigen unleidlich. – Er schob dann die Faust vor den Mund und biss und weinte hinein.
Von nun an machte er den gewöhnlichen Lebensgang eines ordinären Lachweilers durch. Also musste er zuerst dem Bauer Chlor, dem er verdingt war, das magere Vieh auf die Wiese treiben, abends die Geissen melken und die Milch zur Käshütte tragen, ohne einen Tropfen auf seine Bluse oder auf das glänzende Blech des Kessels zu spritzen. Darauf fing er an zu weben. In einem schlecht getäfelten Kellerraum stand sein Webstuhl. Während er in eintönigem, langweiligem Fleiss das Schiffchen durch die straffen Fäden trieb, dachte er mit seiner guten Phantasie und seinem witzigen Kopf weit über den Hut eines gewöhnlichen Dorfbürgers und weit über die Bauerndächer der Heimat hinaus. Hätten seine Gedanken den Einschlag in den Zettel gebildet, welche Schilderungen wären da im Tuche erschienen! Man hätte von den Schneeschultern der Alpen bis in die letzten Furchen des Ozeans hinuntergesehen, an sanften und zornigen Flüssen, an grauen Einöden, an Millionenstädten wäre man vorbeigekommen, Paris und Moskau hätte man erblickt, Kaisern und Zigeunern wäre man begegnet, ja, eine ganze Galerie der Menschheit hätte man in den Faden bekommen und an Humor und Farbe hätte es da wahrlich nicht gefehlt.
Sonntags hockte Andreas über geliehenen Büchern, die er vom Titel bis zum letzten Wort auslas. In einem Jahre hatte er die Bibliothek von Lachweiler ausgeplündert und wie ein Junges, das nun nicht mehr bloss Milch, sondern auch Brocken erträgt, sperrte er den Mund auf und verschlang die Bibliothek des Bezirksfleckens. Als auch dieser Kram verzehrt war, öffnete er den Mund noch weiter und liess sich jetzt Bücher aus der nächsten Stadt kommen. Und er las alles, was und wie es kam. Alles nahm seine Aufmerksamkeit gefangen: der Sternenhimmel, die Afrikareisen, der japanische Krieg, die Sozialisten, der Vatikan, Segantini und Böcklin, die Tuberkeln, – er las Prophezeiungen aus alten Kalendern, Mays prahlerische Reisen, den Robinson, er hörte mit Andacht vom Barte des Barbarossa und von jenem von Mohammed, von den Präraffaeliten, von Darwin, Ibsen, Frau Holle, dem Zukunftsmusiker Strauss, und was das Wunderbarste war, er behielt von allem einen hübschen Haufen im Gedächtnis, den er dann gelegentlich mit echtem Krämertalent auspackte. Eine ungewöhnliche Beredsamkeit und zwei graue, kleine, flinke Augen, die wie Wiesel im Gesichte herumschossen, unterstützten seine Gespräche. Man hörte ihm Sonnabends gerne zu, wenn er am Wirtstisch seine Schätze auszupacken begann. Nur riss ihn oft im Schildern die eigene Begeisterung fort, dass er nicht mehr innehalten konnte, fabelte, sich immer glaubhafter in die unglaublichsten Dinge verlog und mit dem Pfarrer und Gemeindeammann nicht selten in Streit geriet.
Natürlich stand seine Weisheit nicht wie ein festes, auf soliden Steinquadern erbautes Haus, sondern mehr wie ein zusammengewürfelter Haufen von tausend heimischen und fremden Raritäten, über denen seine Phantasie wie ein buntes Wölklein schwebte und sie bald tiefer, bald heller färbte. Andreas hatte kein System, und ausstudierte Leute, die mit Methode vorgingen, wie etwa der Pfarrer, brachten ihn bald aus der Fassung, wenn sich unser Bursche nicht am Ende noch mit einem schlechten Witze behelfen konnte
Einmal kam der Kirchherr gerade dazu, als Andreas in einem Ringe von feiernden Sonntagsleuten das Sternbild der Jungfrau erklärte. Weil es heller Tag war, und somit kein Verrat durch die himmlische Figur zu befürchten war, mischte der Erzähler Gelesenes und Erdachtes frech durcheinander. Da sei nämlich ein eiskaltes Mädchen gewesen, das Hunderten von Knaben das Herz gebrochen, indem es die Armen mit seinem Zauber behexte und den Narren im entscheidenden Momente dann schmählich den Rücken kehrte. Darauf hätten die Mütter der Knaben gen Himmel geseufzt, und, siehe, zur Strafe sei das Jüngferchen mit goldenen Sternennägeln da oben festgeheftet worden. Von den kalten Räumen des Weltalls herab müsse es nun so viele fröhliche Hochzeiten auf Erden mitansehen, während es selber vor Einsamkeit und Liebesmangel fast erfriere und froh wäre, wenn wenigstens der spröde Mond im Vorüberfahren es ein bisschen anlächeln wollte. Aber das tue weder der Viertels- noch der volle Mond, sondern verächtlich fahre er weit daneben vorbei. Wenn sie recht zusehen wollten, die Dörfler, heute abend, meinte Andreas, und schaute listig gegen Westen, wo ein breiter Wolkensaum lagerte und einen bedeckten Nachthimmel ansagte, so würden sie ganz deutlich die Jungfrau erblicken, wie sie mit traurigem und verweintem Gesicht von der Höhe niederschaue.
»Aber, Meister, habt Ihr sie denn selber schon erschaut?« fragte nun der Pfarrer, den roten Daumen nach seiner Gewohnheit zwischen den Hals und Kragen steckend, während er die Männer mit einem heimlichen Lächeln gleichsam aufforderte. »Gebt mir jetzt wohl acht, – wir haben den Fuchs!«
»Ich? – Hochwürden, – ich? – jawohl! – so macht sie!« Andreas spannte die Arme kläglich aus, »und das Haar hat sie dreifach gezopft! Jawohl!«
»Na, na, Meister, dann habt Ihr auch den grossen Bären gesehen, – und das Boot – die Andromeda, den Pegasus ...«
Das waren Fremdwörter! – Marxele fing es an schwindelig zu werden.
»Weiss nicht!« stotterte er und kaute am Stengel der Geraniumblüte, die er immer im Munde trug.
»Die sind doch noch deutlicher auf unserem nördlichen Globus zu sehen!«
»So!« – Marxele zupfte verlegen an seinen zu kurzen Ärmeln. Prometheus fühlte seine Ketten wieder. »Unser Pfarrer!« sagte leise hinter ihm ein Zuhörer zum andern, »alles weiss er, alles!«
»Aber keine Spur von einem Bären,« fuhr der Geistliche fort und wurde im Erklären unwillkürlich aus Angewöhnung ernster, »nichts Boot, nichts Andromeda oder Pegasus! – Die alten Griechen haben sich den Himmel auf dem Papier in kleine Stücke zerschnitten und jedem einen beliebigen Namen gegeben, bald von einem ihrer Helden, bald von einem ihrer gottlosen und verwerflichen ...«
»Aber gestehen Hochwürden nur,« widersprach der Nachtwächter, »die Jungfrau, das steht fest, sitzt da oben!« – Er spuckte die Geraniumblüte im Eifer aus.
»Ihr müsst sie mir erst zeigen, bevor ich es glaube.«
»Gerne, Hochwürden, gerne!«
»Gern oder ungern – Und wenn wir sie nicht finden –« der Pfarrer drohte mit dem Zeigefinger.
»Nun, dann ist sie gottlob erlöst, die arme Seele; sie hat lange genug gelitten – aber ein Strumpfband oder ein langes Haar von ihr wird sich wohl –«
Alles lachte, der Geistliche am lautesten. Diesmal hatte sich Andreas mit Glanz herausgehauen. Nur sein Gesicht blieb trocken. Nie lachte er zu den eigenen Witzen. Eher machte er eine abweisende, strenge Miene dazu.
Aber zufrieden bückte er sich unter den Tisch, nahm das Geraniumblümchen auf und schob es wieder in den linken Mundwinkel.
Kapitel 2
Kurz nach dieser kleinen Begebenheit starb der einzige und nächste Verwandte des Marxele, nämlich sein Vater selber. Er war ein sehr braver Nachtwächter gewesen, das heisst, er hatte die Bürger selten in der Nachtruhe gestört, da er selbst des Nachts gerne schlief, sei es unter einem Baume, auf der Kirchenstiege, neben dem Hundestall der Krone, wo Bary und der Kater sich seinethalben nicht im Stroh rührten, oder sogar auf dem Bänklein des Polizeihäuschens, wo ihm der Landjäger nicht selten um Mitternacht ein Schnäpschen zum Fenster heraus reichte. Alarm hat er zeitlebens nie geschlagen und gewöhnlich erst an der Asche konstatiert, dass hier ein Haus gebrannt hat. Den Nachtgruss sang er, obwohl er nur noch zwei gelbe Zähne im Kiefer trug und kein ordentliches »s« mehr zustande brachte, ungemein lieblich, und ich erinnere mich wohl noch, wie wir drei Geschwister eidlich einander gelobten, den Schlaf im Bette so lange zu verhalten, bis der Nachtwächter sein Lied vor unserem Hause gesungen hätte, um einander morgens damit zu wecken. Seine Weise tönte besonders im Winter so geheimnisvoll von ferne, dass mir darüber die wunderlichsten Gedanken kamen und ich mich im Bett aufsetzte und träumerisch zum Fenster blickte, in das die mondweissen Kirchenmauern, der Schnee auf dem Kronendach und, ich glaube, hundert grünäugige Märchen mit hereinschauten. Ferner hörte ich das Lied des Nachtwächters wieder erklingen, vom untersten Dorfe herauf, endlich erreichten mich nur noch einige hellere Töne, ich wusste nicht mehr recht, sang es aussen oder tief innen in mir, ich sank zurück in die weissen Kissen und schlummerte weiter.
Das war Marxeles Vater, der alte Nachtwächter, gewesen. Gott hab' ihn selig und geb' ihm einen ruhigen Posten, etwa auf einer der hintersten Zinnen der Himmelsburg, die weit ins Unendliche schauen und so recht zum gesicherten Schlafen eingerichtet sind.
Es meldete sich nun Andreas Marxele zum Nachtwächter an. Der Posten ward ihm sogleich zuerkannt. Er hatte schon für seinen Vater das Amt hie und da versehen, das heisst auf dem Bänklein und auf der Kirchenstiege geschlafen. Aber ohne das – und sogar wenn Andreas unbeliebt gewesen wäre, er hätte das Amt doch bekommen. Denn in unserm Dorfe erben sich alle Ämter vom Vater auf den Sohn fort, der Küster, der Ammann, der Weibel, der Armenvogt, die Schulräte, selbst der Vorbeter in der Kirche, mag der Sohn eine noch so dünne Stimme haben, und selbst der Kaminfeger, mag der Erbe noch so engbrüstig sein.
Das neue Amt passte für Andreas indessen wie für keinen zweiten. Sein unruhiger, schwärmerischer, an tausend Geheimnissen herumgrübelnder Geist fand Freude an diesem Herumschweifen durch die von Nacht und Mond erfüllten Gassen. Er schlief während der Nachtwache nicht mehr, ging dafür ziemlich weit zum Dorfe hinaus, spazierte im nahen Wäldchen und freute sich an den Glühwürmchen im Grase oder an dem heimlichen Getue der Nachtfalter in den Büschen. Er wollte wissen, wie der nahe Weiher um Mitternacht aussehe, ob wirklich beim zwölften Stundenschlag aus seiner Mitte Schaumringe sich emporkräuseln und der Dreizack eines Wassergeistes heraus lange, oder ob man gar über den Spiegel gebeugt jene nackten, armen Seelen auf dem tiefen Grunde erschauen könne, die nach der Volkslegende sich in Wein und Schnaps versündigt haben und nun immer Wasser schlucken müssen.
Und vom Hügel aus sehen wollte er, wie das grosse Dorf sich nachts von da oben ausnehme, wenn die Sterne nur ganz kümmerlich wie tief herunter geschraubte Laternchen brennen. Man konnte dann die Gebäude kaum voneinander unterscheiden. Die schwarzen Massen der Dächer verschwammen ineinander, wie die Rücken einer dichtgedrängten Herde von Kühen und Kälbern. Nur den Kirchturm und das breite Dach der Krone, die gewaltige Linde auf dem Friedhof und den kaltblinkenden Spiegel des Weihers mochte man herausfinden.
Schweifte dann der Mond aus einer Wolke hervor, dann fiel es wie Gold über die Dächer, dann blitzten die gotischen Fensterbogen der Kirche mit den Guckscheiben der Bauernhäuser, den glatten, grauen Schindeln und den Weidenblättern am Bache um die Wette. Während die eine Hälfte der Gassen im tiefsten Schatten lag, in einem Schatten, der genau die Formen der Häuser und ihrer vorspringenden Giebel zeigte, – lag die andere Hälfte in goldigem Flimmer da, und man sah jede Katze, die in Minnediensten darüber lief, und die fliegende Zeichnung jeder darüberschwebenden Fledermaus haarklein. Das Wasser im Bächlein hörte man kaum, weil es so tief und leicht zwischen den Gräsern floss. Aber die drei Brunnenröhren klangen um so lauter von den unermüdlichen Wassern, die sich schräg ins steinerne Becken gossen. Wie ein Terzett ungebrochener Stimmen, zweier Mädchen und eines Knaben, scholl es. Je nach der Richtung des Windes hörte man auch das tiefe, leise Rauschen des weit unter dem Dorfe in einer Schlucht dahinziehenden Flusses. Zwischen hinein ertönte ein Glockenschlag, langsam und feierlich, und einmal des Nachts hörte man aus stundenweiter Ferne den Schnellzug durch die Gefilde rasen. Wie ein kurzer, scharfer Trommelwirbel brummt es, und dann merkt man erst recht, wie man hier so ganz ausserhalb der Zeit und gleichsam im Rücken der Welt liegt.
Andreas sann und träumte viel in solchen Nächten. Er sprach mit den Ahnen auf dem Friedhof und mit den Rittern des alten Schlosses, das in seiner zerbröckelten Armut auf einem kleinen Hügel stand. Und da war es, wo seine Seele Kraft und Mut sog, um in eine kleine und verdrehte Zeit grosse Worte zu werfen.
Um drei Uhr ging er heim, Tannennadeln im Haar und Harz an den Ärmeln. Dann schlief er bis acht Uhr, wohl auch bis zwölf, rüstete sich sein Junggesellenmahl und unterhielt sich dann ein Stündchen vom Fenster aus über die Gasse mit den Nachbarn, indem er zweimal den Hundekopf seiner Pfeife ausrauchte. Hernach wurde ein wenig gelesen, wieder gewoben und nach dem Kaffee, den der Nachtwächter sich im Tage dreimal braute, legte er sich von sechs bis neun Uhr wieder aufs Ohr. Gegen zehn Uhr erhob er sich, und ebenso wach und ebenso neugierig ging er auf die alten Posten wie ein Astronom auf seine Sternwarte steigt und diese Nacht sicher einen Planeten erster oder doch mindestens zweiter Grösse zu entdecken hofft.
Was Meister Andreas die Woche über entdeckt hatte, das wurde das Dorf am Sonntag gewahr. Dann sprudelte er eine Unmenge von Sagen und Märchen aus und erzählte von den alten Schlossherren so genaue Geschichten, als ob er ihre Tagebücher gelesen hätte. Er malte den Leuten die Farben der Mondnacht, das Leben des Nachtgeflügels, die Geräusche der Mitternacht und die gespensterhafte Stimmung des schlafenden Dorfes so aufgeregt vor, dass man nur hören und immer nur hören mochte und den Wächter um sein Amt oder um die Phantasie beneidete, die so viel aus diesem Amte zu machen wusste.
Besonders aber, wenn das Volk zur Gemeindetagung gerufen wurde, erkannte ein jeder, der nicht mit ewiger Blindheit geschlagen war, was man an Meister Andreas für einen wohlbedachten, im ernsten und einsamen Studium der Nacht gereiften Volksmann habe. Er allein wagte aus dem Ringe des stumpfen und so geduldigen Volkes heraus den Herren Oberhäuptern die Meinung zu sagen. Wenn der Ammann einen Vorschlag einbrachte, so nickte ein Ratsherr nach dem andern: »Stimme zum Antrag!« – »Unterstützt!« – »Einverstanden!« – Ein gewöhnlicher Dörfler durfte da nichts einwenden und senkte den Kopf, wenn es vom Präsidentenstuhl her hiess: »Die geehrten Bürger sind überhaupt angefragt!« – Teils hielt sich der gemeine Mann für zu dumm oder ihn ängstigte die angeborene Scheu; teils fürchtete er, nicht die nötigen Worte und die richtigen Sätze zu finden. So brachte der Kirchenpräsident die Steuern vor, die Stuhlordnung, die Renovation der Kirche und den Bau eines neuen Ofens beim Kaplan, der immer friere – in Wirklichkeit war es nicht der Kaplan, sondern seine Köchin, die auf einen neuen Ofen drang, weil das Wärmerohr des alten schief laufe, so dass alle ihre sonst vorzüglichen Kuchen auf der einen Seite zu fett, auf der andern zu mager gediehen! – und peitschte jeden Antrag beim willigen oder widerwilligen, aber immer gehorsamen Volke durch. Und so diktierte der Ammann das Kopfgeld, die Fronarbeiten am Schulhause, verhinderte den Ankauf einer neuen Spritze und leitete die neue Strasse gerade an seinen Äckern vorbei, wobei er die Wegmauer seinem Vetter zuhielt, der ein Pfuscher im Maurerfache war. Einige Bürger, die gerne widerstanden hätten, fingerten in der Hose am Sacktuch, an der Dose, an den Hausschlüsseln herum und klemmten sich wohl gar ins Bein, wenn die Steuer zu hoch bemessen und die öffentlichen Arbeiten zu gevattermässig verteilt wurden. Aber das war auch ihre ganze Heldentat. Erst am Abend in der Krone schlug man die Faust auf den Tisch und stülpte mutig das Glas um.
Nicht so Andreas Marxele. Er besass den Mut des Widerstandes, diese göttliche Gabe der Volksfreiheit. Mit dem Zeigefinger rieb er sich nur ein wenig die grauen Äuglein, wie um klarer zu sehen, und begann dann mit den Worten: »Herr Präsident, Herren Genossen!« – alles zu sagen, was ihm nicht gefiel. Er sagte es mit einer dunkeln, glatten, gleichsam geölten Stimme. Aber sehr deutlich hörte sich seine Rede an, und Wort folgte auf Wort mit der Regelmässigkeit des Tick–Tack an der Uhr.
Begann zum Beispiel bei den Wahlen die Komödie der Abdankungen, dann durfte das hohe Ratskollegium auf ein gründliches Spottverslein rechnen. Ja, einmal, als der Ammann wieder üblicherweise erklärte, er könne unmöglich das Amt wieder übernehmen, er sei zu alt, seine Gaben unzureichend, er wünsche einen bessern Nachfolger und danke – hier wurde seine Stimme weinerlich – für das fünfzigjährige Zutrauen seines lieben, ihm stets ans Herz gewachsenen Dorfes – als er dies gesagt und sich in der allersichersten Erwartung niedergesetzt hatte, nun erst recht einhellig wiedergewählt zu werden, – da war Andreas unverfroren genug, die Sache ernst zu nehmen und den Finger emporzustrecken.
Kapitel 3
»Herr Nachtwächter Andreas Marxele hat das Wort.« –
Der Gerufene zog die Geraniumblüte aus dem Mund, kreuzte die Arme über die Brust und begann: »Herr Präsident, Herren Genossen! – Der Herr Gemeindeammann hat erklärt, er könne die Verwaltung des Dorfes nicht mehr übernehmen. Und ich begreife den verdienten Mann. Er ist achtzigjährig –«
»Zweiundachtzig!« warf eine Stimme ein.
»Sogar zweiundachtzig! – Einem solchen Alter gehört schon lange ein ehrenvoller Feierabend!« –
»Otium cum dignitate!« – fügte der Pfarrer bei, der gerne Lateinisch sprach und ebenso gerne den Gemeindeammann weggewählt hätte wie Andreas.
»Opium cum dignitate, – sagt der Pfarrer, – kann sein! Aber zur Sache! – Wie man zu jung, so kann man auch zu alt für eine öffentliche Stellung sein. Ehre dem Manne, der das einsieht und aus freien Stücken resigniert! –
Ein Mann ein Wort! – Der Ammann hat bestimmt erklärt, eine Wiederwahl nicht mehr anzunehmen. Sollen wir ihn nun dennoch wählen? – Hiesse das nicht soviel, als sagten wir: Herr Ammann, gesagt haben Sie das wohl, aber wir glauben es nicht, im Gegenteil, wir wissen, dass Sie recht gerne wieder Ammann werden mögen. – Sie haben nur Spass mit uns getrieben! Also wir wählen Sie wieder und Sie werden vergessen, was Sie vorhin sagten und mit einigem Zögern und Sträuben die Wahl doch wieder annehmen!
Nein, eines solchen Narrenstückes ist unser greiser Ammann nicht fähig. Wenn er sagt: ich kann nicht mehr, so kann er eben nicht mehr.
Wir sind freie Bürger!« – Ohne diesen Satz hielt Andreas keine Rede – »Bei uns gibt es so viele Könige als Köpfe. Es wäre doch eine Schande, hätten wir kein Holz mehr für einen neuen Ammann, tannenes oder buchenes, – das buchene freilich ist besser!
Da hat zum Beispiel der Kronenwirt einen Vetter, der studiert hat und bei ihm auf dem Gasthof wohnt. Er kennt die Leute und ihre Verhältnisse, ist er doch barfuss mit uns über die Gassen gelaufen und hat mit uns Äpfel aus dem Garten des Kaplans gestohlen, als der geistliche Herr im Bade war. – Er wohnt mitten im Dorfe, und jeder kann ihn also leicht finden und auch noch einen guten Schoppen bei Gelegenheit trinken. Er ist reich, also braucht er keine Sporteln; er schreibt eine schöne Schrift, also kann man in Zukunft alle Amtsbriefe lesen; er hat einen guten, strammen Charakter, also wird er den Sünder zwar am Schopf nehmen, aber nicht so fest schütteln, dass er alle Haare verliert. Kurz und gut, ich schlage den Herrn Fürsprech August Bronn zur Krone vor.«
Andreas setzte sich in den Kirchenstuhl und schob das Geranium wieder zwischen die Lippen.
Diese Rede wurde am 2. Mai 1889 gehalten und schlug so durch, wie jene Rede des grossen Mirabeau genau hundert Jahre früher, am 2. September 1789. Das Datum allein ist verschieden, das Genie gleich. Bronn, der sechsundzwanzigjährige Bronn, der eben seine juristischen Studien vollendet hatte und beim Onkel auf eine Anstellung in der Stadt wartete, Bronn wurde gewählt mit sechshundert gegen zwanzig Stimmen und einer Enthaltung, die vermutlich vom Pfarrer herrührte. Denn Bronn las Tolstoi und riet den jungen Studenten schon Goethe zu lesen.
In Zukunft gab es keine Abdankungskomödie mehr. Mit dem Mut der Verzweiflung hielt selbst der alte Glöckner noch das Turmseil, der halbblinde Weibel das Bürgerverzeichnis und der gichtische Küster seine Kirchenschlüssel fest. An jeder Kirchgemeinde hatte er sie aus der Tasche genommen, mit Pathos geschüttelt und gerufen: »Ich danke dem, der sie mir abnimmt.« – Doch immer war er bestätigt worden, weil niemand das Gotteshaus am Bettag so nett ziere, keiner so fleissig die Bänke abstaube und die Kerzen so rasch anzünden würde. Nun aber verliess er sich nicht mehr auf diese Vorzüge, der weggewählte Ammann war für alle ein warnendes Beispiel.
An jenem Siegestage glaubte Andreas, dass seine Ärmel sich geweitet und das Schulterblatt sich verbreitert hätte. Er war glücklicher als Prometheus. Das Licht der Volksfreiheit hatte er vom Altar des Vaterlandes geholt und unter seine Mitbürger geworfen. Zum erstenmal hatte er die Knechtschaft der Überlieferung gebrochen. Und Zeus strafte ihn nicht!
Oder?
Ja, als der Zauber seiner witzigen Beredsamkeit in den Ohren verrauscht war, standen die alten Männer zusammen und sagten, dem Ammann sei unrecht geschehen. Einundfünfzig Jahre habe er in guter und böser Stunde die Zügel geführt. Drei französische Könige, der Kirchenstaat und mehrere Fürstentümer seien inzwischen untergegangen, die türkische Flotte sei zerstört, der Zar gebeugt und Paris erobert worden, und Lachweiler stehe noch in unversehrter, solider Dorfmajestät. Das sei des Ammann Markus Verdienst. Zum wenigsten hätte man ihm die Ehre antun und ihn nochmals wählen sollen. Ein junger Ammann sei ein Unglück. Die Bronn vorab hätten immer ein stürmisches Blut gehabt. Man solle nur den übermütigen jungen Studenten anschauen, – wie der unter seinesgleichen den König spiele. Unfehlbar werde es sich rächen, dass man aus den ehrwürdigen Fusstapfen der alten Bräuche getreten sei. –
Der reiche Ammann hatte viele Vettern im Dorfe, manche, die ihm wegen geliehenen Geldes oder wegen Anstellung auf seinen Gütern verpflichtet waren. So wurde der Anhang der Unzufriedenen immer grösser. Man besuchte die Krone seltener, und jede Verordnung des neuen, etwas schneidigen Ammanns wurde unter Tisch und Schemel heruntergetadelt. Als es gar hiess, er wolle eine Hundesteuer einführen, da wuchs der Groll ins Gefährliche und wer weiss, wie schwer der bequeme Dorffrieden gestört worden wäre, wenn Dr. Bronn sich nicht vom klugen Kronenwirt hätte bestimmen lassen, schon vor der Herbstgemeinde sein Amt niederzulegen, um einen höheren Posten im Bezirksamt zu übernehmen. Alles atmete auf und lobte den Jüngling, der infolge seines Talentes und seiner Stellung vom Bezirksstädtchen aus Lachweiler weit stärker beeinflusste als er es je in Lachweiler selbst vermocht hätte.
Als nun der alte Ammann wieder in alle Ehren seines Amtes eingesetzt wurde und dafür der Dorfschaft vier Fässchen Bier aus der Krone spendierte, nebst einem Würstchen und einer Semmel für die Stimmfähigen, da fühlte Andreas plötzlich wieder die engen Ärmel und das schmale Schulterblatt; er ass aber das Würstchen doch und trank vier Gläser Bier. Am Ende der Schmauserei winkte ihm der Ammann und fragte ihn, ob er wohl einige Nachmittage frei machen könnte. Es wären einige Bücher einzubinden. Andreas hatte sich nämlich diese schöne und saubere Kunst schon in den Knabenjahren angeeignet, um so eher zu Lektüre zu kommen. Der Nachtwächter ging also zum Ammannhause hinunter, nicht ohne Herzklopfen. Aber Herr Markus spielte mit keiner Silbe auf das Frühere an, sondern war umgänglich und freundlich mit ihm und zeigte Neugier, wie man eine dicke Broschüre so genau Blatt auf Blatt in einen Deckel bringen könne. Je gnädiger der Ammann sich erwies, desto geschmeidiger und gefügiger wurde Andreas. Sein politisches Gewissen empörte sich gegen diese Umwandlung, aber umsonst, und als der Ammann seinem Buchbinder am Ende der Dingtage gar ein blitzblankes Goldstück in die Hand drückte, da hätte Andreas im ersten Augenblick die zitternde Greisenhand gerne geküsst. Er beugte sich und verneigte sich, denn Gold hatte er noch nicht oft in den Händen gehabt. Wer Gold austeilte, kam ihm gross und überlegen vor. Aber zu Hause schleuderte er das runde Stück grimmig unter den Tisch und verfluchte seine Schwäche, die sich so leicht habe bestechen lassen. Erst vierzehn Tage später, als er keinen Heller mehr im Beutel trug und ernsthaft hungerte, bückte er sich unter den Tisch und suchte nach dem Golde. Wenn man sich aber tief bückt, so spannen uns die Kleider an Nacken und Rücken. Nun denke man sich erst, wie enge es dem guten Nachtwächter damals in seiner Zwangsjacke zumute sein musste!
Von da an vertiefte sich Andreas, von der Dorfpolitik angeekelt, in die Politik der Grosstaaten. Er ging gleichsam wie ein enttäuschter Minister des Innern in das Departement des Äussern über. Da war nun kein Land zu gross, dass er es nicht mit seinem staatsmännischen Blick überschaut, kein Fürst zu hoch, dass er nicht seine Handlungen unter das Brillenglas genommen und kritisiert hätte. Er redete von einer Sauordnung in Österreich, von einem Zierbengelschneid im deutschen Militär und spottete bei jeder Ausgabe für schweizerische Festungen. Unsere militärischen Anstrengungen, witzelte er, seien mit einem Kinde zu vergleichen, das immer auf der Zehenspitze stehe, wenn es mit einem Manne rede. – Dass er bei jedem Streit der Arbeiter gegen die Herren auf das feiste Kapital schimpfte, wunderte niemanden, – das taten ja auch die meisten Dorfgenossen. Aber dass er im Burenkrieg für die Engländer eintrat, war erstaunlich. Man wagte jedoch nicht, mit ihm zu rechten. Denn er allein wusste mehr zu seinen Gunsten, als alle Gegner zusammen zu ihrem Vorteil anzuführen.
»Meister Andreas,« fragte ich, damals ein Student von unklarem Sinne und grosser, aber schnell verflackernder Begeisterung, »warum haltet Ihr es mit den Engländern?«
»Ich bin für die Gleichheit aller Menschen, also auch für die Gleichheit der Völker,« erwiderte er. »Verstehst du das, Junge?«
»Ich verstehe, aber ...«
»Aber nun sind die Buren so ein Völklein gewesen, bei dem die grösste Ungleichheit nistete. Die wenigen Bürger regierten eigenmächtig über die vielen Ansässigen. Die Fremden waren fast rechtlos, die Neger unterjocht. Weg muss das Vorrecht! – und die Buren sollen Gott danken, dass die Engländer und die nicht die Russen oder die Franzosen gekommen sind, um ihnen den altfränkischen Zopf abzuschneiden. Die hätten mit dem Zopfe wohl auch noch ein Stück vom Kopfe mitgerissen. Die Engländer auch, natürlich! – aber dennoch sind sie die freiesten Kolonisten.«
Damals bat ich den Nachtwächter, mich einmal auf die Nachtrunde mitzunehmen. Ich trug das Anliegen schon lange auf dem Herzen.
Andreas brummte.
»Darf ich, Vetter?« – Ich hatte die Gewohnheit, jedem Vetter zu sagen, von dem ich etwas Gutes erwartete.
»So geh um fünf Uhr zu Bette und weck' mich um halb zehn!«
»Soll geschehen,« jubelte ich.
Begreiflich ging ich nicht schlafen und stand schon gegen neun Uhr vor dem niedrigen Stübchen des Nachtwächters, das zu ebener Erde lag.
»Teufelskerl, kann Er nicht warten?« grölte Andreas und räkelte die Arme und dehnte sich im Bette, dass die Laden krachten.
»Na, da du einmal da bist, so mach wenigstens Licht!«
Gehorsam zündete ich die Lampe an.
»Jetzt nimm das Schnupftuch und schütte mir den Kaffee an! – dort! – ach was – im Ofenrohr, im Ofenrohr!«
Ich wickelte lieber mein Nastuch als das rote, verschnupfte des Nachtwächters um die Hand und zog den heissen Krug, in dem das Wasser mit feinen Kinderstimmen Süm! Süm! machte, aus dem Bratofen. Während sich Andreas die Hosen anzog und mit Mühe die geblumte Weste zuknöpfte, goss ich die siedende Brühe in den Kaffeesack, der über der Kanne hing. Gleich flogen jene Wölklein von Kaffeeduft durch das Stübchen, die so belebend und ermutigend auf die Seele wirken und das Heim erst recht zum Heim machen, indem sie ihm einen kräftigen Geruch von Gemütlichkeit und Herzensstärke verleihen. Zwei Tassen, die eine ohne Henkel, die andere mit zerbissenem Rande, standen bereit. Ich füllte beide und zerstiess den Zucker darin, damit der Nachtwächter nicht glaube, dass ich seine Not mit dem engen Frack bemerke. So mochte wohl der alte Prometheus gestöhnt haben, als Kratos und Bia mit des widerwilligen Hephaistos Hilfe ihm die Ketten und eisernen Ringe umlegten, wie jetzt Andreas Marxele ächzte, bis er sich in die engen Armstösse und unter das Joch der schmalen Schultern gezwängt hatte. Als die Pein aber so gross wurde, dass ich ihm glaubte beistehen zu müssen, sagte ich mitleidig:
»Euer Rock ist wohl zu eng, Meister!«
»Gerade wie ich ihn brauche!« versetzte Marxele keuchend.
Stillschweigend tranken wir, am Tischchen stehend, unsere Tassen aus. Dann setzten wir die Mützen auf und traten in die geheimnisvolle Nacht hinaus.
Kapitel 4
Es war Ende Februar. Kein Schnee lag mehr auf der Erde. Ein leichter, feuchter, fast warmer Wind ging. Am Himmel regte sich alles in grosser Unordnung. Zahlreiche, niedrige, ziemlich heitere Wolken fuhren von Süden nach Norden, die kleinern schneller, die grössern langsamer, so eine über die andere hinaus, sich gegenseitig beschattend, stossend und hemmend. Dazwischen schauten grosse Stücke eines nachtblauen, aber doch hellen Himmels herunter. Im Spiele der Wolken vergrösserten und verengerten sie sich wieder. Bald waren sie wie mächtige Fenster, bald wie unzählbare Ritzen einer verhängten Pforte, bald drohten sie gar im Geschiebe der nachdrängenden Wolken zu ersticken. Bleiche, kleine Sterne schimmerten daraus hervor. Aber ihr Licht erschien so unruhig und so dem Verlöschen nahe, als spürten auch sie wie das Blendlaternchen des Nachtwächters den Wind und müssten im Luftzug hin und herschwanken. Im Westen unter einer unauflöslichen Wolkenschicht wanderte der Mond dahin. Man sah nichts von ihm als die grosse Helligkeit, die er unter seiner Decke über die höheren Wolken in der Mitte des Himmels ergoss. Durch die Nacht ging jene Luft, in der schon die Erwartung von taufend sehnenden Lenzgeschöpfchen, ja schon etwas vom herben Geruch der Schneeglöcklein und von der Milde der Veilchen atmet.
Im ganzen Jahr weiss ich keine Zeit, die ich mehr liebe, als diese letzten Wochen des Hornung ohne Schnee, mit winderfülltem, wolkigem Himmel, bleichen Wäldern und dem Schein der Leblosigkeit auf dem Felde. Denn unter der Decke tastet doch schon heimlich ein tausendfingriges Leben und jener süsse Duft, der um die Wiege des unschuldigen Säuglings schwebt, steigt leise, leise aus der brachen Scholle. Die groben Sinne der Alltagmenschen dringen nicht in den Zauber solcher Tage. Aber für feine Nerven sind es Zeiten eines auserlesenen Genusses.
Schon ruhte das ganze Dorf. Nirgends ein Ton. Nur aus der Kammer des Kaplans hörte man das Perpendikel einer schnarrenden Uhr hin und her ächzen. Der engbrüstige Mann musste nachts einen Flügel des Fensters offen halten. Durch die schwitzenden und mit Draht vergitterten Fenster der Kirche blinzelte die ewige Lampe und auch aus dem Studierstübchen des Pfarrers lächelte noch ein Licht. Aber dieses Lächeln hatte etwas Strenges und Ernstes an sich. Ich musste an die Lampe des feilenden Cicero oder des philosophierenden Plato denken. Hinter den erhellten Vorhängen ging regelmässig ein Schatten auf und ab.
»Er studiert die Predigt,« erklärte Andreas und sein blinzelndes Auge fügte verständlich hinzu: »Mein Gott, ich hätte nicht nötig, so herumzustürmen, um einen zeitgemässen Sermon zu halten. Es predigt sich doch so leicht!«
Jetzt bewegte sich der Schatten eiliger, er huschte eigentlich an den wehenden Gardinen vorbei, er flog. Plato schien einer entschlüpften Idee nachzurennen. »Ah, nun geht es dem Ende zu!« lachte mein Begleiter.
»Wieso?« fragte ich erstaunt.
»Bei ruhigen Darstellungen,« erzählte Andreas, »spaziert der Pfarrer gleichmässig um den runden Tisch herum; kommen Einwürfe, so steht er still. Hat er aber den Teufel glücklich zuschanden gemacht, dann schwenkt er sein Kirchenfähnlein im Triumphe und rennt die letzten feindlichen Barrikaden um.«
Wir mussten beide lachen. Aber es war keine unehrerbietige Heiterkeit. Denn der Pfarrer galt uns als ein guter Prediger, der das sonntägliche Gemüt meisterlich zu fassen und zu erbauen wusste.
Wir gingen dem Gitter des Friedhofs entlang. Die dürren Stauden auf den Gräbern raschelten, manchmal klingelte auch ein schlecht gehängtes Metallschild am Kreuz. Sonst war es da wirklich totenstill. Zuweilen glitzerte etwas durch die Dunkelheit, sei es ein Messingknopf oder eine vergoldete Inschrift oder ein Blechkranz, der um die Kreuzarme gewunden war. Die Gräber schienen mir ausserordentlich schmal und in die Länge gereckt und mir war, ich sähe ihnen deutlich die Figur der darunter ruhenden ebenso schmalen und ausgereckten Leiber an.
Ich weiss nicht, warum mir in diesem Augenblicke immer wieder die Erschaffung Adams einfiel. So einen länglichen viereckigen Erdteig, wie diese schmalen Häufchen da, mochte der Erschaffer genommen und daraus den ersten Menschen geformt haben. Dann hauchte er die Figur mit seinem unsterblichen Odem an, und sie öffnete staunend das Auge, erhob sich, beugte sich tief vor dem Erzeuger und sprach: »Ich danke dir, Herr meines Lebens!«
Und jetzt liegen sie wieder da, diese Adams, mit der Erde in einen Haufen vermischt – gänzlich verstaubt!
Viele sind noch frisch unter dem Boden, dachte ich weiter. Ihre Leiber sind noch weiss, ihr Blut ist kaum erkaltet. Sie haben sicher noch einen Satz, den sie nicht ausreden konnten, auf den Lippen, – einen Schritt, den sie noch gerade tun wollten, gleichsam in den Sohlen. Und nun müssen sie hier, unfertig wie sie sind, vermodern! – Andere schleppten sich sozusagen selber müde zum Grabe. Das Alter hatte sie bereits so ausgemergelt, ihren Leib so braun, verwittert, erdenhaft gemacht, dass sie sich eigentlich nur noch in die Schollen zu legen hatten, um als ein Stück von ihnen zu gelten.
Viele lagen da, die ich wohl gekannt hatte. Ich erinnerte mich jetzt wieder an sie alle, nachdem ich ihrer jahrelang nie mehr gedacht hatte. Dort unter dem grossen, dicken Stein schlief die Jungfer Manette, die aus ihren unerschöpflichen Taschen zuerst ein braun gestreiftes Schnupftuch, dann eine grosse Dose mit dem Bilde der Helvetia, dann sieben Schlüssel zu sieben kleinen, reinen, duftigen Jungfrauenkammern und endlich zu guter Letzt immer etwas Süsses hervorklaubte, Pfefferminzplätzchen oder Malzzucker oder Schokolade. Gott schenke ihr dafür Milch und Honig des ewigen Kanaan! Etwas zurück, mehr in die Ecke gedrückt, ruht der alte Orgeltreter Kilian, der so treulich den Blasebalg versah, aber regelmässig unter der Einleitung der Predigt einschlief und dann zur unfrommen Freude der Chorknaben behaglich schnarchte. Möge er jetzt zu Sankt Cäciliens Füssen kauern und Musik ohne Mühe geniessen! – Besonders aber rührte mich das Wacholderbäumchen an der Mauer. Hier begrub man meinen Schulkameraden Valentin, der uns alle an Glanz der roten Backen und an Übermut übertraf und immer, wo uns eine Gefährde lauerte, hochsinnig sagte: »Ich gehe euch voran!« – und dann mutig vorausstapfte. Und einmal, da sass der Tod zuoberst auf dem Kirschenbaum in Kronenwirt Bronns Veilchenwiese und höhnte: »Gehst du auch hier voran?« – »Warum nicht?« – machte Valentin und warf keck die volle Oberlippe auf. Sprach's und fiel vom Wipfel und lag wie ein Schneemann unter den roten Kirschen.
Und weil er schon wie ein tüchtiger Mann sich gebärdet hatte, so ward ihm die seltene Ehre zuteil, mitten unter den Männergräbern seine weichen Knabenknöchlein zur Ruhe zu legen.
Die Kindergräber sind weiter hinten, man sieht sich von der Strasse aus nicht, sonst würde ich die Grüsse meiner lieben zwei Schwestern aus der Überwelt hören. Aber zwei Reihen von der Strasse weg sehe ich dafür das teuerste Grab, meiner Mutter irdische Ruhestatt.
Bei seinem Anblick fühle ich immer Herzklopfen und ich vernehme eine leise Frauenstimme: »Walter, – wie geht es ohne mich? – Hast du Ordnung?« – Dann verschwimmen mir die Augen und ich drücke die Rechte, wo's am ärgsten klopft, und sage: »Es geht, – Mutter, es geht, wie es ohne dich –«
»Was hast du, Junge?« – fragt mich der Nachtwächter.
»Nichts, gar nichts,« sage ich schluckend und würgend.
»Herr, gib ihnen die ewige Ruhe!« fuhr er fort und zog die Mütze.
»Und das ewige Licht leuchte ihnen,« versetzte ich im Tone des alten Kirchengebetes und entblösste gleichfalls das Haupt.
»Lass sie ruhen im Frieden!«
»Amen,« beschloss ich.
Mir wurde sehr feierlich zumute.
»Man sollte eigentlich für die Lebenden um Ruhe bitten,« sagte Andreas. Er flüsterte nur. Ich nickte. »Die haben Ruhe!« fügte er leise bei und liess die grauen Äuglein über die vielen Hügel, Kreuze und Steinmale fahren.
»Wie sie schlafen!« lispelte er weiter, – »stiller als Kinder! – man soll die nicht mehr stören!« – Unwillkürlich gingen wir jetzt auf den Zehenspitzen, so geräuschlos als möglich.
In diesem Augenblicke meinte ich, aus dem Gottesacker tiefe, stille, regelmässige Atemzüge zu hören und einen Odem von solchem Frieden zu spüren, dass mir alles Grauen vor dem nächtlichen Friedhof verging. Er kam mir, je länger ich zusah, immer freundlicher vor, wie ein grosser Schlafsaal, wo von Bett zu Bett alles die Härte des Tages ausschläft und an der Türe und auf den Fenstersimsen schweigsame Geister wachen und den Frieden der Stätte wahren.
Aus diesem Bilde weckte mich das hässliche Kreischen eines Uhrschlüssels. Wir befanden uns vor dem Ammannhause, wo eine Kontrolluhr angebracht war, die um elf und drei Uhr aufgezogen werden musste. Das mächtige Haus lag im Schatten der umliegenden Gebäude. Eine schneeweisse Katze strich gerade um seine Ecke. Die Läden standen offen und leise klirrte im Windhauch ein Scheibenflügel auf und zu. Die Fenster lagen so niedrig, dass man leicht in die Stube gesehen hätte, wenn es nicht zu dunkel gewesen wäre. Die nur angelehnte Haustüre, die gleich in die Küche führt, klapperte leise. Der kinderlose Ammann begab sich regelmässig um neun Uhr mit seiner greisen Frau und dem Hausgesinde zur Ruhe. Da wurde nichts verschlossen oder zugeriegelt. Herr Markus Ebescher pflegte zu sagen: »Wenn ich nicht mehr bei offenen Fenstern und Türen schlafen kann, so will ich nicht mehr Ammann sein.« – Er war ein riesengrosser, bolzgerader Mann, ein ehrfurchtheischender Patriarch, und er wusste wohl, dass kein Dieb und kein Nachtbubenstück sich an ihn heranwagen werde.
Nun eilten wir zum Dorfe hinaus und stiegen allmählich durch einen Wiesenweg dem Hügel zu. Aus einem Stall drang das Schnaufen einer Kuh, die unruhig den Kopf an der Holzwand rieb und mit den Füssen am Boden scharrte. Beim letzten Haus, am Fusse des Funkenbühls, zwinkerte ein Licht aus der niedrigen Kammer in den Feldweg hinaus. Auch hier stand das Fenster offen. Meister Andreas näherte sich dem Gesimse und wollte etwas hinaufrufen.
»Seid Ihr es, Nachtwächter?« kam ihm von innen eine schwache, aber deutliche Stimme zuvor. Man hörte Flüstern und das Geräusch einer laubgefüllten Bettdecke.
»Jawohl, Frau Katharina, – und was machen wir heute?«
»Danke, Vetter, der Nachfrage! – Ich spüre den Wind in allen Gliedern.«
»Wer wacht Euch die Nacht?« spann Andreas fort.
»Kronenwirts Agnes.«
Bei diesem Namen wurde mir warm. Dieses Mädchen war es, mit dem mich früher immer die Schulbuben geneckt hatten und jetzt das eigene Herz. Es glich so ganz den Mägdlein, um die im Gedicht der Volkslieder Müllersburschen, Wachtsoldaten oder treue Knappen minnen, deren Ring sie tragen und deren Untreue sie nicht überleben würden.
»Wackeres Mägdlein,« hatte inzwischen Andreas in die Stube geantwortet.
Ich hätte ihm dafür um den Hals fallen mögen. »Ein wackeres Mägdlein!« – Also auch er, der Hagestolz, auch die seit Jahren sieche Katharina Frommel wussten das, nicht ich allein.
Das Flüstern in der Kammer wurde wieder hörbar. Was sprachen sie wohl miteinander?
»Vetter Andreas,« bat ich leise, »fragt doch, ob sie gut pflegt!«
»Aber kochen wird sie nicht können!« rief der Nachtwächter hinein.
Drinnen kicherte jemand.
»Freilich kann sie kochen, – den Kaffee und den Haberschleim – jawohl, das kann sie.«
»Ob sie's besser kann, als die Berta Walomer?« gab ich dem Nachtwächter neuerdings ein.
»Aber die andere, – wie heisst sie nur?« rief Andreas hinauf.
»Lachmanns Therese?«
»Nein, nicht die!«
»Die Berta, das Walomerkind?«
»Ja! – die wird's noch besser machen!«
Wieder kicherte es drinnen unbeschreiblich nett.
»Was Ihr denkt – Weit besser kocht die Agnes!« – rief die Kranke vom Lager, »noch nie ist ihr die Milch übergelaufen. – Du dummes Ding ...« redete sie leiser, offenbar zu Agnes, »so lass doch! – Was wahr ist, darf man vor allen Leuten sagen.«
Ich war selig. Ja, ja, die Agnes! – Ihr gleich nichts Sterbliches. Sonne und Mond finden keine solche mehr.
»Könnte sie nicht ans Fenster kommen?« fragte ich leise den Marxele.
»Jetzt ist's genug! – Bist du denn rein verrückt?« Spöttisch und doch liebreich sah er mich an. »Du Naseweis!«
»Mit wem redet Ihr, Meister Andreas?« fragte die Frau nun aus dem Kämmerchen hervor. »Ist jemand bei Euch?«
»Lehrers Walter ist mitgekommen, – will mal die Nacht ausspionieren, das Bürschchen.«
»Grüss' dich Gott, Walter!« erscholl jetzt die gebrechliche Stimme Katharinas; – »Was doch den Studenten nicht alles in den Kopf kommt! – Du meine Güte! – Ist doch ein Volk das! –«
»Grüss' Euch Gott, Frau Katharina!« rief ich kaum hörbar.
»Wer schlafen kann, soll schlafen, Walter!« machte die Alte, »das ist mein Zuspruch.«
»Meiner auch,« bestätigte Andreas.
Mir aber war wohl. Agnes schlief also auch nicht. Wie köstlich, dass wir beide die gleiche Nacht durchwachten und gar, dass wir es beide voneinander wussten!
– Natürlich, die alten Leute, die glauben, das Gescheiteste sei Schlafen! Sie können uns nie früh genug ins Bett jagen. Aber wir Jungen glauben ihnen nicht. Wir wissen, kein Mensch ist so dumm, als wenn er schläft. Er denkt nichts, er weiss nichts, er kann nicht reden, oder wenn er's tut, so ist's ein Mischmasch von Unverstand. O nein, gescheiter ist zu wachen, zu wachen an der Studierlampe und in alten herrlichen Büchern zu lesen; zu wachen auf dem Turme und in den hellen Wandel der Sterne zu rucken; zu wachen am Fenster, wenn der Mond und die Poesie und die Sehnsucht und die Liebe und hundert andere ungreifbare Wesen daran vorbeigehen; zu wachen bei Kranken, zu wachen über ganze Dörfer wie ein König; zu wachen und dreist in nächtliche Stürme hinauszuspringen. Beim Donner, redet mir nicht mehr vom Schlafen!