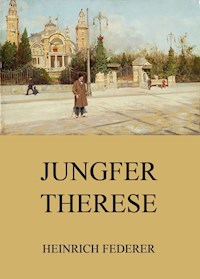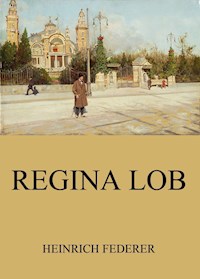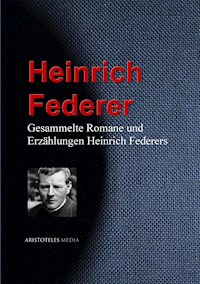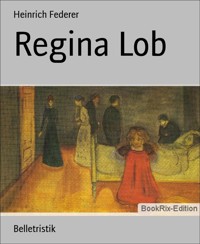
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Heinrich Federers Roman um einen Arzt, der sich selber überwinden muss und am Ende erkennt, dass er die Frau liebt, die er mit seinem Hass verfolgt hat. Es ist kein Arztroman, auch wenn man ihn mit Genuss lesen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Regina Lob
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenZum Eingang
Dich deckt nun schon lange eine warme heimatliche Scholle, alter Freund, und doch hast du alle überlebt, von denen an späten Abenden am Küchenfeuer deine bärtige Lippe erzählt hat. In deinem großen Hause war das der gemütlichste Platz. Saure Trauben und süße Pflaumen wuchsen fast zu den Gesimsen herein, vom Garten schwatzte die Brunnenröhre durchs Dunkel herauf wie ein Klatschbäschen, das einfach nicht schlafen will, und dahinter hörte man das Geflüster einer großen Wiese. Aber wenn die taube Haushälterin im Gange herumschlürfte und etwa eine Stube offen ließ, schollen von der Vorderseite gegen die Straße und ihre Häuser späte Schuhe, Nachtbubenpfiffe, Pferdegetrappel und fernes Musizieren. Wir kauerten uns dann noch behaglicher in die verräucherte Ecke und leerten und füllten die Tasse Tee oder das Glas schwärzlichen Tessinerwein. Und ich legte die Hand auf dein Knie und bat: Fahre weiter von dir und deiner Regine!
Du saßest im Halbdunkel, und so seh' ich dich heute noch, wo ich versuche, dein Erzähltes, soweit du mir erlaubt hast, wieder zu erzählen.
Und als so ein halbdunkler Mensch bist du selbst mir immer vorgekommen, und auch deine Bekenntnisse sind in ein solches Gemisch von Licht und Schatten getaucht, daß ich wohl ein Spaßen und Jubeln, aber dahinter auch eine See von schwerem Blut rauschen hörte. Ich versuche wohl umsonst, dieses Halbdunkel in Ton und Satz wiederzugeben. Aber das kann ich vielleicht, schlicht und warm sein, wie dein Wort es war.
Viele Jahre liegen die Blätter schon geschrieben. Immer zauderte ich mit dem Buche. Muß es nicht als zu jung, zu naiv, zu grün erscheinen, da ich es als schwärmerischer Jüngling auffing? Heute könnte ich jedenfalls nicht mehr so jung schreiben. Aber tönt das nicht eher wie Tadel als wie Lob?
Oder ist es am Ende eine zu alte Geschichte? Wie einer in sich und den allernächsten Menschen irrt und wiederfindet, o ja, das ist alt wie Adam. Aber schließlich bleiben wir doch, so neu wir uns auch geberden mögen, in eben jenem alten Adam stecken. Er ist doch immer auch der neueste Mensch.
Nein, ich gehe doch mit dem Buch zu einigen gläubigen Lesern hinaus. Lobt mich jemand, so steck ich es gerne ein. Gibt es Prügel, so nehme ich sie als Buße und werde nie mehr versuchen, aus anderem Munde etwas nachzusprechen und – ach, zu verderben.
Ich hatte eine kleine, aber schwere Reise angetreten, wovon mein sechsjähriges Kind und Mutterwaislein Mimeli mit seinen flinken Schwalbenaugen freilich nicht mehr sah, als was so ein junges Ding bei seinem ersten Fliegen sieht: maßlose Neuigkeiten zwischen Himmel und Erde. Nur seine Augen arbeiteten ohne Ruh. Das liebe Figürchen selbst mit seinem wachsweißen Gesicht stand unbeweglich wie ein Kerzenstock am Fenster. Aber diese Augen waren die heftigen Flämmchen daran und funkelten und glitzerten gewaltig in die große Landschaft hinaus. Zu fragen und andere Leute ungeduldig in seinen Genuß zu zwingen, wie die meisten Kinder pflegen, lag nicht in seiner Art, sondern von daheim her an vieles Alleinsein gewöhnt, fand sich Mimeli bei all seiner grünen Unwissenheit doch immer tapfer mit fremden Dingen ab und hatte rasch und ohne Vermittlung eine drollige Freundschaft mit ihnen geschlossen.
Mir, mit einer so großen Verwirrung im Kopf und einer solchen Zwiespältigkeit im Herzen, tat diese kleine aufrechte Selbständigkeit am Fenster jetzt ausnehmend wohl. Schau nur recht ins blitzende Hin und Her der Geleise, dachte ich, jetzt in die Halbwelt der Vorstadt, wo die breitesten Straßen plötzlich an einer Wiese aufhören, wie Menschen, die ein Herzschlag trifft – nun kommt ein Tunnel mit seinen Lichtern – zähl' sie, das ist lustig! Nun das Land mit weiten, bleichen Feldern, den fern an den tiefen, grauen Horizont hinausgelagerten müden Dörfern. Und übersieh keinen der schläfrigen Bäche, die aus dem Ried hervorkriechen, und keine der Krähen, die auf den Telegraphenstangen wie alte Philosophen sitzen und wie alle richtigen Denker vor dem Gelärm der Menschen Reißaus nehmen! Ja, Kind, nimm das alles still und tüchtig auf und lege es dir zurecht! Und frag' mich nichts; ich habe genug mit mir selber zu tun!
Ich tupfte nervös den Takt irgendeiner zerfahrenen Musik auf die Lehne. Sowie ich nur leise meine Gedanken um das Vorhaben und Ziel der Reise ordnen wollte, schlug mein Puls heftiger und benebelte mich eine heillose, düstere Bangigkeit. Ich sah dann plötzlich ein Gefunkel von vielen kleinen Fensterscheiben an einem vornehmen Haus über dem stolzen Bergdorf Ilgis. Ich fühlte voraus, wie ich mich da hineinschliche, an der Stube klopfte und wie eine tiefe Altstimme »Herein« riefe. Sogleich stände ich vor einer hohen, dunkelprächtigen Frau. Sie würde überrascht und gehässig einige Schritte zurückweichen und, wie ich ihr in die Stube folge, sähe mich nun auch ein riesengroßer, aber totenbleicher Mann auf dem Sofa, Gott, mit was für Augen an . . . Von jetzt in vier Stunden wird das so geschehen!
Weg, weg! Das kommt alles früh genug!
Es saßen wenige Leute im kleinen, bequemen Nichtraucherwagen. Waren es mehr Frauen oder Herren? Was trugen sie für Gesichter? Schweizerische oder fremde? Und was las man für Geschichten davon ab? wilde oder zahme? Ach, dieses sonst so unerschöpfliche Eisenbahnkapitel, das mir sonst die längste und einsamste Strecke so prächtig kürzt, versuchte ich umsonst anzuspinnen! In alles Sinnen mischte sich sogleich das Antlitz jener Frau, die ich vor vielen Jahren so schwer beleidigt hatte und zu der ich nun wie ein redlicher, aber furchtsamer Büßer pilgerte, um Versöhnung zu holen.
Die Fahrt ist so still, das Gespräch im Wagen so leise und das Geräusch der auf und niedergehenden Kurbeln so tödlich gleichmäßig, daß man entweder einschlafen oder von der Vergangenheit träumen muß, was ja halbwegs auch ein Schlafen ist. Und da kommt sie schon wieder, die laute, scharfe Schönheit jenes Weibes, meiner Feindin von Anbeginn . . .
1
Ihr Gemahl, Theodor Weggisser, war mein dauerhafter, unzertrennlicher Freund durch alle Jugend gewesen. Neun Jahre hatte ich ihn nicht mehr gesehen. Im letzten Weinmonat, zu einer Zeit, wo man in seinem hochgelegenen Alpendorf nie recht weiß, ob man den Ofen einheizen soll oder nicht, hatte er sich in seiner bald heißen, bald eiskalten Schreibstube erkältet, und der Riese, der dem Doktor noch nie einen Batzen zu verdienen gegeben hatte, fiel in eine so strenge Brustfellentzündung, daß seit vier Monaten kein Mensch so oft über die Schwelle ging wie Doktor Bersolt, der alte Ilgisser Arzt. Theodor erholte sich zweimal und erlitt zweimal einen Rückfall. Nun ging der Mann in einem langsamen Verbröckeln seiner prachtvollen Manneskraft durch die kurzen, schneehellen Tage des Hornung dem Tode entgegen. Und während man an seinem Sofa spaßte und alle Schelmereien des Dorfes erzählte, flüsterte man draußen vor der Stube, wie man wohl – in drei Wochen oder in drei Tagen? – mit dem Sarge die engen Stiegen hinuntergelange. Von der bösen Krankheit wußte ich lange schon. Aber daß es so hurtig zum Sterben gehe, erst seit gestern. Der Ilgisser Fabrikant Eisen war mit seinem jungen, schlanken Bengel in die Stadt gekommen. Ich sollte dem guten alten Bekannten eine Privatschule ausfindig machen, wo man seinem Schlingel – der Vater war aufs Haar so ein Flegel gewesen – den Übermut austreiben würde. Und wenn es ein bißchen ginge, sollte ich dem Jungen bei mir Quartier geben . . . Nebenbei gesagt: Theodor sei am Verscheiden . . .
Dieses Nebenbei erschütterte mich. Denn Theodor Weggisser war nicht etwa nur irgendein Bankgenosse durch die lange Marter der Schule, sondern, was tiefer ins Blut geht, der vertrauteste Gespan im heißen, herrlichen zweiten Jahrdutzend meines Lebens gewesen. Welch eine Zeit war das von amo-amas-amat bis zum letzten Examen im Wichs meines schwarzen, langen Schnurrbarts und meines noch längern und schwärzern Staatsfracks!
Theodor war ein baumlanger Mensch mit einem schlanken Hals und einem schönen, runden, krausen Römerkopf darauf. Seine Augen blickten ungewöhnlich groß und blau in die Welt, sein Gelock blitzte in ungewöhnlicher Blondheit, und ich habe Zeit meines Lebens nie eine so gesunde, sonnenverbrannte Stirne, so hellrote Backen und einen so frischen, lauten, lachenden Mund gesehen. Alles federte und schimmerte und spaßte an diesem Jüngling vor Lebensübermut. Er dürstete und hungerte immer und konnte sich beim Fechten oder Reiten oder Tanzen mit hübschen Töchtern nie genug tun. Wir nannten ihn Baldur, weil er völlig unserer Vorstellung vom germanischen Lichtgott entsprach. Im Streit brauste er auf wie eine Rakete; aber ebenso rasch war sein Zorn verpufft. So bildete er den kecken, losen Mittelpunkt der Studentenschaft. Bei allen Streichen stand er an der Spitze, fühlte sich nur wohl, wenn er jemand zum Necken und Plagen um sich hatte, und um so seliger, je frecher sich der Schabernack abspielte. Dennoch war ihm nicht einmal der Geneckte länger als ein Stündlein böse. Selbst die Professoren überwanden seine Flegeleien, wenn er ihnen den ganzen blauen Himmel seiner Augen ins Gesicht lachte. Freilich, er selbst vergaß sein Braves und Schlimmes am schnellsten, war nie tief erschüttert und in nichts beharrlich als im Schlucken und Vertrinken der Jugend.
Nur mit mir, dem stillen, verschwiegenen und unendlich anhänglichen Menschen, hatte er eine zähe Freundschaft geschlossen. Sie begann schon im zwölften Jahr, wo er aus seiner stolzen Bergheimat in die Stadt hinunterstieg und über der Straße bei Verwandten untergebracht wurde. Gleich fanden wir uns, und es gab keinen noch so frühen Morgen und keinen noch so späten Abend, daß wir einander nicht herüber, hinüber das erste oder letzte Wort gaben. Er aß bei mir zu Tische wohl so oft als drüben in seiner Philisterei. Zum Entgelt brachte ich die Ferien mit ihm in Ilgis zu und fühlte mich nach und nach in dem rassigen Dorf wie in einer großen Familie daheim. Ich, der Vater und Mutter früh verloren und nie einen Bruder besessen hatte, liebte den Freund wahrhaft wie alle drei zusammen. Und doch waren wir so verschieden als möglich. Wohl freute auch mich das Lustigsein; aber ich konnte es nicht gut äußern und schon gar nicht erzeugen. Das Ernste paßte mir besser. Beide schwärmten wir für die Natur. Aber während ich viel deutlicher die Noten einer leisen Schwermütigkeit heraushörte, gleichsam ihr Andante und Adagio, fing Theodor vor allem die Zweiunddreißigstel des Scherzo und Allegretto auf. Die Operette, die er neben der Zigarette und den Mädchen die dritte Seligkeit der Erde nannte, war mir zuwider. Umgekehrt langweilte er sich in den klassischen Dramen. Aber während mein Freund blieb, wie er einmal war, launig oder steckköpfig und kein Tüpfelchen von seiner Art preisgab, bewunderte ich im Gegenteil gerade das, was mir fehlte und was an ihm wie Purpur leuchtete, über alle Maßen und war unglücklich, daß ich es nicht nachahmen konnte. Ich vergötterte ihn wegen seines goldenen Übermuts des Lebens. Mit meinen ewigen Katarrhen und Rheumatismen sah ich zu seiner unverwüstlichen Kraft empor, wie eine Zwergkiefer zu einer Eiche emporstaunt. Ich verzog ihn und machte ihn noch eigenwilliger und launischer, als er ohnehin war. Nichts konnte ich ihm abschlagen, wenn er mich mit seinen feuerblauen Augen so schmeichlerisch anguckte, mit beiden Händen bis zur Diele hob und in seinem prachtvollen Baß sagte: »Tu's mir zulieb!«
Welch rasche Bummeltage habe ich bei seinem Übermut, welch lange Nächte bei seinem häufigen, stürmischen, aber untiefen Liebeskummer zugebracht! Aber da ereilte ihn früher als alle Gespanen die große Leidenschaft und kettete ihn unrettbar wie Simson fest. Nun ward es ernsthafter. Wohl zehnmal in der Stunde zündete ich ihm eine neue Zigarette an und sagte bei jeder: »Baldur, vergiß diese hübsche und dumme Regina Lob! Denk, es kam, es ging, wie dieses blaue Räuchlein da!« Sogleich preßte Theodor unwillig seine vollen Lippen zusammen und verschluckte eine große giftige Tabakwolke.
Aber halb von seinem Befehlen, halb von seinem Bitten überwunden, habe ich dann doch wieder wahre Wertherbriefe in Reginas bronzebraune Hände gespielt, obwohl ich dabei über ihn und über die schöne Hexe und am meisten über meine Feigheit fluchte. Ja, ich setzte ihm sogar nicht wenige auf, da er ein ungelenker Schreiber war. »Zum letzten Mal!« knurrte ich immer bei der Endzeile. »Bis ich es wieder wünsche!« spottete der Freund frohmütig und umschlang mich und erdrückte mich fast an seiner Bärenbrust. Und ich ging und dichtete ein neues Gedicht, das zehnte oder elfte, auf den Götterjüngling. Das dauerte zwei Jahre, bis die Stunde kam, wo auch ich einen wertvollern, herzbezwingendern Götzen fand – oder soll ich sagen Göttin? – zu deren Füßen man hinsinkt und sein irdisch Gebetlein verrichtet, jung und blöd, wie man ist. Wer wirft einen Stein auf mich, der sonst nichts Liebes als ein Schwesterchen besaß und als frühes Waisenbübel von einem kühlen Vormund zum andern geschoben wurde?
Ich hatte sein geliebtes Mädchen lange vor Theodor gekannt. War doch diese Regina Lob im gleichen Dorf Lauwis, drei Stunden von der Stadt, schön wie eine dunkle Rose, aber scharf wie eine Brennessel aufgewachsen. Und ich hatte mir schon als Erstkläßler an ihr die Finger verbrannt.
Sie war das einzige, reiche Kind einer gescheiten, stolzen Witwe, die wie ein Mannsvolk rauchte und kegelte. Diese Frau hatte einen sehr dummen, aber sehr reichen Jüngling Fritz Lob geheiratet. Der gebärdete sich schon ledig oft wie ein Verrückter. Nun, unter dem heißen Regiment dieses Weibes wurde er vollends verstört und siechte zur Zeit, da Regina und ich in die Schule gehen mußten, in wortloser, wunschloser, stierer Gleichgültigkeit in einem Irrenhaus von einem Jahr ins andere, leiblich immer fetter und rosiger, geistig immer mehr einer Leiche ähnlich. Regina hat diesen Vater nie gesehen, und niemand wußte, wann er starb.
Fünf Jahre besuchte ich mit meiner gleichaltrigen Schwester Pauline die Lauwisserschule, bis unser siebenter oder achter Vormund in die Stadt zog und uns mitnahm.
Regina saß eine Bank vor mir und schrieb entweder ihren Nachbarinnen die Aufgaben ab oder stach die vordern kleinen Mädchen mit Stecknadeln, wovon sie die Litzen ihrer englischen Jacke vollbesteckt hatte. Sie war über alle Mädchen hinaus groß und biegsam und stark, mit wahrem Zigeunerhaar und der bronzenen Gesichtsfarbe dieser wilden Fremdlinge. Die Lippen waren so schmal, daß man sie kaum sah, aber, wenn das Mädchen sprach, von einer messerscharfen, langen und geraden Zeichnung. Ihre Wimpern und Brauen glänzten wie schwarze Ölfarbe, und ein langer schwärzlicher Flaum überzog auch wie ein Schleier ihre tiefbraunen Backen. Sie machte auf mich gleich von Anfang den Eindruck einer schönen, dunkelfarbigen Katze, schien genau so falsch und hatte genau solche lichtgelbe, glänzende, aber haltlose Augen. Das zitterte und blinkte und schwamm in wechselnden Feuern in den langen Pupillen und war in einer Minute kalt, in der andern heiß. Mit ihrer Krallenschärfe erschreckte sie, mit ihrer Pfotenweichheit entzückte sie ihre Gespanen. Sie schwatzte alles durcheinander, widersprach sich, foppte und log und fachte Streit an, wo sie nur konnte, und vergaß sogleich, was sie Übles angerichtet hatte . . . Dies alles war meinem langsamen, nachdenklichen, im geraden Tramp dahinziehenden Wesen mächtig zuwider. Als Regina nun gar anfing, mich wegen meiner zögernden und umständlichen Art zu hänseln, und einmal, bei einem Spiel, mich den Schneckenkönig taufte, begann ich, das Mädchen geradewegs zu hassen.
Regina faßte flink auf, aber mehr äußerlich und behielt nichts. Wäre sie nicht so schön und reich und frech gewesen, man hätte sie eine Gans gescholten. Sie schnatterte ja auch so. Nichts war ihr lieber als Gerüchte auszustreuen und das zu vergrößern und bunt anzustreichen, was an sich eine unscheinbare, ganz harmlose Sache gewesen wäre. Einen kleinen Fehler von uns konnte sie so in die Länge und Breite ziehen, daß er wie ein Verbrechen aussah. Widersprach man, so streckte sie einem ihre grellrote, spitze Zunge entgegen.
»Sag' mal, Zigeunerin, wie weit vermagst du deine Zunge zu werfen? Drei Meter – vier Meter?« giftelte ich einst nach einer solchen Schlangengeste.
Da zischte und fauchte sie und schrie: »Komm und miß!«
»Gut!« versetzte ich und fing an, in Armspannen auf sie zuzugehen. »Ein – zwei – drei – vier Meter!«
»Näher, näher!« lockte sie zitternd vor Wut. »Aber paß auf! Sieh da!« Sie bleckte ihre langen spitzen Zähne.
Und ich: »Keine Sorge! Mit dieser Faust habe ich gestern schon einer Katze den Schädel eingeschlagen!«
Darauf schleuderte sie mir ihr schönes, weißes Nastuch ins Gesicht, da sie gerade nichts andres zur Hand hatte. Ich faßte es vorsichtig an einem Zipfel, als ob der Fetzen ansteckend oder giftig wäre, und warf es ins Brunnenbecken. Hernach kriegte ich vom Lehrer eine Ohrfeige und mußte zur Strafe zehnmal ins Heft schreiben: »Was du nicht willst, daß man dir tu', das füg' auch keinem andern zu!« Regina leuchtete vor Schadenfreude wie ein Mond.
Von nun an herrschte Krieg zwischen uns, ein boshafter Kleinkrieg mit Hinterhalten und versteckten Manövern, selten auch einmal mit einem wirklichen Gefecht. Aber einmal kam es doch zur offenen Feldschlacht. Denn Regina log dem Lehrer vor, Barbara Netter neben ihr habe mein schönes, altertümliches Tintengeschirr über ihre Bücher ausgeleert. Sie blitzte dazu auf ihre bekannte einschüchternde Art das kleine zaghafte Babettli an. Da rief ich laut über alle Bänke hinaus: »Das ist nicht wahr, Herr Lehrer! Die Zig– die Regina hat mein Fäßlein verschüttet. Ich habe es selber gesehen. Und da hat sie einen Zehnräppler in der Hand, schauen Sie schnell, Herr Lehrer, und will ihn dem Babeli geben, daß es ihr helfe!« stammelte und bebte ich vor Aufregung.
Alle gafften Regina an, die mit ihren glatten braunen Händen das Haar an den Schläfen strich und sie dann in die Höhe streckte und rief: »Seht da, wie er lügt! Nichts hab' ich in der Hand, unschuldig bin ich.«
Aber ich überschrie sie gewaltig: »Da, achtet, achtet, rollt der Batzen unter der Bank! Dort, bei Ottos Füßen ist er, da, da! Sie hat ihn fallen lassen!«
Das entschied. Regina mußte eine halbe Stunde lang vor der Tafel am Pranger stehen und zwanzigmal schreiben: »Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht!« Ich leuchtete vor Schadenfreude wie eine Sonne.
Von jetzt an waren wir gleich Wespen aufeinander. Wir plagten und schadeten eins dem andern mit der unvergleichlichen Grausamkeit des Schulalters. Bot sich keine Gelegenheit zu irgendeinem Schaden, so strich ich drei- viermal mit unsäglicher Verachtung an Regina vorbei. Sie aber zeigte mir ebenso oft ihre spitze grelle Zunge. Damit konnte sie mich nicht ärgern. Daß sie jedoch dann immer meine Schwester Pauline an sich zog, mit ihr Arm in Arm durch den Schulplatz wandelte, leise redete und laut lachte und etwa nach mir zurücksah und ich doch auf keine Art herausbekam, was sie verhandelt hatten, das erboste mich fürchterlich.
Einmal spielten wir an einer Fastnachtfeier »Amazonen«. Die Mädchen suchten das Königreich der Buben quer zu durchrennen. Wem es gelang, das durfte einen Knaben als Gefangenen bezeichnen und in das Amazonenreich führen, wo er drei Schritte von der Grenze an einen Pfahl gebunden ward. Nun galt es, diesen Armen zu erlösen. Wunderbar schön und wild wogte jedesmal die Schlacht um so einen Posten auf und nieder. Denn die Amazonen standen wie eine Mauer davor und fochten so hitzig gegen uns, daß wir oft kaum bis zum Gespan vordringen konnten. Ja, irgendeine schlaue und flinke Jungfer jagte wohl zwischendrein durch unser fast ganz von Truppen entblößtes Gebiet und machte sogleich den gefährlichsten Angreifer auch noch zum Gefangenen. Das gleiche Manöver wurde natürlich auch von den Buben gegen die Mädchen geübt. Da geschah es nun einmal, daß meine Schwester erhascht und mit bübischer Härte an unsern Pfahl festgeknotet wurde. Wohl mit zehn Schnüren. Sogleich schoß eine wilde Flut von Röcken in unser Reich, um Pauline zu befreien. Wir wehrten sie ab. Nur Reginen konnten die Jungens nicht von meiner Schwester losmachen. Mit einem Arm umklammerte sie den Pfahl und klob mit den zähen braunen Fingern ihrer freien rechten Hand Knoten um Knoten auf. Da gelang es mir, diese Hand zu packen und auf den Rücken zu drehen. Nun biß sich das Mädchen mit den Zähnen in die Schnüre und kerbte und nagte daran wie ein Raubtier. Es war zum Lachen. Doch plötzlich stand Pauline frei da. Regina packte sie an der Hand, spuckte mir einen kleinen blutigen Zahn vor die Füße und sprang mit der befreiten Amazone in ihr Reich zurück. Fassungslos sah ich ihr nach . . .
So war Regina Lob!
In der fünften Klasse siedelten wir Geschwister mit dem Onkel Vormund in die Stadt über, und das Dorf und sein früher Weiberkrieg gingen im Tosen des neuen Lebens fast unter.
Es verflossen wohl zehn Jahre, bis ich Regina von meinem Studentenplatz im Parterre bei einer Medea-Aufführung zum erstenmal wiedersah. Sie saß mit ihrem ältern Vetter in einer Seitenloge des ersten Ranges und verfolgte das Spiel mit heftigem Interesse. Ich erkannte sie sogleich. Sie hatte sich nicht verändert. Aus der jungen war eine ausgewachsene große Katze geworden, noch etwas dunkler, noch etwas unsteter, das Auge noch etwas länger und gelber, das ganze Gehaben noch etwas frecher. So wenigstens dünkte mich. Ihren Vetter, den Bankier Binger, kalt wie sein Geld und dürr wie seine Schecks, kannte ich recht gut. Er verkehrte geschäftlich viel mit meinem Onkel. In den Pausen der großen Tragödie las er das Börsenblatt; während der Szene schlief er oder rechnete zum Zeitvertreib wildfremde Münzen in Franken um.
Kaum sah ich Regina, so lohte der alte Haß in mir auf. Kam sie nun auch noch in die Stadt, um zu kratzen und zu beißen? Es verdroß mich schwer, daß sie gerade dieses Grillparzerstück traf, wo der Mann so niederträchtig klein, aber das Weib so ungeheuer groß dasteht.
Theodor saß neben mir, aber äugte gewohnheitsmäßig viel mehr nach den Logen als zur Bühne. Er hatte mich auf das Fräulein aufmerksam gemacht, das da oben in einer so scharfen, fast frechen Grazie thronte. Unsere einheimischen Schönheiten kannte dieser Mädchenheld auswendig. Da gab es nun eine unbekannte. »Wenn sie nur mehr Lippe hätte!« seufzte er mutwillig. Aber dann richtete er das Glas doch wieder auf die jüngferliche Neuigkeit und tat wie vernarrt. Ich war wütend, aber stellte mich, als kennte ich das Fräulein nicht. Etwas Schweres und Banges in mir sagte jedoch: »Gib acht, da fängt etwas an, das dir Unlust bereiten kann!«
Schon am nächsten Tag erfuhr ich von meinem Onkel, daß Reginas Mutter gestorben und die Tochter den großen Besitz im Dorf verkauft und sich in der Stadt beim Vetter Bankier niedergelassen habe. Und jene innere Stimme raunte: »Siehst du, es geht vorwärts, es kommt! Gib doch ja acht!«
Es ist nicht zu glauben, was für listige und ausgesuchte Sorge ich verwandte, um eine Begegnung Reginens mit mir und noch viel mehr mit Theodor zu vereiteln. Aber auf einem Studentenball wurde es unausweichlich, die alte Widersacherin zu begrüßen. Es lief erstaunlich gut ab, so daß ich glaubte, alles Frühere sei wie eine Kinderei vergoren und vergessen. Sie war, wie ich nun gleich sah, doch ein bißchen anders geworden. So spielte sie jetzt eine sehr aufgeheiterte Miene, aber lachte dennoch nicht mehr so laut und sprach auch langsamer und in einem tiefern Altton. Ihre Hände waren immer noch von langem schwärzlichem Flaum bedeckt, und die Augen flimmerten noch immer goldgelb. Aber alles war ruhiger und sicherer an ihr . . . Als Regina mir zwischen einer Polka und einem Walzer erzählte, wie ihr Mütterchen sozusagen ein kleines Kind, sie aber wie eine große Mutter geworden sei und ihr selber die letzten Süpplein gekocht, die letzten Arzneien eingegeben und am letzten Morgen ihr noch das Bett gerüstet habe und wie dann auf einmal die Mutter sagte: »Regi, laß mich auf deinem Arm schlafen!« und ihr weißhaariges Köpflein sogleich auf Reginens Ellbogen legte, der Tochter noch einmal ins Gesicht lächelte und schelmisch dankte, als habe sie etwas sehr Witziges vor, und wie sie dann gleich einschlummerte und überaus still ward, bis Regine merkte, daß sie gar nicht mehr atme – da bekamen die langen Augen des Fräuleins einen leisen, zärtlichen, innerlichen Glanz und umränderten sich mit einem feuchten, feinen Rot, fast wie mit einem Hauch von Blut . . . Wir plauderten immer unbefangener. Die Studenten gefielen ihr. Besonders unser blauäugiger Riese Baldur wirkte mächtig auf sie.
Den Studenten geht alles dreimal leichter und flinker vonstatten, auch die Liebe und ihre Wagnisse. Theodor erwiderte die unverkennbaren Aufmerksamkeiten der schönen Jungfer immer eifriger. Meine Bekanntschaft mit Reginen half ihm trotz meinem Widerstreben zu einem immer vertrautern Verhältnis mit ihr. Es kamen die heimlichen Stelldichein, die verstohlenen Spaziergänge Arm in Arm an einsamen Orten, der Briefwechsel unter hundert Verschmitztheiten und Gefahren. Denn als Theodors Vater, ein alter, steifer, strenger Ratsherr in Ilgis, der Sache auf die Spur kam, verbot er dem Sohn jede Fortsetzung eines so verfrühten Romans und bestellte Spione in der Nachbarschaft. Dem Fräulein schrieb er, Theodor sei ein viel zu übereilter, unsteter, launischer Junge, als daß er jetzt schon wie ein Mann handeln dürfe. Er halte die werte Jungfer für so ehrenhaft, um jede Aunäherung an seinen Sohn zu meiden. Sonst . . . Dieses Sonst erschreckte die Liebenden nicht, sondern machte sie nur noch treuer gegeneinander. Doch wurden sie nun vorsichtiger und ließen sich auf keine Weise mehr beisammen ertappen. Ich freilich sah und wußte alles. Je öfter ich nun mit Regina zu schaffen hatte, desto deutlicher meinte ich, daß sie doch innerlich die alte Katze geblieben sei. Sie schmeichelte und streichelte und log und kratzte wie ehemals, nur geschah alles in einem größern und feinern Schnitt. Sie verleumdete und liebte Zänkereien, aber erschien dabei sonderbar ernsthaft und ruhig. Sie verlachte und verketzerte mich hinterrücks. Wieder fühlte ich das Unliebe und Ungute ihres Charakters, und das verlöschende Kerzlein meines Hasses brannte frischauf. Fast täglich bekamen Theodor und ich des Mädchens wegen Streit. Auf jede denkbare Art suchte ich ihm das Fräulein zu verleiden, sobald ich sicher war, daß es sich bei meinem Freunde nicht um eine der flackernden Liebeleien, sondern um eine große, grausame Liebe handle. Ich erzählte ihm meine Katzenerfahrungen, ich fädelte es so ein, daß Theodor mitten in eine ihrer Lügen hineinsah, ich zerrte sie in seinem Beisein in ein feineres und gescheiteres Gespräch und ließ ihre Dummheit dann recht hell erstrahlen. Aber alles half nichts. Er war hoffnungslos verliebt. Nun wollte ich schweigen. Aber Theodor nötigte mich, zuzuschauen, wie ihre Umarmungen immer heftiger, ihre Küsse immer brennender wurden. Ja, da Regina bei aller graziösen Bengelhaftigkeit mir ins Gesicht artig tat und Theodor und ich wie Brüder lebten, habe ich oft, innerlich unfroh, aber durch die Liebe zum Freunde gezwungen, zwischen dem Paar die verschiedensten hilfreichen Rollen gespielt. Einmal besorgte ich als Merkur ihre Liebespost, einmal fuhr ich sie als Neptun in den stillen abendlichen See hinaus, einmal war ich ihr Apoll und mußte mein Flötlein blasen, dann war ich Schutzwache, Spion und wunderte mich selber am meisten über die Vielseitigkeit meiner sonst so einfachen Person. Damals stand ich bei Theodor und scheinbar auch bei Reginen am höchsten in der Gunst. Einmal, da ich sie in einem Einspänner einen schönen Oktobernachmittag hindurch übers goldreife Obstland gefahren hatte, sagte Theodor beim Aussteigen: »Mir ist einfach nicht wohl, weil wir dich nicht entlohnen können, wie du es verdienst!«
»Ah bah!« knurrte ich verschämt.
»Das können wir!« versetzte Regine mit einem seltsamen Lächeln. »Wir beide wollen ihn einmal herzlich küssen!«
Und ohne eine Erwiderung abzuwarten, umschlang sie mich und gab mir einen stechendheißen Kuß auf die Lippen. Dann bat sie Theodor, das gleiche zu tun. Diesen zweiten Kuß, so ehrlich und stramm er geboten ward, fühlte ich gar nicht vor dem ersten, der mich wie ein Wespenstachel noch lange schmerzte . . . Aber am gleichen Abend sagte die Lob, diese Katze, zu ihren Freundinnen: »Kennt ihr den Schneckenkönig?«
Alle antworteten lachend: »Nein!«
»Nun, das ist ein Bauernbub aus dem Dorfe Lauwis. Er studiert jetzt hier Medizin. Doch riecht er aus allen Taschen nach Rüben und Kohlköpfen. Gebt acht, wenn ihr mit ihm tanzt, daß ihr nicht einschlafet! Zwickt ihn! Ich habe ihm einmal sein Tintengeschirr ins Gesicht geschmissen, das machte ihn wieder für ein Stündchen lebendig!«
»Warte, Zigeunerin, aus diesem Tintengeschirr geb' ich dir einmal zu schlucken, daß du genug hast!« schwor ich und drehte grimmig meine ersten sieben Barthaare.
Um jene Zeit kam meine Schwester aus dem Welschland heim, und ich sollte sie als braver Bruder in unsere Gesellschaft einführen.
Pauline war ein offenherziges, zierliches, aber unscheinbares Persönchen, mit weißlichgrauen Augen, glattem, hellem Haar, einer niedrigen Stirne und einem wahren Kindernäschen. Aber dieses achtzehnjährige Wesen hatte eine Lippe wie ein Rosenblatt, so weich und schwellend breit und duftig! Und auf diesem herrlichen Munde saß immer ein Lächeln und stieg wie ein Sonnenstrahl in die kleinen, grauen Augen und vergoldete das ganze milchweiße Gesichtlein. Sie liebte nichts so sehr wie die kleinen Kinder, und ihr Herz war auch so ein Kleinkinderherz geblieben, obwohl Pauline dabei ein ganz kluges und praktisches Wesen bewies. Sie war immer zufrieden. Und dieses süße, stille Licht, das ohne Sonnenuntergang auf ihrem Gesicht ruhte, machte, daß es allen Leuten ohne Unterschied neben Pauline so merkwürdig wohl und warm und hell ward. Redete Pauline dann – und sie tat es viel unbefangener, als man von einem solchen kleinen Geschöpf vermuten konnte – so tönte es wie ein dünnes Orgelpfeifchen, so sorglos freudig und alle Bässe überklingend. Es konnte in Gesellschaft häufig geschehen, daß man Pauline stundenlang gar nicht sah. Aber wer sie dann sah, sah zuletzt nur noch sie. Mein Schwesterlein war die Anspruchslosigkeit selbst. Auf mich hatte sie ein Vertrauen gesetzt, wie es sonst nur ein Vater genießt. Nie gingen wir zu Bette, ohne noch ein Weilchen zusammenzusitzen und uns etwas recht Liebes zu sagen. Ging eines von uns für einen Tag fort, so gab es zwischen uns einen Abschied wie zwischen Amerikareisenden, und wir holten einander am Bahnhof ab, als hätten wir uns jahrelang nicht mehr gesehen. Kurz, wir lebten zusammen wie eine Welt für sich, mochte außerhalb eine andere, noch so wichtige und schöne Welt existieren. So unähnlich wir einander waren, meinten wir doch, alle Menschen müßten uns die Zwillinge ansehen, und wir fühlten es sozusagen im Blut, daß wir nicht nur die gleiche Geburtsstunde hatten, sondern sozusagen das gleiche Leben lebten. Nein, uns sollte nichts trennen!
Theodor hatte früher ein Weilchen meine Schwester umworben. Aber dem Mägdlein war so ein Gewaltsbursche viel zu groß und zu laut. Auch mein Freund merkte bald, ein so niedliches Ding, das er zwischen zwei Fingern beinah zerbrechen konnte, möge ihm recht wohl zum Schwesterchen, aber doch nicht gut zur Frau Liebsten passen. Und als es einmal so weit klar zwischen ihnen war, lebten Ries' und Elflein in der schönsten Kameradschaft. Ich hatte sie in einem Gedicht so getauft, und nun hielten sie selber im Spaß und Ernst an diesem Duo fest.
Schnell genug sah das Elfchen einen ganzen Hof von flaumbärtigen Jünglingen um sich. Ich tat mir darauf viel zu gut, als ob das alles mein Verdienst wäre. Nur Pauline selbst schien nichts zu merken. Gegen die goldbraune Bronze Reginas war meine Kleine ein wahrhaftes Alabastersächelchen, so bleich und von so durchschimmernder Klarheit und, wie man mit Unrecht bangte, auch so verletzlich. Sie bewunderte Regina. Die war in ihren Augen eine Königin, der alle Welt die Hände unter die Füße legen sollte. Ihr Kinderherz fühlte noch kein Sehnen nach Männerlippen. Sich an eine schöne, starke Frau oder an eine mächtige Freundin anschmiegen, war einstweilen ihr Höchstes.
Wie gut verstand Regina diesen Charakter meiner Schwester! Bald hatte sie Pauline wie einst bei den Schulpausen ganz für sich gewonnen, und Arm in Arm durchschritten die zwei so ungleichen Wesen auch jetzt wieder in den Ruhepausen unsere Gesellschaft. Es war ein sonderbares Paar: die große, prachtvolle Katze und das seidige, graue Kaninchen. Noch nie hatte mir die heißfarbene Schönheit Reginas so ins Auge gestochen wie in solchen Minuten, da sie meine schlichte Schwester so majestätisch durch die Säle unseres Balles führte. Eine ganze Hölle von Argwohn erwachte in mir. Wollte Regina das Kind in Schatten stellen? Es mir entfremden? Es in ihre Katzentücke einweihen? Ach, wäre ich vor Haß nicht so blind gewesen, ich hätte doch hell genug sehen müssen, wie die Schneeglöckleinart meiner Kleinen neben der Rosenglut Reginens erst recht wirksam wurde! Noch mehr, ich hätte mich überzeugen müssen, daß Regina ihre kleine Gespanin mit der Zärtlichkeit einer Mutter an sich schloß . . .
Mir wurde nach und nach zumute, als ob meine Schwester sich auf unsere gemeinsamen Abendstunden nicht mehr so innig freue wie früher, als ob die Zusammenkünfte mit Regina ihr wertvoller würden. Ja, eine gewisse Lässigkeit glaubte ich in ihrem ganzen Verhalten gegen mich zu erkennen. Ich konnte dafür nicht die kleinste Tatsache erbringen; dennoch ließ sich diese lästige Empfindung einfach nicht wegblasen. Dann marterte es mich, daß ich weit mehr meiner Schwester als sie mir nachlaufe. Bisher war es umgekehrt gewesen. Mein ohnehin schwerblütiges Temperament litt darunter. Beweise gab es auch da keine.
Eines Tages erzählte mir Pauline, Theodor und Regina hätten in aller Stille die Verlobungsringe gewechselt. »Elfchen muß sie uns anstecken, dann halten sie ein Jahrhundert!« habe Regina gesagt, und so habe sie beiden das Reiflein an den Finger gesteckt. Weil Regina das Grüne so liebe, trage ihr Ring einen wunderbaren Smaragd. Sie hätten dann ausgemacht, daß sogleich nach dem Doktorhut Theodors die Hochzeit gefeiert werde. »Da müssen wir zwei dabei sein, Walter,« sagte Pauline und wiegte sich wie zu einem hochzeitlichen Menuett auf ihren Füßen. »Welch eine Frau bekommt Thedi! O welch eine Frau, der Glückliche!«
Mir stieg alles Blut in den Kopf. Das verwünschte ich ja gerade, was das Elfchen vor mir wie eine Herrlichkeit ausbreitete. Ich hielt es für das größte Unglück Theodors. Aber ich hatte mir vorgenommen, kein Wort mehr in dieser verlorenen Sache zu sagen. Es riefe nur Zwist und frommte zu nichts. Aber je schöner Pauline nun ausmalte, welch eine edle, unvergleichliche Gattin diese Regina dem Freund sein werde, wie tüchtig sie ihm haushalten werde und welch herrliche Kinder sie ihm geben und welchen ewigen Sonnenschein sie in die hintersten Hauswinkel streuen werde: um so düsterer wurde ich, weil mir das Gegenteil von alledem gewiß schien. Ich schwieg mit Mühe. Da zupfte das Elfchen mich schmollend am jungen Bart und schalt: »Du Lappländer, du Schneemann!« Ich suchte nun ein wenig zu nicken und zu lächeln. Aber sowie Pauline singend das Zimmer verlassen hatte, fühlte ich sehr scharf, daß es in unserer schönen wohlgerundeten Geschwisterwelt nun doch einen feinen, aber wohl recht tiefen Riß gebe . . .
Ein andermal kam ich müd und verdrossen aus einer Korpssitzung unserer Bockia heim. Es war ein wichtiger Abend gewesen. Nicht nur weil unser berühmtestes Ehrenmitglied Bundespräsident geworden war und wir eine Abordnung nach Bern bestimmen wollten, sondern noch viel mehr, weil heute mit einer angesehenen gegnerischen Verbindung nicht bloß Friede, sondern Bruderschaft geschlossen werden sollte. Auch die saumseligsten Mitglieder waren erschienen, nur Theodor nicht. Er, der mich in diesen Verein hineingekeilt hatte, schwänzte schon lange nicht nur die Kollegien, sondern auch unsere Sitzungen. Alle Kameraden schimpften über ihn, aber alle mit Wehmut, weil man ihn eben noch immer sehr liebte. Das Präsidium klagte geradezu, daß wir den flottesten Burschen an ein Mädchen verloren hätten . . .
Da fing auch ich an, im stillen nachzurechnen, wie selten Theodor noch zu mir kam. Seit Wochen waren wir nicht mehr spaziert oder gemütlich in der Bude gesessen, um etwas Großes und Teures zu plaudern und uns irgend was Tapferes fürs Leben zu sagen. Früher war das unser tägliches Brot gewesen. Jetzt gab es davon nur noch spärliche Brosamen. Alles schlang uns dieses Zigeunermädchen weg. Ich wußte ja wohl, daß Theodors Freundschaft zu mir nicht vermindert war. Aber was nützte mir das, wenn ich sie nicht mehr zu sehen, zu fühlen, zu genießen bekam? Eine wilde Empörung gegen meine alte Feindin wallte in mir auf. Sie allein hatte das schöne goldene Kameradenleben zerstört. Die Klagen der Corona ringsum vermehrten meine Wut. Tränen stiegen mir ins Auge. Was mochten doch die da klagen? Hundertmal mehr verlor ich als sie alle zusammen. Ich nahm Mütze und Bakel und stürmte hinaus. Am liebsten hätte ich die halbe falsche Welt zusammengeprügelt. Tief im Innersten unglücklich und verzwistet lief ich heim und klopfte am Kämmerlein meiner Schwester. Wie immer wird sie auf mich gewartet haben. O, ich wollte sie heut umarmen und eng neben mich setzen und ihren großen Rosenmund mitten im weißen Schneewittchengesicht küssen und sie gar nicht loslassen, bis ich an ihrem so still und friedlich klopfenden Herzlein meine Ruhe wiedergefunden hätte! Noch immer fand ich sie hier . . . Aber das Zimmer war verriegelt. Zum erstenmal in unserem Geschwisterleben!
»Beth,« schrie ich unserer neuen Magd, »wo ist Pauline?«
»Sie sollen nicht auf sie warten, hat das Fräulein gesagt!« berichtete die Magd, als könnte sie mich damit beruhigen. »Sie läßt Ihnen gute Nacht sagen! Sie . . .«
»Was . . . Wo . . .«
»Fräulein Lob hat Ihre Schwester abgeholt. Sie spielen ein Theater, und Fräulein Pauline sagte, es werde so spät, daß sie auch bei ihrer Freundin übernachte!«
Ich kann nicht sagen, wie mich in der damaligen Stimmung eine solche Meldung traf. Wie eine Todesnachricht. Mir war, Freund und Schwester seien am gleichen Abend gestorben. Eine unsägliche Vereinsamung erfaßte mich in meinem leeren Zimmer.
Am Morgen sah ich freilich alles wieder viel kühler an und schalt mich einen Narren und Selbstquäler. Und als Pauline in der Frühe heimkam und sogleich an mein Bett sprang, mir mit ihrem morgenkalten Mund einen Kuß gab und sagte, sie habe den Schlüssel nur wegen der neuen, noch ganz unverläßlichen Magd abgezogen, da mußte ich wahrhaft über meine gestrigen Aufregungen lachen, und eine tapfere Zeit hindurch hielt ich mich von ähnlichen Anfechtungen frei.
Aber am Neujahrsball, der nun folgte, nahm Regina mein Elfchen so ganz in Beschlag, versagte oder verschenkte sie den Tänzern so eigenmächtig und zog sie so tief in ihre geheimen Klatschecklein, daß ich kurzweg glaubte, sie wolle mir schon am ersten Tag des Jahres deutlich erklären: Heuer gehört das Kind da mir und niemand sonst, auch diesem grollenden Duckmäuser nicht! Ich trank in meiner Aufregung mehr Wein, als gut tat, und mit jedem blutroten Kelchlein wurde ich wilder. Vor dem Bankett konnte ich endlich Pauline zu mir winken. Sie trippelte gehorsam wie ein Hündchen daher und spitzte gleichsam die Ohren, um ja keine gute Silbe von mir zu verlieren. Wie ein Schneeglöcklein stand sie in ihrer Unschuld vor mir. Schon reute mich mein Vorhaben; aber nein, ich konnte nicht mehr anders und sprudelte leise heraus: »Elfchen, Elfchen, nimm dich doch in acht vor Regine!«
Ungläubig und mit einem kleinen Vorwurf entfaltete das Jüngferchen seine zwei Rosenblätter und sagte: »Warum?«
In diesem Augenblick fühlte ich peinlich, daß ich keinen deutlichen Grund zum Warnen angeben könne. Aber die Eifersucht erfüllte mich bis an den Rand, und ich brach los: »Jetzt kann ich es dir nicht erklären, daheim dann! Aber glaub' mir . . .«
»Jetzt, jetzt mußt du mir sagen, warum!« versetzte Pauline ohne Lächeln. »Du irrst dich! Du bist böse auf sie wegen deinem Thedi, ach, du . . .«
»Sie ist eine falsche, lügnerische, dumme Hexe, die alles untereinander bringt und den Theodor und dich und uns alle verderbt . . . Sie . . .«
»Walter!« rief das Kind mit einer feierlichen Entrüstung und reckte sich empor, um mir Mund gegen Mund zu entgegnen.
»Eine Katze, die nicht von ihrer Art lassen kann, ja, so! Und wisse nur, ich werde jetzt mit Händen und Füßen und mit der ganzen Seele gegen sie arbeiten, ich . . . ich . . .«
»Walter, du hast Fieber, vom Wein . . .« hörte ich mein entsetztes Elfchen dazwischenreden.
»Nicht vom Wein, von der Wahrheit kommt das! Seid nur alle blind; aber ich will euch allen die Augen aufreißen, euch Verzauberten und Belogenen . . .«
Pauline riß sich aus meiner Hand und trat einen Schritt zurück. Sie musterte mich von da wie einen Kranken. In diesem Augenblick rauschte Regina in schwerer, dunkelroter Seide daher. Aber dieses glühende Kleid war durch ein feines, schwarzes Spitzengewebe gedämpft. Nur wie unzählige, blutige Flämmlein züngelte die Seide aus der Verschleierung. Dieser Aufzug hatte für mich etwas Unheimliches. Und gerade solche rote Flämmlein schossen auch aus Reginens laugen Augen. Sie machte vor mir einen lustigen Knicks und schlug meine Schwester leicht mit dem Fächer auf die Kinderschulter. »Bist mir entschlüpft, Täubchen?« läutete sie mit ihrer sonoren Altstimme. »Wart' nur, jetzt bind' ich dich!« Rasch gab sie dem Elfchen einen Kuß auf die niedrige Stirne und führte es wie ein machtloses Kind weg. Und dieses Kind öffnete seine Rosenblätter und lächelte überselig zur Dame empor . . .
»Vermaledeite Zigeunerin!« wollte ich rufen; aber ich brachte keinen Ton heraus.
Am Bankett würgte ich mit Mühe einige Brocken hinunter. Hinter einer Blumenvase beobachtete ich bequem das Tun der Kameradinnen. Mitten zwischen zwei Büscheln Goldlack tauchten der dunkle und der blonde Kopf in immer zärtlicheren Mienen auf. So innig hatten sie sich noch nie vor andern gebärdet. Die Ältere sorgte für die Jüngere wie ein Schutzengel. Mich wunderte, daß Theodor nicht eifersüchtig wurde.
Darauf ward eifrig getanzt. Pauline ließ keine Runde aus. Mich floh sie. Später verlor ich sie ganz aus dem Auge.
Ich weiß nicht mehr, wie lange ich bald zusah, bald mechanisch mithopste. Verärgert bis in den Grund meiner Seele lief ich endlich in den Rauchsalon, wo ältere Philister sich aus den Witzblättern vorlasen oder einen Königsjaß spielten. In einer wolkigen Ecke saß zu meinem Staunen der schöne, olivenbleiche Echino Gonzal Deflores allein an einem Tischchen und dampfte wütende Nebel aus seiner Virginia. Er stierte mit seinen unvergleichlich großen, samtschwarzen Augen steif in die Diele. Dem war etwas Böses passiert, das merkte ich auf den ersten Blick. Er hatte die Schärpe um den zarten, schlanken Hals gewickelt und trug den Hut auf den Knien, als wollte er im Augenblick heimgehen.
Ich empfand eine seltsame Freude, ihn so zu treffen, und sagte mit erzwungenem Spaße: »Was? Amor höchsteigen tanzt nicht? Willst du denn heute alle hübschen Kinder zur Verzweiflung bringen?«
Unser achtzehnjähriger Don Juan machte eine unliebe, abwehrende Geste. Sein schmales Aristokratengesicht wurde ganz hart und farblos.