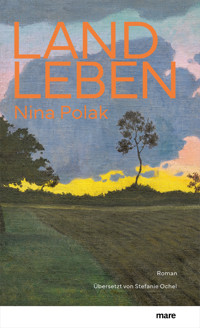
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: mareverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nachdem ihre Beziehung die erste hürdenreiche Zeit überstanden hat, beschließen Rivka und Esse, der Enge Amsterdams zu entfliehen. Am Rande des Dorfs Onderweer, wo man an guten Tagen das Meer riechen kann, finden sie ein altes Haus inmitten eines großen Gartens. Hier hofft Esse, ihre Gefühlswelt zu erden, und Rivka, neue Inspiration für ihr Schreiben zu finden. Doch nach dem Umzug ist der Mistgeruch penetrant, das Wetter oft schlecht, und der Garten stellt sich als unbändiges Monster heraus, in dem das Unkraut wuchert, sobald man ihm den Rücken kehrt. Spätestens aber, als die Pferdestallbesitzerin und Ratgeberautorin Eva Alta aus dem Nachbardorf auftaucht, um Rivka und Esse ungefragt durch ihr neues Leben zu coachen, fällt ein tiefschwarzer Schatten auf ihren Traum der ländlichen Idylle.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Nina Polak
LANDLEBEN
Roman
Aus dem
Niederländischen
von
Stefanie Ochel
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel Buitenleven bei Uitgeverij Prometheus, Amsterdam.
Copyright © 2022 by Nina Polak
Der Verlag dankt der Niederländischen Literaturstiftung für die Förderung der Übersetzung.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
© 2025 by mareverlag, Hamburg
Covergestaltung Nadja Zobel, Petra Koßmann / mareverlag
Coverabbildung Heritage Images / akg-images / Fine Art Images
Datenkonvertierung E-Book Bookwire
ISBN E-Book: 978-3-86648-847-2
ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-690-4
www.mare.de
Inhalt
I
II
III
Über das Buch
Für Loes
Sie hatte überlegt, ihren Namen zu ändern. Wahrscheinlich war das der Tiefpunkt, eine lasche Alternative zum Todeswunsch. Irgendwas Klassisches am besten, Anna, Stella, Marie, dahinter schön solide und unbestimmt Smit, Dekker oder Mulder. Anonym auswandern, Prag, Neapel, Valencia, egal. Bloß weg von dem Mitleid.
Frau, fünfunddreißig, alleinstehend, etwas Bedauernswerteres schien für die Außenwelt gar nicht vorstellbar.
Hier in der Isolation stapelten sich die unadressierten Werbeprospekte. Hier gab es Thunfischdosen, die sie am Küchentresen im Stehen auslöffelte, und ein neues Ikea-Sofa. Außerdem einen Fernseher, mit dem sie hemmungslos Hassdialoge führte. Die Menschen auf dem Bildschirm hatten entweder künstlich gute Laune oder es auf die Zerstörung der Gesellschaft abgesehen. Man konnte sie nur verachten und auf eine Naturdoku hoffen, die aber letzten Endes auch sauer aufstieß – herrliche Steppenkreaturen preschten darin nichts ahnend dem Aussterben entgegen.
So suhlte sie sich gerade in einer fischigen Brühe aus Selbsthass, als sie an einem windigen Frühlingstag den Vorhang ein Stück aufzog, aus dem dritten Stock auf die Straße blickte und den blauen MG vor dem Haus parken sah. Nein, sagte sie laut. Der Fahrer, ein grauer Herr in Wachsjacke, hievte sich aus dem kleinen Auto, überquerte die Straße und klingelte. Ihr erster Impuls: Verstecken, im Bad, hinter der Waschmaschine. Doch das Klingeln hörte nicht auf, sodass sie sich schließlich notgedrungen fester in ihren Fleecemorgenmantel wickelte und zur Tür schlurfte. Nach noch zweimaligem Zweifeln drückte sie auf den Knopf der Gegensprechanlage.
»Papa?« Ihre Stimme klang fremd.
»Rivka, Liebes? Mach deinem alten Papa doch mal auf.« Seine Worte knisterten wohltuend. Zum ersten Mal seit zwei Wochen schien etwas in ihr zu tauen. Sie zurrte den Bademantel fester, um nicht zu weinen.
»Es passt gerade nicht so gut, Papa.«
»Ach, Eule, deine Mutter macht sich Sorgen.«
Und er?
»Sie kann gar nicht mehr schlafen, Rivka.«
»Tut mir leid.«
»Kann ich kurz raufkommen?«
Sie betrachtete die Verwüstung, in der sie sich wochenlang gewälzt hatte. Dieses Loch, das als Wohnung durchgehen sollte, kostete sie zwölfhundert Euro pro Monat und hatte das bisschen Würde, das es mal verheißen hatte, längst eingebüßt.
»Papa, ich ruf euch später an, ja?«
»Darf ich dann wenigstens kurz aufs Klo?«
»Das geht jetzt nicht.«
»Ich muss wirklich mal.«
»Da ist eine Kneipe an der Ecke.«
»Gut, mein Kind, wie du willst.« Die Stimme ihres Vaters klang brüchig. Sie biss sich auf die Fingerknöchel.
»Papa, es tut mir leid.«
»Vergiss nicht, wer du bist, Rivka.« Dabei klang er, außer wie der Vater aus dem König der Löwen, auch ungeduldig und streng – kurzum: vertraut.
Sie ließ die Taste der Gegensprechanlage los.
Im nächsten Moment kniete sie vorm Fenster, lüpfte den Vorhang und blickte in die Tiefe, auf die felsenhafte Gestalt ihres Vaters, Doktor Jacob Schaap, der wieder die Straße überquerte. Sein weißes, über die Glatze gekämmtes Haar flatterte auf, seine bebende Hand suchte den Autoschlüssel, und dann zwängte er sich wieder in den Sportwagen. Mit seiner randvollen Blase fuhr der alte Mann zurück nach Den Haag.
Wie war sie auf die Idee gekommen, den leidgeprüften, aber stolzen Namen ihres Vaters durch etwas so Plumpes wie Mulder zu ersetzen? Was hatte sie da geritten? Sie drückte ein paar Tränen weg und riss den Vorhang auf.
Das war der Moment. Die Egomanie der Verzweiflung lichtete sich, und Rivka Schaap nahm Schwamm und Eimer zur Hand.
Einen Tag später war die Wohnung zwar immer noch trostlos, aber zumindest sauber. Rivka reanimierte ihr Telefon, schickte Entschuldigungen an Eltern und Freunde und checkte sogar ihre Mails. Der einzige Ausweg aus der Apathie bestand darin, für jemand anders etwas zu bedeuten. Im Schreibtischdurcheinander suchte sie den Lieferdienstzettel, auf dem sie die Nummer des Anwalts notiert hatte. Laus Snoek – allein schon der Name! Sie rief ihn an und ließ ihn wissen, sie sei zu einem Gespräch bereit.
»Das sind ausgezeichnete Neuigkeiten, Frau Schaap«, sagte der nicht mehr taufrische Burschenschaftler. Ob sie auch eine Zeugenaussage machen wolle?
Das wisse sie noch nicht, antwortete sie. Aber welch gutes Gefühl, irgendwas zu tun. Ob es das Richtige war, würde sich zeigen.
Sie verabredeten sich in einem Bahnhofscafé, sie und der Anwalt. Zum Treffen zog sie eine feine Wollhose mit weitem Bein an, dazu braune Stiefel und eine grüne Bluse. Ihren ganzen Schmuck hatte sie weggepackt, kahl und fahl hatte sie sein wollen. Jetzt aber nahm sie einen Ring aus dem Schmuckkasten, einen goldenen von ihrer Großmutter, und während sie ihn ansteckte und sich dabei im Spiegel betrachtete, fühlte sie sich zum ersten Mal seit Langem wieder als Mensch statt als Murmeltier.
Es war ein Morgen wie gemacht für Wiedergeburt, die Luft glasklar. Die Hände in den Taschen, lief sie an der Straße entlang zur Tramhaltestelle, blieb dort stehen und blickte auf die alten Bäume im Park. Ein Japanischer Ahorn zeichnete sich flammend gegen den blauen Himmel ab. Dieser Tag konnte gut und gern der schönste des Jahres sein, so ein Tag, der einem alles Mögliche versprach. Sie lauschte, auf die Vögel, die Straßenbahnen, die sich zoffenden Jungs, die Stadt! Doch mit all dem vergessenen Schönen sickerte auch der Schmerz herein. Hier war es, das Vermissen, hier an der Tramhaltestelle Beukenweg. Rivka dachte an den Hund, wie er übers dampfende Feld tollte, sein Atem in Wolken, und damit, wusste sie, war auch Esse ganz nah, ihr Geruch, ihre Haut, so sinnlich, unverwechselbar, unwiederbringlich.
I
Im neuen Garten stand eine Platane. An der glatten, blätternden Borke hatte Rivka es gleich erkannt. Esse hatte auf Ahorn getippt.
Zwei Monate vor dem Umzug hatten sie mit einem etwas schmuddeligen Makler neben diesem Baum gestanden und sich das »charakteristische Wohnhaus von 1900« von hinten angeguckt. Snibbe hatte sich ins Gras gefläzt, als ob der Garten schon ihm gehörte. Der Makler sprach wenig, während er Rivka und Esse herumführte. Was er sagte, klang nordisch: spröde, relativierend. Rivka ließ es drauf ankommen und nahm demonstrativ die Hand ihrer Freundin, und als sie dem Makler Hand in Hand in die sonnendurchflutete Küche folgten, bemerkte er staubtrocken, dass ein Stück weiter zwei Männer wohnten. Auch aus dem Westen. Nette Leute.
»Makler sind hier einfach normale Menschen«, sagte Rivka auf der Rückfahrt. Sie spürte, dass Esse ihre Begeisterung über das Haus im Zaum halten wollte, und verfiel in Schweigen. Es war ein gegenseitiges Abtasten der Stimmung. Beide waren sich einig, ahnte Rivka, aber auch auf der Hut, weil es zu schön schien. Der Dampf von glücklichem Hund füllte den Wagen, Rivka schaute in die Weite, das Noorderland, von dem sie nicht genau sagen konnte, ob sie es beruhigend oder beängstigend fand. Inmitten der Lehmwüste war dieses unerhört bezahlbare Haus eine Oase, ein Hafen, mit einem Schuppen im Garten, wo sie sich schreiben sah. Sie sah ihre Büchersammlung im Einbauregal im Wohnzimmer, Esses Fotografien im Flur mit dem fahlen Marmor.
»Man könnte meinen, da ist was faul«, durchbrach Esse die Stille im Auto.
»Irgendwas ist immer«, sagte Rivka.
Wenig später hatten sie an der A6 gehalten. Ein kurzer Blickwechsel, dann rief Esse den menschelnden Makler an und machte ein Angebot.
Der Umzug verlief harmonisch, der Abschied vom Alten unsentimental. Die Möbelpacker waren weg. Jetzt wohnten sie hier, hoch im Norden, wo man an guten Tagen das Meer riechen konnte. Es war kein großes Haus, aber der tiefe Garten ein üppiges Stück Zukunft. Friedlich und voller Möglichkeiten, so hatte er auf sie gewirkt. Er ließ ihre abgehetzten Herzen ruhig und kräftig schlagen.
Außer der Platane, sah Rivka jetzt durchs Fenster einer Küche voller Kisten, standen im Garten noch eine schlanke Lärche, eine Birke und am Graben drei Kopfweiden. Nur eine Fingerübung für Rivka – inzwischen konnte sie schon an die fünfzig Baumarten bestimmen. Die Welt dehnte sich aus, wenn etwas, was früher nur einen einzigen Namen hatte – Baum –, sich auf einmal in unzählige wohlklingende Kategorien verzweigte. Pappel, Zypresse, Herlitze – wie war sie ihr Leben lang bloß ohne diese Wörter ausgekommen?
Bäume erfreuten sich in letzter Zeit einer neuen, etwas verzweifelt wirkenden Wertschätzung durch den Menschen, und auch Rivka war für diese Regung empfänglich. Das Buch eines Försters über die Kommunikation der Bäume war in aller Munde. Mit ihren Wurzelsystemen versorgten sie ihre Nachkommen und ihre alten, kranken Nachbarn. Auch wenn Rivka schlecht beurteilen konnte, wie wissenschaftlich fundiert das Ganze war, hatte die Vorstellung ihren Charme. Nach dem Erfolg des Bäumebuchs kam derselbe Förster mit noch tollkühneren Thesen über »Das geheime Netzwerk der Natur«, in dem Pflanzen und Tiere kooperieren, um alles in Gang zu halten. Die Natur, projizierte das Publikum vergnügt drauflos, verfüge schon seit Jahrtausenden über ihr eigenes Internet, eine uralte, überlegene Weisheit.
Am ersten Tag in Onderweer war das Wetter windig und frisch, der Frühling ließ noch auf sich warten. Esse saß in Trainingsjacke auf der Terrasse und blickte starr auf die Kulisse vor sich. Auf den Pfad zwischen den verwahrlosten Blumenbeeten, den dringend mähbedürftigen Rasen, die Platane mit ihrer Nacktkatzenhaut, das kleine Gewächshaus, den Schuppen, den halbhohen Zaun und dahinter das Land, das endlos wirkte.
»Ich hab jetzt schon die Nase voll«, sagte Rivka, die hinter Esse aufgetaucht war, worauf sie beide in sardonisches Lachen ausbrachen, erleichtert.
Im rostigen Metallkorb wurde Feuer gemacht, der Umzugskarton mit dem Spezialbier wurde aufgemacht, es wurde geknutscht, eine erste Erinnerung geschaffen. Sie hielten sich in den Armen und starrten in die Flammen, als würde sich darin etwas offenbaren.
Was hatten zwei Frauen, ein Liebespaar, hier im Norden verloren? Mal sehen, was die Stille mit uns macht, hatten sie sich gesagt. Der Wohnungsmarkt hatte bei der Entscheidung eine Rolle gespielt, wie eine feindliche Naturgewalt, trotzdem bezeichneten sie ihre Stadtflucht als Experiment. Der Umzug, so hofften sie, würde ihnen eine neue Perspektive auf das vertraute Leben bringen.
Es war ein nach der Stadt geformtes Leben, in dem Bedürfnisse laufend befriedigt und wieder von Neuem geweckt wurden und Menschen sich trotzdem ernstlich fragten, ob dieses Leben noch tragbar war – tragbar, erstrebenswert, ethisch und gesund. In Gesprächen über die kleinen und größeren Lebensdinge lautete die alles beherrschende Frage: Sollte man diesem erschöpften Planeten Nachkommen hinterlassen? Es war Thema in Cafés, in Weinbars, auf Wochenstationen. Manchmal schien es zwischendurch kurz um anderes zu gehen, um Kunst, Literatur, Weltpolitik. Natürlich wurden weiterhin Witze gemacht, geschmacklose, böse, makabre Witze. Aber letztlich war fast alles nur ein verkapptes Argument für oder gegen die eine große, tyrannische Frage.
Sie und Esse waren sich einig in dem Wunsch, den Dingen ihren Lauf zu lassen. Und der Lauf der Dinge, vermuteten sie, würde es außerhalb der Kakofonie der Stadt leichter haben. Er brauchte Raum, um sich auszustrecken, Stille, um sich Gehör zu verschaffen, und ein paar Bäume, an denen er sich messen konnte.
Jetzt hatten sie ihren Hof. Ungläubig streunten sie über das Grundstück, inspizierten jede Ecke. Dieses hübsche Haus, dieser Boden, alles gehörte ihnen.
In das Gewächshaus mit dem spitzen Dach hatte Rivka sich als Erstes verguckt. Es stand hinten im Garten, eine transparente Kirche aus Glas und Holz, wo ihre Stecklinge warm und behütet aufwachsen würden. Rivka war klar, dass sie die Gärtnerei romantisierte – ob sie für all die widerborstigen Sprösslinge genug Geduld auf bringen würde, musste sich erst noch zeigen. Aber sie war bereit, es zu versuchen, ebenso wie sie bereit war, mit ihrem Schreibtisch den Schuppen zu beziehen und die Seiten nur so rauszuhauen.
In der Stadt war sie in ihrem Schreiben immer befangener geworden. Die Gleichgültigkeit des Gartens gegenüber aller Kultur würde ihr Hadern relativieren. Die Platane würde sie Souveränität lehren. Ganz oben auf dem Schreibtischstapel würde der alte Baumführer Europa liegen, den sie vor dem Umzug in einem Antiquariat gekauft hatte.
Alles in allem hatten Esse und sie ziemlich hohe Erwartungen an die Natur. Rivka konnte darüber lachen. Bergschuhe und Baumführer, holt uns die lesbische Bestimmung doch noch ein, sagte sie.
Vielleicht war es das Alter, vielleicht auch das derzeit allgegenwärtige Untergangsgefühl – praktisch all ihre Freunde suchten auf einmal Trost im Grünen. Stellten sich die Balkone mit Pflanzen voll, studierten Baumbücher, warfen sich in nachhaltige wasserfeste Kleidung, schafften sich federleichte Fahrräder an und stapften unbeholfen steile Pfade hinauf. Sie buchten Wanderreisen in desolate Hügellandschaften, schliefen unterm Sternenhimmel. So erreichten sie die optimale Balance zwischen Eifer und Ergebenheit, zwischen Performanz und Akzeptanz. Nur widerwillig kehrten sie in die bewohnte Welt zurück, erzählten allen, wie gut ihnen die Natur doch getan hätte, und krümmten sich wieder über den Laptop. Rivka hatte fest vor, es besser zu machen, gründlicher und weniger leicht durchschaubar. Sie sah sich unter ihrer eigenen Platane sitzen, sah sich performen, ohne sich zu bewegen, von Ehrfurcht durchdrungen, der Erde endlich den Respekt erweisend, den sie ihr in der Stadt versagt hatte.
Esse, das wusste sie, sah sich selbst in Bewegung, jätend, mähend, grabend, durch Felder joggend und auf Fotos einfangend, was von den Dörfern der Umgebung noch übrig war – das zahnlose Grinsen eines Ladenbesitzers, eine verlassene frühmittelalterliche Kirche.
Am ersten Morgen, im noch chaotischen Schlafzimmer, öffneten Rivka und Esse die Augen und sahen sich an. Zum ersten Mal seit einem Jahr schliefen sie sofort nach dem Aufwachen miteinander. Als der Hund sich fiepend bemerkbar machte, nahmen sie ihren Kaffee mit in den Garten, wo es schon sonnig war und nach Erde duftete. Rivka meinte, sie Esse anzusehen: die Euphorie über einen herrlichen Neuanfang.
Sie streichelte Esse über den Arm und blickte auf die Platane. »Und wenn der Schatten uns hier findet, was machen wir dann?«
»Dann kann er sich dazusetzen«, sagte Esse.
»Oder er legt sich in die Hängematte, da zwischen der Platane und dem anderen Baum.«
»Was ist das für ein Baum, hast du das schon nachgeguckt, Botanik-Azubine?«
»Eine Vogelkirsche«, tippte Rivka.
Es war keine Vogelkirsche, wie sich später herausstellte, sondern ein Pflaumenbaum, der nicht blühen wollte.
Am selben Tag, die Kisten noch unausgepackt, mähte Esse den Rasen und rupfte wie manisch alles Unkraut, das sie entdeckte, aus dem Boden. Rivka grundierte die Innenwand des Schuppens, der ihre Schreibstube werden sollte, spielte mit Snibbe und döste auf dem Sofa, müde vom Zwiegespräch in ihrem Kopf. Ich wohne auf dem platten Land, sagte sie zu sich selbst. Ist es das jetzt? Ist es gut so? Es ist noch zu früh. Es wird gut, wenn der Kopf zur Ruhe kommt.
Am Ende des zweiten Tages köpften sie eine Flasche slowenischen Naturwein aus dem Delikatessenladen, der Rivka vielleicht am meisten fehlen würde, und blickten hinaus in den Garten. Der sah, vom gemähten Rasen abgesehen, nach einem ganzen Tag Arbeit kaum anders aus. Kein Ende vom Lied.
Esse musste ihre verkniffene Miene bemerkt haben, denn auf einmal lief sie ins Haus und kam mit einem eingepackten Buch zurück. Dankbar fuhr Rivka mit den Händen über das rot-weiße Papier des vertrauten Buchladens, bevor sie es aufriss. Walden von Thoreau in einer Neuübersetzung, flott illustriert.
»Das muss man anscheinend gelesen haben«, sagte Esse, »wenn man in die Wildnis zieht.«
Man. Rivka schlang die Arme um die Beine ihrer liebsten, es ihr immer recht machen wollenden Esse. Dieser funkelnden Kreatur, die sie aus der Stadt rausgelockt hatte.
Thoreau würde auf dem Schreibtisch zu liegen kommen, wie schon Augustinus, John Muir, Annie Dillard und andere Eremiten, die sich der Natur zu- und von der Menschheit abgewandt hatten. Rivka würde darüber nachdenken, was genau sie auf diesem Acker suchte. Sie würde darüber lesen und schreiben. In ihrem voreiligen Optimismus hatte sie einer Zeitung und einem Not leidenden Literaturmagazin Beiträge versprochen. Über die Abgeschiedenheit, über das Besitzen eines Gartens, über die Frage, warum zurzeit alle so dringend auf den Mount Everest mussten, um dann dort oben in schweineteuren Daunenjacken nach Einsamkeit zu lechzen. Das ikonische Foto, das diese Tragödie so treffend einfing, hatte sie sich in der Stadt an den Kühlschrank gehängt. Scharen von Stillesuchern, die allesamt der Welt aufs Dach steigen wollten und dafür Schlange standen wie vor dem Anne-Frank-Haus. Rivka sah in dem Foto sowohl einen Ansporn, der Menschheit zu entfliehen, als auch eine Karikatur dieses Strebens.
Aber gut, dass Esse nicht hergezogen war, um etwas zu suchen. An diesem Abend saß sie nur da wie ein Häufchen Glückseligkeit. Ihre Nase hatte Farbe bekommen, ihre Fingernägel hatten schwarze Ränder, es ging bergauf.
Den Basketballkorb hatten sie aus der Stadt mitgebracht. Esse hatte nicht länger warten können. Er war klassisch orange mit weißem Netz und hing jetzt an der Birke neben der Einfahrt. Hier war der Boden schön eben, sodass man dribbeln konnte, und rechts vom Baum war Platz für Dreipunktwürfe.
Das Auspacken der nächsten Reihe Umzugskartons musste warten, bis dieser Kindertraum sich erfüllt hatte; ein eigenes Basketballfeld war zwar zu viel gesagt, aber es kam nah dran. Nachdem Esse ein Brett am Baum montiert und den Korb befestigt hatte, erzielte sie mit einem alten, nicht gerade prallen Ball den ersten Korbleger.
»Du hast Publikum«, sagte Rivka und zeigte auf den Stamm der Birke, in dem schwarze Augen auszumachen waren. Der Baum hatte Esse fest im Visier, als sie bei ihrem zweiten Wurf danebentraf.
Rivka unternahm auch einen possierlichen Versuch, bei dem sie den Ball wie ein kleines Mädchen umklammerte, worauf sich Esse hinter sie stellte und sie anleitete, genau wie beim ersten Mal.
Das war jetzt über vier Jahre her. Kennengelernt hatten sie sich an einem heißen Septembertag bei einem freundschaftlichen Streetballturnier, bei dem Esse mit Abstand die Beste gewesen war, Rivka mit Abstand die Unbeweglichste. Sie war nur mitgekommen, um ein Freundinnenteam anzufeuern, und hatte während des gesamten Turniers mit einer Flasche Wein an der Seitenlinie gesessen. Ab und zu hatte Esse sie etwas rufen hören.
Als sie einander vorgestellt wurden – sie war einen Kopf größer als Rivka –, ärgerte Esse sich, dass sie so verschwitzt war, ärgerte sich über ihre alten oversized Chicago-Bulls-Shorts – früher mal das begehrenwerteste Kleidungsstück überhaupt.
»Du bist Profi«, hatte Rivka ihr an den Kopf geworfen, »das ist unfair.« (Wochen später, im Bett, räumte Rivka dann ein, dass sie sowohl die Bulls-Shorts als auch Esses lässige Überlegenheit auf dem Spielfeld ganz schön sexy gefunden hatte.)
Am Abend des Turniers, als die Sonne sich heimlich vom Feld zurückzog, hatte Esse protestiert, dass sie schon zwei Jahre kein Profi mehr sei.
»Klar«, sagte Rivka, »weil man eben im Sport auf dem Höhepunkt abdankt.«
Aber so war es nicht. Esse hätte locker noch sechs Jahre in der ersten Liga weiterspielen können. Diese sechs Jahre hatten sich in ihrem Kopf zu einer festen hypothetischen Größe entwickelt, einer parallelen Wirklichkeit. Regelmäßig kreisten ihre Gedanken um die Frage: Wo wäre ich jetzt, wenn … Das Wort Reue traf es nicht, dafür war die Entscheidung aufzuhören zu alternativlos gewesen. Dafür fragte sie sich heute noch zu oft, was sie da eigentlich all die Jahre getrieben hatte. Der niederländische Frauenbasketball warf ziemlich genau keinen Cent ab und kostete einen trotzdem die gesamte Lebenszeit. Irgendwann war klar, dass die Rechnung für sie nicht aufging. Der Trick bestand natürlich darin, die Rechnung gar nicht erst zu machen.
Damals auf dem Straßenspielfeld, der Asphalt glühte noch, hatte sich Rivka das alles angehört, mit einer Aufmerksamkeit, die Esse krass fand, aber auch charmant. Sie hatte den Eindruck, dass die Schriftstellerin intuitiv begriff, worum es ging. Rivka konnte es schöner, souveräner formulieren als sie selbst.
»Mutig eigentlich«, hatte Rivka gesagt. »Die meisten Menschen richten ihre ganze Energie auf die Zukunft. Spitzensportler wissen, dass sie eines Tages mit leeren Händen dastehen. Und dass man dann halt weitersehen muss.«
Mut war so ungefähr das Letzte, was Esse sich attestieren würde. An jedem Scheidepunkt hatte sie Angst gehabt. Und wenn sie dann eine Abzweigung genommen hatte, fürchtete sie immer, es könnte die falsche gewesen sein. Als es um die große Frage ging, die Sportkarriere an den Nagel zu hängen, war ihre Angst so groß, dass von einer wohlüberlegten Entscheidung nicht die Rede sein konnte. Ihr Kopf war vollständig von feindseligen Gedanken in Beschlag genommen, einem Chaos, in dem sie sich selbst nicht mehr ausmachen konnte. Mich gibt es gar nicht mehr, ging ihr irgendwann auf.
»Was war der andere Scheidepunkt?«, fragte Rivka, während sie Wein in Plastikbecher goss. Offenbar wollte sie Esse betrunken machen, lockte sie mit einem Grinsen, das sagte: Ich guck dich schon die ganze Zeit an, und ich mag, was ich sehe.
Eine der verpassten Abzweigungen war in Esses Kopf eine Schwingtür mit blättrigem Lack, die Tür zum Kunstraum auf dem Gymnasium. Der Anblick der Tür tat ihr weh, seit sie sich in der Elften für den Sport entschieden hatte. Jedes Mal, wenn sie dran vorbeilief, an dem Raum, den Farbdämpfen, dem Geruch von Ecoline, traf sie die Wehmut eines jungen Lebens, in dem sich erste Türen schließen.
»Du kannst doch immer noch auf die Kunsthochschule«, sagte Rivka.
Natürlich hatte Esse darüber nachgedacht. Sie hatte sogar ein propädeutisches Jahr absolviert, sich aber zwischen all den Heranwachsenden mit ihren großen Egos fehl am Platz gefühlt.
»Also kann man zusammenfassen«, sagte Rivka, »der Profisport war dir zu prekär und die Profikunst zu prätentiös.«
Esse war in Lachen ausgebrochen. Sie schaute sich diese Rivka an, die sich von ihr einfach hatte zutexten lassen. Schlau fand sie sie, die Schriftstellerin, sie war geschmeichelt und erleichtert, dass sie es geschafft hatte, ihre Aufmerksamkeit zu fesseln. Außerdem war sie beschwipst und fand Rivka lieb, aber auf eine nüchterne Art, eine Liebheit, die nichts Erdrückendes hatte. Gut riechen tat sie auch.
Der Korb, der jetzt an dieser blätternden Birke hing und in den sie ein ums andere Mal den halb platten Ball warf, markierte einen Schlusspunkt – ihr Ja zum Amateursport. Sie war weder Profibasketballerin noch Künstlerin. Sie war Ex-Spitzensportlerin und Hobbyfotografin, wohnhaft im Weiler Onderweer. Alles schick.
Rivka und sie hatten – wie so viele – ihren Traum von Raum und Ruhe geträumt, dennoch hatten beim Umzug auch praktische Gründe eine Rolle gespielt – ein Bezug zur Gegend, ein Arbeitsplatz, ein marktkonformes Gehalt. Esse war als Leiterin der Nachwuchsförderung bei der Provinzstadt angestellt. Nächste Woche würden fünfzehn vierzehnjährige Mädchen in einem altmodischen Turnsaal auf sie warten, der durchaus Ähnlichkeit mit der Sporthalle hatte, wo sich in den Neunzigerjahren ihr eigenes Talent zum ersten Mal gezeigt hatte.
Sie fühlte sich ausgeglichen. Sie traf, traf daneben, es spielte keine Rolle.
Nach fünf Wochen hatte Rivka immer noch nicht unter der Platane gesessen. Stattdessen hatte sie sich länger, als ihr lieb gewesen wäre, mit der Frage befasst, wie einer Maulwurfplage beizukommen war. Wie sich herausstellte, gab es dafür sogar Kurse: In einem Gemeindehaus ein paar Dörfer weiter lernte man bei Kaffee und Brötchen alles über das maulwürfische Leben im Untergrund. Danach ging es ihnen mit Fangeisen an den Kragen. Rivka fand das zu viel des Guten, sie konnte den flauschigen, blinden Knirpsen doch nicht gnadenlos den Garaus machen? Also fuhr sie auf Anraten der Nachbarin – die mit einem Salbeiableger vorbeigekommen war, um sich vorzustellen – zum soundsovielten Mal ins Gartencenter und kaufte eine ganze Palette Kaiserkrone. Ihr Garten würde nach ranzigem Fuchs riechen, das würde die kleinen Scheißerchen schon abschrecken.
Bei allen Gesprächen, die sie bis jetzt mit Fremden geführt hatten, dachte Rivka, während sie das Auto mit dem gelben Zwiebelgewächs volllud, war es hauptsächlich um den Garten gegangen. Die Nachbarin erwies sich als Kräuterexpertin, und ihr Mann, ein pensionierter Beamter, konnte Esse genau anleiten, wie sie die Erde für ihre Tomaten richtig mischte. Ganz liebe Leute, sagte sich Rivka, nachdem sie bei einem etwas steifen Besuch im vollständig durchgekachelten Haus der Nachbarn kein einziges Bücherregal hatte ausmachen können.
Abends nach den ersten Trainingstagen vertiefte sich Esse in die Botanik und gab sich Mühe, das Haus wohnlich zu gestalten. Zuallerletzt kam die Kunst. Erst jetzt, wo die Wohnung hergerichtet, alle Schränke eingeräumt waren, begann sie mit der Kuration; die Tierbilder fanden als Erstes ein neues Habitat, danach ihre gesammelten Drucke. Zum Schluss klappte sie zögernd eine Mappe mit ihren eigenen Fotografien auf. Nachdem sie sich vergewissert hatte, dass Rivka noch im Garten war, schloss sie die Zimmertür und legte die Arbeiten auf dem Boden aus. Andächtig kniete sie sich davor. Sie fühlte sich stark, atmete tief durch. Die Porträts waren an der Westküste der Vereinigten Staaten entstanden, rund um das Meeressäuger-Institut in Oregon, das sie während ihrer Fortbildung zum Jugendcoach besucht hatte. Auf den meisten waren Walschützer zu sehen, auf Booten, mit Eimern, Seilen und Ferngläsern, darunter auch Close-ups ihrer gegerbten Gesichter; ein paar Fotos zeigten das Meer, so wie sie es in Erinnerung hatte, wie es gegen die Felsen tobte.
Lange hatte sie nicht gewusst, ob sie sich die Fotos würde angucken können. Jetzt saß sie mittendrin und guckte. Es ging. Sie dachte an ihre Therapeutin, sie dachte an ihre Mutter, sie konnte ziemlich sicher sagen, dass beim Anblick des weißen Holzhauses, in dem sie mit den anderen Kursteilnehmern gewohnt hatte, nur leise Wehmut aufkam. Sie fand die Fotos gelungen, stellte sie fest, die Farbe stimmte, sie waren technisch und dokumentarisch.
Sie legte die Ausdrucke in die Mappe zurück, alle bis auf einen. Ohne es mit Rivka abzusprechen, nahm sie ihn am nächsten Tag mit in die Stadt und ließ ihn in glattem Holz rahmen. Entschlossen bohrte sie über dem Sideboard ein Loch in die Wand, steckte einen Dübel rein, drehte mit befriedigender Leichtigkeit eine Schraube hinein und hängte das gerahmte Foto auf.
Rivkas Blick blieb sofort am Bauch des Tieres hängen. Sie erschrak, als hätte sie einen toten Fisch auf dem Teppich entdeckt. Das Foto schien zu surren, zu knistern wie ein kaputter alter Fernseher. Unheilvoll schwebte es über dem Sideboard. Esse hatte also die Mappe aufgemacht und mal eben das aufgeladenste Bild rausgesucht, um ihr gemeinsames neues Wohnzimmer damit zu schmücken. Es hing da wie ein gekreuzigter Jesus, der Rivka früher Todesangst eingejagt hatte. Und jetzt betrat Esse lächelnd das Zimmer. »Was sagst du?«
»Das ist Achak«, konstatierte Rivka, wobei sie sich Mühe gab, das Bild möglichst neutral zu betrachten. Es war ein schönes Foto, mit einem gewissen Grad an Abstraktion, wiederkehrenden Formen.
»Ich brauchte das«, sagte Esse.
»Ja?«
Was wusste sie eigentlich von dem Tag, als Esse den Buckelwal Achak fotografierte? Nicht alles. Esse und ihre Mitcoaches waren mit dem Touristenboot des Instituts rausgefahren, das Meer war ruhig. An Bord herrschte die aufgekratzte Stimmung, die zu einer Meldung wie dieser passte. Als Schatten unter der Wasseroberfläche das Herannahen des fünfzehn Meter langen Migranten ankündigten, wurde es in dem großen Gummiboot still. Durch ihre Kameralinse sah Esse kurz darauf, wie Achaks knotiger Rücken sich ein Stück aus dem Wasser hievte und wieder abtauchte. Noch mehrmals durchbrach er schmatzend die Oberfläche. Gerade, als sie sahen, wie sein Schatten davonzog, und sie schon glaubten, es wäre vorbei, schoss der Gigant mit der majestätischen Wucht, wie sie einem Mysticetus zur Ehre gereichte, wieder heraus. Esse, überrumpelt, war zu langsam und bekam nur noch die Schwanzflosse drauf. Doch kurz darauf bot sich die nächste Chance. Kaum sah sie den Schatten sich nähern, stellte sie auf gut Glück scharf, hörte, wie sich Achak mit Gewalt aus dem Wasser stemmte, und fing den taumelnden Riesen ein, kurz bevor er mit einem großen Wumms wieder landete und ihnen eine Ladung kalten, salzigen Schaum ins Boot spritzte. Einige Mitpassagiere lachten wie nach einer Champagnerdusche. Esse wurde still. Sie wischte das Spritzwasser von der Linse und sah Achak nach. Auf dem Weg zurück zur Küste wandte sie das Gesicht von den anderen ab.
»Es ist ein grandioses Foto«, sagte Rivka.
»Aber?«
Rivka stellte sich dichter vor Achak, betrachtete seinen enormen Bauch, seine knotige, abstehende Finne, den Mundwinkel. Es musste kurz nach dem Entstehen dieses Bildes gewesen sein, dass Esse gut zwei Wochen nichts mehr von sich hören ließ, bis auf eine ganz kurze Nachricht, die so untypisch kühl klang, dass Rivka sich Sorgen machte, ihre neue Liebe sei entführt worden.
Das Basketballturnier lag etwas über drei Monate zurück, sie waren schwerstverliebt, wie im Rausch. Neunzig Tage waren sie unzertrennlich gewesen, bis Esse für irgendeinen renommierten Kurs, auf den sie lange gespart hatte, sechs Wochen nach Oregon musste. Rivka brachte sie zum Flughafen und machte sich mit nie gekanntem Vertrauen ans Warten. Stundenlang durchstreifte sie die Stadt, ihr Mausoleum verflossener Lieben, und sie fühlte, das hier war anders, heilig.
Täglich schickten sie einander schmalzig-schmachtende Mails. Rivka staunte selbst über den Strom an Schlüpfrigkeiten, der ihr ungefiltert aus den Tasten floss. Kein Schriftzeichen blieb unbenutzt, kein Körperteil ausgespart. Sie verpasste Deadlines, weil sie nur noch rumlag und masturbierte, das Gesicht ins Telefon gedrückt. Bei aller Euphorie wurde ihr die überseeische Sehnsucht manchmal auch zu viel. Dann weinte sie ohne erkennbaren Grund, wunderte sich über das Durcheinander, das Hormone anrichten konnten.
Dass Esse währenddessen allmählich von etwas Dunklerem durcheinandergebracht wurde, ging ihr erst hinterher auf. Nach und nach hatte sich die Melancholie in ihre Mails geschlichen, stellte Rivka später fest. Esse selbst schrieb nur, sie sei krank geworden, eine heftige Grippe. Während der Rest der Gruppe an Workshops und Wettkämpfen teilnahm, verbrachte sie den ganzen Tag im Bett. Die Schlappheit legte eine allzu vertraute Staubschicht über ihr zartes Glück. Die Verliebtheit verwandelte sich in ein Seifenstück, das sie zu dringend festhalten wollte. Sie entglitt ihr, bekam Dellen und machte ihren Kopf zum Angstgegner. Die Eindrücke von Oregon, so erklärte sie es sich später, nachdem sie sich ein bisschen erholt hatte, waren zu intensiv, zu plastisch und überwältigend, um noch Raum für etwas zu lassen, was virtuell und weit weg war und dessen Echtheit sie nicht mehr überprüfen konnte. Am besten, sie stellte Rivka auf Pause, das war nur fair, sonst machte sie nachher noch alles kaputt.
Rivka kapierte es nicht. Sie fiel in die alte Unruhe zurück. In einem unschönen Ferngespräch wurde aus ihr und Esse das, was sie hasste: zwei Frauen, die in ihrer Befindlichkeitssuppe dümpelten und mit vagen Formulierungen um sich selbst kreisten. So natürlich ihre Verbindung entstanden war, so künstlich kam sie ihr auf einmal vor, und Rivka konnte nicht sagen, was den Unterschied ausmachte, abgesehen von einer zwölfstündigen Flugreise, einer Grippe, einer Buckelwalbegegnung und einem mysteriösen neurochemischen Mix.
In den Büchern über Depression, die sie sich besorgte, stieß sie auf die Metapher vom schwarzen Hund, einem dunklen Begleiter, der einem überallhin folgte. Das Bild wurde häufig Winston Churchill zugeschrieben, war aber, wie weitere Recherche ergab, schon seit dem achtzehnten Jahrhundert in Gebrauch. Ob das Bild sie beruhigte, wusste Rivka nicht, aber es beschäftigte sie. Es war auffällig, dass es sich um ein Tier handelte, einen domestizierten Wolf, Symbol für den Tod und gleichzeitig das treueste Tier der Erde, ein Freund eigentlich. Ein Philosoph argumentierte, man könne besser vom Schatten des schwarzen Hundes sprechen. Ein echter Hund war ihm zu fleischlich, zu biologisch, zu konkret. Bei der Melancholie ging es um die Vorahnung dieser Kreatur, ihre dunkle Projektion.
Vier Monate sollte die Episode dauern. Unter größter Selbstbeherrschung fügte sie sich Esses Wunsch, sie in Ruhe zu lassen. Meine liebe Rif, ich kann dir gerade nicht geben, was du verdienst, so die kurze Nachricht.
Gegen den Schmerz stürzte Rivka sich ins öffentliche Leben, sagte Ja zu jeder Auftrittsanfrage, besuchte alle auch nur ansatzweise interessant klingenden Lesungen, las Sachbücher über neue Wirtschaftsmodelle, Tiersprachen und andere tröstliche Abstraktionen. Mit Single-Männern, die genug Kondition hatten, um bis spät in die Nacht Selbstzerstörung zu betreiben, hing sie in Kneipen ab.
Dass sie schließlich wieder zueinanderfanden, war Rivka zufolge reiner Zufall. Esse war sich da weniger sicher. Sie hatte gerade wieder etwas Zuversicht gewonnen, und die neuen Medikamente taten ihre Wirkung, als sie bei der Lesung eines berühmten Primatologen, zu der ein Freund sie mitgeschleift hatte, auf einmal Rivka in den Saal huschen sah. Esse spürte eine Wärme in sich aufsteigen, bekam Flecken am Hals.
Sie war nicht sie selbst gewesen, erklärte sie Rivka, als sie nach der Affenlesung ziellos zusammen durch die Stadt streiften. Rivka schien sich schwer vorstellen zu können, wie man was anderes als man selbst sein konnte, nickte aber verständnisvoll. Als sie sich wieder küssten, gestand Rivka, dass sie Angst hatte, in alte Muster von Entzug und Belohnung zu verfallen. Esses Hauptangst bestand darin, dass sie diese große Liebe von Neuem enttäuschen musste.
Banger und befangener als früher landeten sie im Bett. Ohne die unbeschwerte Hingabe vom Anfang war es auf einmal ernst. Die Ahnung, dass es jeden Moment wieder zu Ende sein könnte, lag in diesen ersten Wochen zwischen ihnen.





























