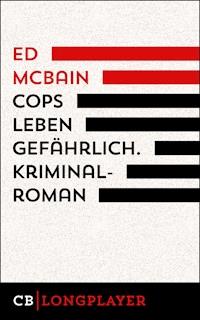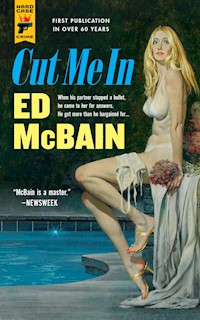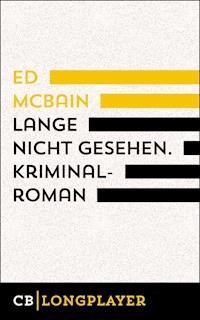6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Das Buch Es ist eine lange, dunkle Nacht in der gigantischen Big City für Carella und seine Kollegen vom 87. Polizeirevier: Der rätselhafte Mord an einer scheinbar verarmten, ehemaligen Konzertpianistin und die Gewaltverbrechen an einer Prostituierten und ihrem Zuhälter halten sie auf Trab. Geschildert wird der Alltag des Reviers und der Alltag der kleinen und großen Ganoven, der Gelegenheitsverbrecher, Dealer, Prostituierten und Mörder, deren Lebenswege sich kreuzen und in kleinen und großen Dramen enden. "Spannend, figurenreich, kühl-ironisch in der Vivisektion von Rassismus, Geldgier, Heuchelei." Tobias Gohlis
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über das Buch
Die Stadt ist riesig. Eine gigantische Big City, von pulsierendem Leben erfüllt. Ein Hexenkessel. Und mittendrin das 87. Polizeirevier.
Es ist eine lange, dunkle Nacht in der gigantischen Big City für Carella und seine Kollegen vom 87. Polizeirevier: Der rätselhafte Mord an einer scheinbar verarmten, ehemaligen Konzertpianistin und die Gewaltverbrechen an einer Prostituierten und ihrem Zuhälter halten sie auf Trab.
Geschildert wird der Alltag des Reviers und der Alltag der kleinen und großen Ganoven, der Gelegenheitsverbrecher, Dealer, Prostituierten und Mörder, deren Lebenswege sich kreuzen und in kleinen und großen Dramen enden.
»Spannend, figurenreich, kühl-ironisch in der Vivisektion von Rassismus, Geldgier, Heuchelei.« Tobias Gohlis
Über den Autor
Ed McBain
Lange, dunkle Nacht
Ein Kriminalroman aus dem 87. Polizeirevier
Impressum
Digitale Neuausgabe: © CulturBooks Verlag 2015
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
www.culturbooks.de
Alle Rechte vorbehalten Deutsche Erstausgabe: 2000, Europa Verlag Originalausgabe: Nocturne, 1997 © Ed McBain
eBook-Cover: Magdalena Gadaj
eBook-Herstellung: CulturBooks
Erscheinungsdatum: 10.08.2015
ISBN: 978-3-944818-99-3
Für Rachel und Avrum Ben-Avi
1. Kapitel
Das Telefon klingelte bereits, als Carella die Dienststelle betrat. Die Wanduhr zeigte 23.45 Uhr.
»Ich bin schon weg«, sagte Parker und kämpfte sich in seinen Mantel.
Carella hob ab. »87. Revier«, sagte er. »Detective Carella.«
Und hörte zu.
Hawes kam in den Dienstraum und blies sich in die Hände.
»Wir sind unterwegs«, sagte Carella und legte auf.
Hawes zog gerade den Mantel aus. »Lass ihn an«, sagte Carella.
Die Frau lag hinter der Wohnungstür. Sie trug noch einen Nerzmantel, der schon längst aus der Mode gekommen war und sich ins Gelbliche verfärbte. Ihr Haar hatte einen Schnitt, den man früher wohl wellenförmig genannt hätte. Silberblaues Haar. Gelbbrauner Nerz. Draußen auf der Straße waren es minus zehn Grad, doch unter dem Mantel trug sie lediglich ein geblümtes Hauskleid aus Baumwolle. Pantoffeln mit hohen, geschwungenen Absätzen an den Füßen. Zerknitterte Strümpfe. Ein Hörgerät im rechten Ohr. Sie musste um die fünfundachtzig gewesen sein. Jemand hatte ihr zweimal in die Brust geschossen. Jemand hatte auch ihre Katze erschossen, eine Tigerkatze mit einem Einschussloch in der Brust und Blut im verfilzten Fell.
Die Cops von der Mordkommission waren vor ihnen eingetroffen. Als Carella und Hawes hereinkamen, diskutierten sie noch, wie es wohl passiert war.
»Die Schlüssel liegen da auf dem Boden, er muss sie in dem Augenblick umgenietet haben, als sie die Wohnung betrat«, sagte Monoghan.
»Schließt die Tür auf – bumm«, sagte Monroe.
Es war kühl in der Wohnung, beide Männer trugen noch ihre Straßenkleidung, schwarze Übermäntel, schwarze Fedoras, schwarze Handschuhe. In dieser Stadt war das Erscheinen der Detectives der Mordkommission am Tatort Vorschrift, auch wenn die eigentliche Ermittlung den Beamten des jeweiligen Reviers zufiel. Monoghan und Monroe sahen sich gern als professionelle Aufseher und Berater, sozusagen als kreative Mentoren. Sie waren der Ansicht, Schwarz sei die passende Farbe für professionelle Berater der Mordkommission. Wie zwei riesige stämmige Pinguine, die Schultern hochgezogen, die Köpfe gesenkt, standen sie da und sahen zu der alten Frau auf dem abgetretenen Teppich hinab. Als Carella und Hawes in die Wohnung kamen, mussten sie um sie herumgehen, um nicht auf die Leiche zu treten.
»Sieh mal, wer da ist«, sagte Monoghan, ohne zu ihnen aufzublicken.
Carella und Hawes froren erbärmlich. In einer Nacht wie dieser pfiffen sie auf jede Beratung oder Beaufsichtigung, ob nun kreativ oder nicht. Sie wollten nur mit ihrer Arbeit anfangen. Der Bereich unmittelbar hinter der Tür stank nach Whisky. Das war das Erste, was den beiden Cops auffiel. Das Zweite war die zerbrochene Flasche in der braunen Papiertüte, die knapp außerhalb der Reichweite der knochigen, arthritischen Hand der alten Frau lag. Die gekrümmten Finger kamen ihnen außergewöhnlich lang vor.
»Habt ihr Party gemacht?«, fragte Monoghan.
»Wir sind schon seit zwanzig Minuten hier«, sagte Monroe garstig.
»’ne große Party?«, fragte Monoghan.
»Der Verkehr«, erklärte Hawes und zuckte mit den Achseln.
Er war ein großer, breitschultriger Mann und trug einen Tweedmantel, den ein Onkel ihm zu Weihnachten aus London geschickt hatte. Jetzt war der 20. Januar, Weihnachten war lange vorbei, der 21. war nur noch einen Herzschlag entfernt – aber im 87. Polizeirevier war Zeit nicht von Bedeutung. Rote Flecke im Stoff des Mantels wirkten wie Funken, die von seinem Haar auf das Material gefallen waren. Auch sein Gesicht war rot, von der Kälte draußen. Eine weiße Haarsträhne über seiner linken Schläfe sah aus wie funkelndes Eis. Diese Farbe hatte seine Furcht gehabt, als vor vielen Jahren ein Einbrecher mit einem Messer auf ihn losgegangen war. Der Arzt in der Notaufnahme hatte ihm das Haar abrasiert, um an die Verletzung heranzukommen und es war weiß nachgewachsen. Die Frauen meinten, das sei sexy. Er erwiderte stets, die Strähne sei schwer zu kämmen.
»Wir nehmen an, sie hat einen Einbrecher überrascht«, sagte Monroe. »Das Schlafzimmerfenster steht noch offen.« Er nickte mit dem Kopf hinüber. »Wir wollten nichts anfassen, bis die Jungs von der Spurensicherung hier sind.«
»Die müssen auch ’ne Party machen«, sagte Monoghan.
»’ne Feuerleiter direkt vor dem Fenster«, sagte Monroe und nickte erneut zum Schlafzimmer. »So ist er reingekommen.«
»Alle machen Party, nur wir nicht«, sagte Monoghan.
»Die alte Lady hier wollte auch feiern, das steht fest«, sagte Monroe.
»Dreiviertelliterflasche mit billigem Fusel in der Tüte«, sagte Monoghan.
»Die muss sie sich geholt haben, als die Schnapsläden noch offen hatten.«
»Es ist Samstag, die haben die halbe Nacht geöffnet«, sagte Monroe.
»Wollte kein Risiko eingehen.«
»Tja, diesbezüglich muss sie sich keine Sorgen mehr machen.«
»Wer ist sie überhaupt, wisst ihr das schon?«, fragte Carella.
Er hatte den Mantel aufgeknöpft, stand nun mit den Händen in den Hosentaschen da und sah zu der Toten hinab. Nur seine Augen verrieten, dass er einen gewissen Schmerz empfand. Er dachte, er hätte fragen sollen: Wer war sie? Weil irgendjemand sie zu nichts weiter als einer Leiche in einer Pfütze billigen Whiskys reduziert hatte.
»Wollte sie nicht anrühren, bis der Leichenbeschauer hier ist«, sagte Monroe.
Bitte, dachte Carella, keine Par...
»Er ist wahrscheinlich auch auf ’ner Party«, sagte Monoghan.
Mitternacht war ohne jede Fanfare gekommen und wieder gegangen.
Aber der Morgen würde ihnen noch sehr lange wie die Nacht vorkommen.
Es überraschte eigentlich niemanden übermäßig, als der Polizeiarzt Schussverletzungen als offensichtliche Todesursache angab. Und zwar, noch bevor jemand von der Spurensicherung zwei verformte Kugeln in der Tür hinter der alten Frau entdeckte und eine weitere in der Fußleiste hinter der Katze. Es schien sich um Kugeln vom Kaliber .38 zu handeln, doch nicht einmal die kreativen Mentoren waren zu einer Spekulation bereit. Der Techniker tütete sie ein und kennzeichnete sie für den Transport ins Labor.
Weder auf dem Fensterbrett noch auf dem Rahmen oder der Feuertreppe draußen fanden sie Fingerabdrücke. Zur allgemeinen Erleichterung kam der Techniker von der Spurensicherung, der draußen gewesen war, wieder herein und machte das Fenster hinter sich zu.
Sie zogen die Mäntel aus.
Der Hausmeister des Gebäudes teilte ihnen mit, die Tote sei Mrs. Helder. Er glaube, sie käme aus Russland oder so. Oder aus Deutschland, er sei sich da nicht sicher. Sie habe seit fast drei Jahren hier gewohnt. Sehr ruhige Mieterin, habe nie Ärger gemacht. Aber er glaube, sie zwitschere wohl ganz gern einen.
Bei der Wohnung handelte es sich um ein sogenanntes Einzimmerapartment. In dieser Stadt waren einige solcher Apartments in Wirklichkeit L-förmige Studios, aber das hier war tatsächlich eine Wohnung mit einem separaten Schlafzimmer, wenn auch einem winzigen. Es lag zur Straße, was insofern ungünstig war, da der Lärm der Autohupen niemals aufhörte und einfach unerträglich war, selbst zu dieser Nachtstunde. Das Haus, in dem Mrs. Helder wohnte, lag an der Lincoln Street, in der Nähe des River Harb und des Fischmarkts, der von Osten nach Westen über vier Häuserblocks an den Docks verlief. Kein besonders attraktiver Teil der Stadt.
Das Team hatte um Viertel vor zwölf den Dienst angetreten und würde wiederum um Viertel vor acht morgens abgelöst werden. Einige amerikanische Städte hatten die sogenannte Friedhofsschicht abgeschafft, weil bei vielen polizeilichen Ermittlungen keine unmittelbare Reaktion erforderlich war. Das galt nicht bei Mordfällen, bei denen jede Verzögerung dem Täter einen nur schwer aufholbaren Vorsprung verlieh. In jenen Städten unterhielt das Polizeipräsidium – oder Central oder Metro Station, welcher Begriff auch immer sich dort durchgesetzt hatte – einen Bereitschaftsdienst und konnte die ihm zugeteilten Detectives innerhalb von einer Minute aus dem Bett klingeln. Nicht so in dieser Stadt. In dieser Stadt fuhr man Schichtdienst und wer an der Reihe war, schob einen Monat lang Morgenschicht, wie sie offiziell hieß. Die Friedhofsschicht, wie sie allgemein und keineswegs liebevoll genannt wurde, brachte die innere Uhr völlig aus dem Rhythmus und versaute einem auch noch das Geschlechtsleben. Jetzt war es fünf Minuten nach Mitternacht. In genau sieben Stunden und vierzig Minuten würde die Tagschicht sie ablösen und die Detectives konnten nach Hause fahren und schlafen. Derweil befanden sie sich in einem winzigen Einzimmerapartment, das nach Fusel und etwas anderem stank, von dem ihnen ganz allmählich aufging, dass es Katzenpisse war. Der Küchenboden war mit Fischknochen und den Überresten zahlreicher Fischköpfe bedeckt.
»Warum er wohl die Katze erschossen hat?«, fragte Monroe.
»Vielleicht hat die Katze gebellt«, vermutete Monoghan.
»Es gibt Bücher, in denen Katzen Mordfälle lösen«, sagte Monroe.
»Es gibt auch Bücher, in denen irgendwelche Amateure Mordfälle lösen«, sagte Monoghan.
Monroe sah auf seine Uhr.
»Habt ihr die Sache hier unter Kontrolle?«, fragte er.
»Klar«, sagte Carella.
»Wenn ihr einen Tipp oder Hilfe braucht, ruft uns einfach an.«
»Und haltet uns auf dem Laufenden.«
»Mit drei Durchschlägen«, sagte Monoghan.
Im Schlafzimmer stand ein Doppelbett, bedeckt mit einer Tagesdecke, die ausländischer Herkunft zu sein schien und einer Kommode, die eindeutig aus Europa stammte, mit verzierten Schubladengriffen und Intarsien an den Seiten und auf der Oberfläche. In den Schubläden stapelten sich Unterwäsche, Söckchen, Strumpfhosen, Pullover und Blusen. In der obersten fanden sie eine Keksdose aus Blech mit Modeschmuck darin.
Im Schlafzimmer stand nur ein Schrank, der mit Kleidern vollgestopft war, die vor gut fünfzig Jahren überaus chic gewesen sein mussten, jetzt aber schrecklich unmodern und, in den meisten Fällen, zerlumpt und ausgefranst wirkten. Aus dem Schrank kam ein leicht muffiger Geruch. Muffigkeit und Alter. Das hohe Alter der Kleidung, das hohe Alter der Frau, die sie einst getragen hatte. Diese Wohnung strahlte eine unbeschreibliche Traurigkeit aus.
Schweigend machten sie sich an die Arbeit.
Im Wohnzimmer stand eine Stehlampe mit Quasten am Schirm.
An den Wänden hingen gerahmte Schwarzweißfotos von fremden Menschen an noch fremderen Orten.
Es gab ein Sofa mit reich verzierten, geschnitzten Beinen, durchgesessenen Polstern und verblichenen Spitzenschonbezügen.
Es gab einen Plattenspieler, auf dessen Teller eine Schellackplatte lag, eine Achtundsiebziger. Carella beugte sich hinab und sah das alte rote Label der Plattenfirma RCA Victor mit dem Bild des Hundes, der in den Schalltrichter eines altmodischen Plattenspielers schaut. Er betrachtete das Label.
Neben dem Plattenspieler stapelten sich auf einem Tisch Achtundsiebziger- und Dreiunddreißiger-Platten.
An einer Wand stand ein Klavier. Die Tasten waren mit Staub bedeckt. Ganz offensichtlich hatte lange niemand mehr darauf gespielt. Als sie den Deckel des Klavierbänkchens aufmachten, fanden sie das Album.
Mit Sammelalben sind immer Fragen verbunden.
Wurde das Buch von der Person angelegt und fortgeführt, mit der es sich beschäftigte? Oder hatte jemand anders es zusammengetragen?
Es gab keinen Hinweis darauf, wer mühevoll und pingelig die zahlreichen Zeitungsausschnitte und anderen Erinnerungsstücke in dem Buch zusammengetragen hatte.
Das erste Souvenir in dem Album war ein Programm der Albert Hall in London, in der eine dreiundzwanzigjährige russische Pianistin namens Svetlana Dyalovich ein triumphales Debüt gefeiert hatte. Unter Leonard Horne als Dirigent der Londoner Philharmoniker hatte sie Tschaikowskys Klavierkonzert Nr. 1 in b-moll gespielt.
Die hier gesammelten Kritiken aus der Londoner Times, dem Spectator und dem Guardian waren überschwänglich. Man nannte sie eine »große Musikerin« und »Virtuosin«, lobte ihr »elektrisierendes Temperament«, ihre »Fähigkeit zu animalischer Begeisterung« und »ihre natürliche Begabung für einen großartigen Höhepunkt des Wohlklangs und grandioser Schnelligkeit«.
Der Kritiker der Times fasste es folgendermaßen zusammen: »Unter Miss Dyalovichs Händen war das Piano wie ein zweites Orchester, fast so strahlend und eloquent wie das erste und ihr Spiel war so gekonnt und superb, so breit gefächert in seiner Farbe und Ausdruckskraft, dass sie sogar den Komponisten überrascht hätte. Hier muss der erstaunlichste Empfang dokumentiert werden, den man seit vielen Spielzeiten einer Pianistin in London bereitet hat, der Auftritt eines neuen Talents, der nicht ignoriert oder heruntergespielt werden kann.«
Sechs Monate später war ein ähnlich triumphales Konzert in der Carnegie Hall in New York gefolgt und dann drei weitere Konzerte in Europa, eins in der Scala in Mailand, eins mit dem Orchestre Symphonique de Paris und das dritte mit dem Concertgebouw Orchestra in Holland. In rascher Folge hatte sie zehn Solistenkonzerte in Schweden, Norwegen und Dänemark und dann fünf weitere in der Schweiz. Sie hatte das Jahr mit Konzerten in Wien, Budapest, Prag, Lüttich, Antwerpen, Brüssel und dann noch einmal in Paris beendet. Es verwunderte kaum, dass das damals vierundzwanzigjährige musikalische Genie im März des nachfolgenden Jahres mit einem Porträt im Time Magazine geehrt wurde. Das Titelbild zeigte eine hochgewachsene blonde Frau in einem schwarzen Abendkleid, die hinter einem Klavier saß. Ihre langen, schlanken Finger ruhten auf den Tasten und auf ihrem Gesicht lag ein zuversichtliches Lächeln.
Sie blätterten weiter.
Die Reaktionen auf ihre Begabung sahen überall auf der Welt gleich aus. Worte wie »atemberaubendes Talent«, »himmelsstürmende Oktaven«, »bezwingende Technik« und »löwenhafter Einsatz und Kraft« fanden sich in allen Kritiken, die im Lauf der Jahre über sie verfasst wurden. Man konnte den Eindruck gewinnen, das Vokabular der Kritiker habe nicht ausgereicht, um die künstlerischen Fähigkeiten dieser phänomenalen Frau zu beschreiben. Mit vierunddreißig Jahren heiratete sie einen österreichischen Impresario namens Franz Helder ...
»Da ist es«, sagte Hawes. »Mrs. Helder.«
»Ja.«
... und brachte im Jahr darauf ihr einziges Kind auf die Welt, das sie Maria nannten, nach der Mutter ihres Mannes. Mit dreiundvierzig Jahren – Maria war damals acht –, genau zwanzig Jahre, nachdem ein junges Mädchen aus Russland die Stadt im Sturm erobert hatte, kehrte Svetlana nach London zurück, um ein Gedenkkonzert in der Albert Hall zu geben. Der Kritiker der Londoner Times legte einen bemerkenswerten Mangel an britischer Zurückhaltung an den Tag, als er die Darbietung als »überaus glücklichen Anlass« bezeichnete und Svetlana dann »einen wilden Wirbelsturm, der in der Steppe entfesselt wurde«, nannte.
Dann folgte eine zehnjährige Pause. »Ich reise nicht gern«, erklärte sie Journalisten. »Ich habe Angst vor dem Fliegen und in Zügen kann ich nicht schlafen. Und außerdem wächst meine Tochter zu einer jungen Frau heran und braucht jetzt mehr Aufmerksamkeit.« Während dieser Zeit widmete sie sich ausschließlich Plattenaufnahmen für RCA Victor, wo sie zuerst ihr Debütkonzert in Wachs pressen ließ, Tschaikowskys Klavierkonzert Nr. 1 in b-moll und dann Brahms’ Klavierkonzert Nr. 1 in d-moll, eins ihrer Lieblingsstücke. Anschließend interpretierte sie Werke von Mozart, Prokofjew, Schumann, Rachmaninow, Beethoven und Liszt und respektierte dabei stets strikt die Intention des jeweiligen Komponisten, eine künstlerische Sensibilität, die einen bewundernden Kritiker zu der Bemerkung hinriss: »Diese Aufnahmen enthüllen, dass Svetlana Dyalovich vor allem eine vollendete Musikerin ist, die bis in das letzte Detail die Vorgaben des Komponisten befolgt.«
Kurz nach dem Tod ihres Mannes kehrte Svetlana mit einem triumphalen Erfolg auf die Konzertbühne zurück, verzichtete aber auf die Carnegie Hall zugunsten des Ortes, an dem sie ihren ersten Erfolg gefeiert hatte, der Albert Hall in London. Die Eintrittskarten für diese eine Comeback-Vorstellung waren in anderthalb Stunden ausverkauft gewesen. Ihre Tochter war damals achtzehn, Svetlana war dreiundfünfzig. Vor den donnernden Standing Ovations spielte sie die Toccata in C-Dur von Bach und Busoni, Schumanns Fantasie in C, Scriabins Sonate Nr. 9 und eine Mazurka, Etüde und Ballade von Chopin. Der Abend war ein absoluter Triumph.
Aber dann ...
Stille.
Nach diesem Konzert vor dreißig Jahren fand sich nichts mehr in dem Album. Als sei diese schillernde, berühmte Künstlerin einfach vom Antlitz der Erde verschwunden.
Bis jetzt.
Eine Frau, die der Hausmeister als Mrs. Helder kannte und die um halb eins am Morgen in der kältesten Nacht dieses Jahres tot auf dem Boden einer kühlen Wohnung lag.
Sie klappten das Album zu.
Das Szenario von Monoghan und Monroe hörte sich nicht unwahrscheinlich an. Die Frau geht aus dem Haus, um sich eine Flasche Whisky zu kaufen. Der Einbrecher kommt durch das Fenster, glaubt, das Apartment sei leer. Die meisten Wohnungseinbrüche finden tagsüber statt, wenn man davon ausgehen kann, dass niemand zu Hause ist. Aber einige »Krippenräuber«, wie man sie nennt, meistens verzweifelte Junkies oder Anfänger, steigen immer dann ein, wenn es sie überkommt, einerlei, ob tagsüber oder nachts, wenn sie nur glauben, etwas holen zu können. Okay, der Typ sieht also kein Licht in der Wohnung, bricht das Fenster auf – obwohl die Labortechniker keine Spuren von einem Brecheisen gefunden hatten –, geht rein und macht sich mit der Bude vertraut, während seine Augen sich langsam an das Dunkel gewöhnen. Dann hört er, wie ein Schlüssel ins Schlüsselloch gesteckt wird, die Tür geht auf und das Licht an und da steht diese erschrockene alte Schachtel mit einer braunen Papiertüte in der einen Hand und einer Handtasche in der anderen. Er gerät in Panik. Erschießt sie, bevor sie schreien kann. Erschießt sicherheitshalber auch noch die Katze. Ein Mann in einer Wohnung auf dieser Etage hört die Schüsse, schreit Zeter und Mordio. Der Hausmeister läuft hoch, ruft die Polizei an. Mittlerweile ist der Einbrecher wieder durchs Fenster raus und schon längst über alle Berge.
»Wollen Sie die Handtasche haben?«, fragte einer der Jungs von der Spurensicherung.
Carella drehte sich von dem kleinen Schreibtisch im Wohnzimmer um, den er gemeinsam mit Hawes durchsuchte.
»Wir sind damit fertig«, sagte der Techniker.
»Fingerabdrücke?«
»Ganz kleine. Müssen vom Opfer sein.«
»Was war drin?«
»Nichts, Sie ist leer.«
»Leer?«
»Der Täter muss den Inhalt auf den Boden gekippt und dann mitgenommen haben.«
Carella dachte kurz darüber nach.
»Er hat sie zuerst erschossen, meinen Sie? Und dann die Tasche aus gekippt und den Inhalt aufgesammelt?«
»Nun ... ja«, sagte der Mann von der Spurensicherung.
Das klang sogar in seinen eigenen Ohren lächerlich.
»Warum hat er sich nicht einfach die Tasche geschnappt und ist damit abgehauen?«
»Sie wissen doch, dass die manchmal komische Sachen machen.«
»Ja«, sagte Carella.
Er fragte sich, ob Geld in der Tasche gewesen war, als die Lady loszog, um ihren Fusel zu kaufen.
»Zeigen Sie mal her«, sagte er.
Der Techniker gab ihm die Tasche. Carella schaute hinein und drehte sie um. Nichts fiel heraus. Er sah noch mal hinein. Nichts.
»Steve?«
Cotton Hawes rief ihn vom Schreibtisch aus.
»Eine Brieftasche«, sagte er und hielt sie hoch.
In der Brieftasche war eine Visa-Karte mit einem Foto von der Frau namens Svetlana Helder in der linken Ecke.
Darin befanden sich auch einhundert Dollar in Zehnern, Fünfern und Ein-Dollar-Scheinen.
Carella fragte sich, ob sie im Schnapsladen um die Ecke anschreiben lassen konnte.
Als sie in den Hausflur traten, sagte eine Frau, die vor der Wohnungstür genau nebenan stand: »Entschuldigung?«
Hawes musterte sie.
Siebenundzwanzig, achtundzwanzig Jahre, schätzte er, schlank und dunkelhaarig, mit leicht exotischen Gesichtszügen, die auf den Nahen Osten oder zumindest den Mittelmeerraum schließen ließen. Sehr dunkle, braune Augen. Kein Make-up, kein Nagellack. Sie hatte einen Wollschal um den Hals geschlungen. Darunter ein Bademantel. Rotkarierte Pantoffeln mit Lammfellfutter an den Füßen. Hier im Hausflur war es etwas wärmer als draußen auf der Straße. Aber nur etwas. In den meisten Gebäuden in dieser Stadt wurde die Heizung um Mitternacht abgestellt. Jetzt war es Viertel vor eins.
»Sind Sie die Detectives?«, fragte sie.
»Ja«, sagte Carella.
»Ich bin ihre Nachbarin«, sagte die Frau.
Sie warteten.
»Karen Todd«, sagte sie.
»Detective Carella. Mein Partner, Detective Hawes. Freut mich, Sie kennenzulernen.«
Sie reichten ihr nicht die Hand. Nicht, weil sie Chauvinisten waren, sondern weil Cops normalen Bürgern nur selten die Hand schütteln. Genau, wie Cops keine Regenschirme bei sich haben. Wenn man einen Typ sieht, der in strömendem Regen an der Straßenecke steht und die Hände in den Hosentaschen stecken hat, ist er mit neunzigprozentiger Wahrscheinlichkeit ein Undercover-Cop.
»Ich war ausgegangen«, sagte Karen. »Der Hausmeister hat mir gesagt, dass jemand sie ermordet hat.«
»Ja, das stimmt«, sagte Carella und beobachtete ihre Augen. Nichts flackerte darin. Sie nickte fast unmerklich.
»Warum sollte ihr jemand etwas antun?«, fragte sie. »So eine sanfte Seele.«
»Wie gut kannten Sie sie?«, fragte Hawes.
»Wir haben uns nur ein paar Mal unterhalten. Sie war eine berühmte Pianistin, wussten Sie das? Svetlana Dyalovich. Unter diesem Namen ist sie aufgetreten.«
Pianistin, dachte Hawes. Eine ausgezeichnete Künstlerin, die es auf das Titelbild des Time Magazine geschafft hatte. Eine Konzertpianistin.
»Ihre Hände waren ganz knotig«, sagte Karen und schüttelte den Kopf.
Die Detectives sahen sie an.
»Die Arthritis. Sie hat mir gesagt, sie hätte ständig Schmerzen. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass man Flaschen mit Schmerztabletten nie problemlos aufkriegt? Das liegt daran, dass in Amerika nur Verrückte leben, die andere Leute quälen wollen. Aber wer sollte ihr schon etwas tun wollen?«, fragte sie erneut und schüttelte den Kopf. »Sie hatte sowieso schon solche Schmerzen. Die Arthritis. Osteoarthritis, um genau zu sein, das hat ihr Arzt dazu gesagt. Ich habe sie einmal begleitet. Zu ihrem Arzt. Er hat mir gesagt, er würde sie auf Voltaren umstellen, weil das Naprosyn nicht mehr wirkt. Er hat ständig die Dosis erhöht, es war wirklich traurig.«
»Wie lange kannten Sie sie?«, fragte Carella.
Eine andere Möglichkeit, sie zu fragen: Wie gut kannten Sie sie? Er glaubte keinen Augenblick lang, dass Karen Todd irgendetwas mit dem Mord an der alten Frau nebenan zu tun hatte, aber schon seine Mutter hatte ihm beigebracht, dass jeder verdächtig sei, bis seine Geschichte aufgeklärt ist. Oder ihre Geschichte. Politisch korrekt müsste es wahrscheinlich sogar heißen: »Jede[r] ist ein[e] Verdächtige[r], bis seine/ihre Geschichte aufgeklärt wurde.« Idioten, die so redeten, hasste Carella noch mehr als irgendwelche harmlosen Spinner, die sich an den Dosen und Flaschen in Supermarktregalen zu schaffen machten. Wir stellen ein: eine/n Polizeichef/in.
»Seit ich hier einzog«, sagte Karen.
»Wann war das?«
»Vor einem Jahr im Oktober. Am fünfzehnten, um genau zu sein.«
Der Geburtstag großer Männer, dachte Hawes, sagte es aber nicht.
»Ich wohne jetzt seit über einem Jahr hier. Vierzehn Monate, um genau zu sein. Sie brachte mir ein Geschenk zum Einzug. Einen Laib Brot und Salz. Das soll Glück bringen. Sie stammte nämlich aus Russland. Da drüben pflegt man die alten Traditionen noch. Hier in Amerika haben wir keine Traditionen mehr.«
Falsch, dachte Carella. Wir haben Mord zur Tradition gemacht.
»Sie war da drüben ein großer Star«, sagte Karen. »Na ja, hier auch, um genau zu sein.«
Ein übler Sprachfimmel, dachte Hawes.
»Sie hat mir Geschichten erzählt, wie sie auf der ganzen Welt vor Königshäusern spielte, um genau zu sein. Sie hatte viele Erinnerungen.«
»Wann hat sie Ihnen diese Geschichten erzählt?«
»Ach, nachmittags. Wir haben dann und wann mal zusammen Tee getrunken.«
»In ihrer Wohnung?«
»Ja. Das war auch eine Tradition. Der Nachmittagstee. Sie hatte ein wunderschönes Teeservice. Ich musste eingießen, wegen ihrer Hände. Wir saßen dann da und hörten uns die Platten an, die sie aufgenommen hatte, als sie berühmt war. Und tranken Tee am Spätnachmittag. Das erinnerte mich irgendwie an T.S. Eliot.«
Mich auch, dachte Hawes, sagte aber wieder nichts.
»Als Sie sagten, Sie hätten nur gelegentlich mit ihr gesprochen«, warf Carella ein, »meinten Sie auch die Besuche in ihrer Wohnung ...«
»Ja, sicher ...«
»... bei denen sie sich gemeinsam ihre Platten angehört haben.«
»Ja. Na ja, sie war auch ein paarmal bei mir. Ich habe sie manchmal zum Abendessen eingeladen. Habe dann alles ein bisschen nett und festlich hergerichtet. Sie war allein und einsam und ... na ja, ich wollte nicht, dass sie zu früh mit dem Trinken anfängt. Abends hat sie immer ziemlich viel getrunken.«
»Ziemlich viel ...?«
»Tja ... um genau zu sein, sie fing schon morgens mit dem Trinken an. Wenn sie wach wurde. Aber abends ... na ja ... manchmal hat sie sich bis zur Bewusstlosigkeit betrunken.«
»Woher wissen Sie das?«, fragte Hawes.
»Sie hat es mir gesagt. Sie war sehr offen zu mir. Sie musste, dass sie ein Problem hat.«
»Hat sie irgendetwas dagegen unternommen?«
»Sie war dreiundachtzig Jahre alt. Was konnte sie dagegen unternehmen? Die Arthritis war schlimm genug. Aber sie hat auch ein Hörgerät getragen. Und in letzter Zeit hatte sie immer öfter Ohrensausen, hörte ein Läuten im Kopf und ein Zischen, wie von einem Kessel. Und manchmal ein dumpfes Dröhnen, wie von schweren Maschinen. Es war wirklich schrecklich. Sie hat mir gesagt, ihr Arzt wolle sie zur Untersuchung zu einem Neurologen schicken, aber sie hatte Angst davor.«
»Wann war das?«, fragte Hawes.
»Kurz vor Thanksgiving. Es war wirklich traurig.«
»Diese Teestunden am Nachmittag, sagte Carella, »diese kleinen Abendessen ... war sonst noch jemand dabei? Außer Ihnen und Miss Dyalovich?«
Irgendwie gefiel ihm das besser als Mrs. Helder. Auf dem Titelbild des Time Magazine, dachte er. Da sollte man nicht als Mrs. Helder enden.
»Nein, nur wir beide. Ich glaube nicht, dass sie irgendwelche anderen Freunde hatte, um genau zu sein. Sie hat mir einmal erzählt, alle Leute, die sie gekannt hatte als sie jung und berühmt war, seien jetzt tot. Sie hatte wohl nur mich. Und die Katze. Sie war furchtbar vernarrt in Irina. Was wird jetzt überhaupt mit ihr? Kommt sie in ein Tierheim?«
»Miss, er hat auch die Katze getötet«, sagte Hawes.
»Ach du großer Gott! Ach du großer Gott!«, sagte Karen und war dann einen Augenblick lang still. »Sie ist jeden Morgen losgegangen und hat ihr frischen Fisch gekauft, können Sie sich das vorstellen? Ganz egal, wie kalt es war, die alte Lady mit ihrer Arthritis. Irina liebte Fisch.«
In ihren braunen Augen standen plötzlich Tränen. Hawes wollte sie in die Arme nehmen und trösten. Stattdessen sagte er: »Hatte sie irgendwelche noch lebenden Verwandte?«
Leute, die wir benachrichtigen müssen, dachte Carella.
Fast hätte er geseufzt.
»Eine verheiratete Tochter in London.«
»Wissen Sie, wie sie heißt?«
»Nein.«
»Irgendjemand hier in den USA?«
»Ich glaube, eine Enkelin irgendwo in der Stadt.«
»Haben Sie sie mal getroffen?«
»Nein.«
»Kennen Sie zufällig ihren Namen?«
»Nein, tut mir leid.«
»Hat Miss Dyalovich je erwähnt, Drohanrufe oder Drohbriefe bekommen zu haben?«
»Nein.«
Zieh das komplette Programm durch, dachte Carella.
»Hat sie je jemanden vor dem Haus herumlungern sehen?«
»Nein.«
»Oder ist ihr jemand gefolgt?«
»Nein.«
»Wissen Sie, ob sie vielleicht Feinde gehabt hat?«
»Nein.«
»Hat sie sich mit jemandem häufiger gestritten?«
»Nein.«
»Hat sie sich überhaupt mal mit jemandem gestritten?«
»Nein.«
»Hat sie sich mit jemandem nicht verstanden?«
»Nein ...«
»Hat sie jemandem Geld geschuldet?«
»Nein.«
»Hat jemand ihr Geld geschuldet?«
»Sie war eine alte Frau, die von der Wohlfahrt lebte. Was für Geld hätte sie verleihen können?«
Gefeiert auf allen Kontinenten, dachte Hawes. Und endet in einem Drecksloch an der Lincoln Street und lebt von der Wohlfahrt. Nippt am Spätnachmittag Tee und Whisky. Hört sich ihre alten Achtundsiebziger an. Die Hände ganz knotig.
»Diese Enkelin«, sagte er. »Haben Sie sie je gesehen?«
»Nein, ich habe sie nie kennengelernt. Das habe ich Ihnen doch gesagt.«
»Ich frage Sie, ob Sie sie je gesehen haben. Wie sie aus der Wohnung nebenan kam? Oder im Hausflur getroffen? Hat sie ihre Großmutter jemals besucht, das frage ich Sie.«
»Oh. Nein, ich glaube, sie sind nicht gut miteinander auskommen.«
»Dann gab es also doch jemanden, mit dem sie sich nicht verstanden hat«, sagte Carella.
»Ja, aber in der Familie«, tat Karen es achselzuckend ab.
»Hat Ihnen Miss Dyalovich gesagt, dass sie nicht miteinander ausgekommen sind?«
»Ja.«
»Und wann?«
»Ach, vor zwei, drei Monaten.«
»Sie kam aus heiterem Himmel darauf zu sprechen?«
»Nein, sie hat sich beklagt, dass ihre einzige Tochter so weit weg wohnt, in London ...«
»Und wie kam sie dann auf die Enkelin?«
»Na ja, sie hat gesagt, wenn sie und Priscilla sich nur verstehen würden ...«
»Heißt sie so?«, fragte Hawes sofort. »Die Enkelin?«
»Oh. Ja. Tut mir leid. Mir fiel der Name nicht ein, bis er über meine Lippen kam.«
»Priscilla und weiter?«
»Das weiß ich nicht.«
»Vielleicht fällt Ihnen das auch noch ein.«
»Nein, ich glaube nicht, dass sie den Nachnamen je erwähnt hat.«
»Das werden wir aus dem Nachruf erfahren«, sagte Carella. »Heute Morgen.«
Es war nun genau ein Uhr.
Der Eigentümer des Schnapsladens erzählte ihnen, Samstag sei der beste Tag. Er machte am Samstagabend in der Stunde vor Ladenschluss mehr Umsatz als sonst im ganzen Jahr. Besser sei nur der Neujahrsabend, sagte er ihnen. Noch besser war es natürlich, wenn der Silvesterabend auf einen Samstag fiel. Da konnte nichts mithalten.
»Bester Abend im ganzen Jahr«, sagte er. »Silvester könnte ich durchgehend geöffnet haben und wäre am Morgen ausverkauft.«
Es war bereits Sonntag, aber dem Besitzer des Ladens kam es noch wie Samstagabend vor. Vielleicht glaubte er sogar, es wäre noch Weihnachten, obwohl sie schon den 21. Januar schrieben. Im Schaufenster blinkte grün und rot ein kleiner Weihnachtsbaum auf. Kleine Ausschneidefiguren aus Pappe hingen an der Decke und wiederholten endlos: MERRY CHRISTMAS. Auf Tischen und Theken standen noch Schnapsflaschen in Geschenkverpackung.
Der Ladenbesitzer hieß Martin Keely. Er war um die achtundsechzig, neunundsechzig Jahre alt, ein kleiner, stämmiger Mann mit einer Trinkernase und dazu passenden Hosenträgern. Er unterbrach immer wieder ihr Gespräch, falls man es so nennen konnte, um Kunden zu bedienen. Zu dieser Nachtstunde verkaufte er hauptsächlich billigen Wein an Penner und Bettler, die mit ihren Tageseinnahmen herein trotteten. Diese Stadt wurde nach Mitternacht eine ganz andere. Man sah andere Leute auf den Straßen und in den Bars und Clubs, die noch geöffnet hatten. In den U-Bahnen und Taxis. Eine ganz andere Stadt mit ganz anderen Menschen.
Einer von ihnen hatte Svetlana Dyalovich ermordet.
»Wissen Sie noch, wann sie hier war?«
»Gegen elf.«
Was mehr oder weniger hinhaute. Der Portier hatte angegeben, die Schüsse um zwanzig nach elf gehört zu haben. Der Hausmeister hatte fünf Minuten später die Polizei angerufen.
»Was hat sie gekauft?«
»’ne Flasche Four Roses.«
Genau die Flasche, die zu Boden gefallen war, als jemand sie erschoss.
»Wie teuer war sie?«
»Acht Dollar und neunundneunzig Cents.«
»Wie hat sie bezahlt?«
»Bar.«
»Passend?«
»Was meinen Sie damit?«
»Hat sie Ihnen genau acht Dollar und neunundneunzig Cents gegeben?«
»Nein, sie gab mir ’nen Zehner. Ich hab ihr das Wechselgeld rausgegeben.«
»Was hat sie mit dem Wechselgeld gemacht?«
»In das kleine Portemonnaie gesteckt, das sie dabei hatte. Sie nahm einen Zehner aus dem Portemonnaie und gab ihn mir. Ich hab ihr einen Dollar und einen Cent rausgegeben. Sie hat das Geld in das Portemonnaie gesteckt.«
»Den Dollar auch in Münzen?«
»Nein, der Dollar war ein Schein.«
»Und Sie sagen, sie hat das Wechselgeld in ihre Handtasche gesteckt?«
»Nein, sie hat es in ihr Portemonnaie gesteckt. Ein kleines Portemonnaie. Für Wechselgeld. Mit so einem kleinen Schnappverschluss oben, den man mit Daumen und Zeigefinger öffnet. Ein Portemonnaie, verstehen Sie?« Er schien sich übermäßig aufzuregen. »Wissen Sie nicht, was ein Portemonnaie ist? Ein Portemonnaie ist keine Handtasche. Ein Portemonnaie ist ein Portemonnaie. Kann denn keiner in dieser Stadt mehr ein Portemonnaie von einer Handtasche unterscheiden?«
»Wo hat sie das Portemonnaie hingesteckt?«, fragte Carella ruhig.
»In ihre Manteltasche.«
»Vom Nerzmantel«, sagte Carella und nickte.
»Nein, sie hat keinen Nerzmantel angehabt. Sie hat einen Stoffmantel getragen.«
Die Detectives sahen ihn an.
»Sind Sie sicher?«, fragte Hawes.
»Hundertprozentig, Einen abgetragenen blauen Stoffmantel. Und ein Kopftuch. Aus Seide, glaube ich. Was auch immer. Hübsch. Hat aber auch schon bessere Tage gesehen.«
»Einen Stoffmantel und ein Seidenkopftuch«, sagte Carella.
»Ja.«
»Sie sagen also, als sie gestern Abend um elf Uhr hier hereinkam und ...«
»Nein, das sage ich überhaupt nicht.«
»Sie sagen, sie hat keinen Stoffmantel und kein Seidenkopftuch getragen?«
»Ich sage nicht, dass sie gestern Abend um elf hier war.«
»Wenn nicht um elf, wann dann?«
»Oh, es war schon elf, klar. Aber elf Uhr gestern Morgen.«
Sie fanden das kleine Portemonnaie in der Tasche eines blauen Stoffmantels, der im Schlafzimmerschrank hing.
Es waren ein Dollar und ein Penny darin.
2. Kapitel
1909 gab es in dieser Stadt vierundvierzig Morgenzeitungen. 1920 gab es nur noch dreißig. Drei Jahre später war diese Zahl wegen des technischen Fortschritts, dem immer härteren Kampf um Auflagen, der Standardisierung der Inhalte, Managementfehlern und natürlich auch wegen der Großen Depression auf lediglich drei gesunken. Heute gibt es nur noch zwei.
Da ein Mörder frei herumlief, wollten die Detectives nicht bis vier, fünf Uhr morgens warten, wenn beide Zeitungen an die Kioske ausgeliefert wurden. Sie hielten es auch nicht für aussichtsreich, bei den Morgenzeitungen anzurufen, denn sie gingen nicht davon aus, dass sie einen Nachruf auf eine Konzertpianistin veröffentlichen würden, ganz gleich, wie berühmt sie vielleicht einmal gewesen war. Später sollte sich herausstellen, dass sie damit völlig falsch lagen. Die Boulevardpresse spielte die Story hoch, wenn auch nur, weil Svetlana nach drei Jahrzehnten des Ruhms in Vergessenheit und Armut gelebt hatte und ihre Enkelin ... Aber das war eine andere Geschichte.
Hawes telefonierte mit dem für die Nachrufe verantwortlichen Redakteur der angeblich besseren Zeitung, einem überaus kooperativen Mann, der ihm den kompletten Nachruf vorlesen wollte, bis Hawes ihm klarmachen konnte, dass er lediglich an den Namen von Miss Dyalovichs überlebenden Verwandten interessiert war. Der Redakteur ging zum letzten Absatz über, in dem stand, dass Svetlana eine Tochter hinterließ, Maria Stetson, die in London lebte und eine Enkelin, Priscilla Stetson, die mitten in dieser üblen Großstadt wohnte.
»Sie wissen doch, wer sie ist, oder?«, fragte der Redakteur.
Hawes dachte, er meine Svetlana.
»Ja, klar«, sagte er.
»Wir konnten es in dem Nachruf nicht erwähnen, weil der ausschließlich der Verstorbenen gilt.«
»Ich kann Ihnen nicht ganz folgen«, sagte Hawes.
»Die Enkelin. Sie ist Priscilla Stetson. Die Sängerin.«
»Ach? Was macht sie denn so?«
»Singt in Nachtclubs. Bars. Cabarets. Und so weiter.«
»Sie wissen nicht zufällig, wo sie momentan singt, oder?«, fragte Hawes.
In dieser Stadt leben viele Obdachlose, die tagsüber schlafen und nachts herumziehen. Die Nacht ist gefährlich für sie. Draußen lauern Raubtiere und ein Heim aus Pappkartons bietet nur spärlichen Schutz vor Raub oder Vergewaltigung. Also wandern sie wie Gespenster durch die Straßen und verleihen der Nacht etwas Unheimliches.
Die Straßenlaternen verbreiten ihr fahles Licht und Ampeln schalten periodisch von Grün auf Gelb und Rot, doch trotzdem kommt einem die Stadt dunkel vor. Hier und da eine einsame Badezimmerlampe. In ansonsten dunklen Wohnhäusern brennen vereinzelte Lampen in den Schlafzimmern der Schlaflosen. Die Bürogebäude sind hell erleuchtet, doch halten sich hier jetzt nur noch die Putzkolonnen auf, die die Schreibtische für den nächsten Arbeitstag in Schuss bringen, der am Montagmorgen um neun Uhr beginnt. An diesem Abend – es kommt einem noch immer wie Abend vor, obwohl der Morgen genaugenommen schon anderthalb Stunden alt ist – sind die Stahltaue der Brücken, die die Flüsse der Stadt überspannen, mit hellen Lichtern geschmückt, die sich im schwarzen Wasser unter ihnen spiegeln. Und doch kommt einem alles fürchterlich dunkel vor, vielleicht, weil die Nacht so leer ist.
Um halb zwei morgens sind die Theaterbesucher schon lange zu Hause und im Bett und die meisten Hotelbars haben schon seit einer Stunde geschlossen. Die Nachtclubs und Discos werden noch bis vier Uhr morgens geöffnet sein, der offiziellen Sperrstunde für den Ausschank alkoholischer Getränke und zu dieser Zeit werden dann die ersten Delis und Imbissstuben öffnen und Frühstück servieren. Die Szene-Clubs werden bis sechs Uhr morgens durchhalten. Doch sonst herrscht in der Stadt Grabesstille.
Dampf zischt aus den Gullydeckeln.
Gelbe Taxis schießen wie stumme Blitze durch verlassene Straßen.
Ein Schwarzweißfoto von Priscilla Stetson stand auf einer Staffelei vor dem Eingang des Café Mouton im Hotel Powell. Die Schrift über dem Foto sah aus, als stammte sie vom Plakat für einen Amateurfilm und sei nachträglich eingefügt worden: Miss Priscilla Stetson. Unter dem Foto verkündete dieselbe Schrift: Täglich, 21-2 Uhr.
Die Frau auf dem Foto hätte Svetlana Dyalovich auf dem Titelbild des Time Magazine sein können. Dasselbe flachsblonde Haar, zum Pony geschnitten, das glatt bis auf die Schultern und auf die Stirn fiel. Dieselben bleichen Augen. Dieselben hohen slawischen Wangenknochen. Dieselbe kaiserliche Nase und dasselbe zuversichtliche Lächeln.
Die Frau, die an dem Klavier saß, war vielleicht dreißig Jahre alt und trug ein langes, schwarzes Abendkleid mit einem gewagten Dekolleté. Eine cremeweiße Hautfläche, die vom Nacken bis zum Busen reichte, wurde an der Kehle von einer silbernen Halskette unterbrochen, die mit schwarzen und weißen Steinen besetzt war. Als die Detectives hereinkamen und sich an die Bar setzten, sang sie gerade »Gently, Sweetly«. An den Tischen in dem ziemlich kleinen, von Kerzenlicht erhellten Raum saßen vielleicht zwei Dutzend Personen. Es war 1.40 Uhr.
Here with a kiss
In the mist on the shore
Sip from my lips
And whisper
I adore you ...
Gently,
Sweetly,
Ever so completely,
Take me,
Make me
Yours.
Priscilla Stetson schlug den letzten Akkord des Songs an, senkte den Kopf und betrachtete ehrerbietig ihre Hände auf den Klaviertasten. Freundlicher Applaus.
»Danke«, flüsterte sie in das Klaviermikro. »Vielen, vielen Dank.« Sie hob den Kopf und warf das lange, blonde Haar zurück. »Ich mache vor den letzten Songs eine kurze Pause. Wenn Sie noch etwas bestellen wollen, bevor wir schließen, haben Sie jetzt Gelegenheit dazu.« Ein breites Lächeln, ein Blinzeln. Sie spulte die rhythmisch prägnante Phrase, mit der sie ihre Auftritte stets beendete, routiniert ab, erhob sich und war gerade auf dem Weg zu einem Tisch, an dem zwei stämmige Männer saßen, als die Detectives von ihren Barhockern stiegen, um sie abzufangen.
»Miss Stetson?«, sagte Carella.
Sie drehte sich lächelnd um, ganz die Künstlerin, die auf einen Bewunderer reagiert. In ihren hochhackigen Pumps war sie vielleicht eins siebzig, eins fünfundsiebzig groß.
Ihre blaugrauen Augen befanden sich fast auf derselben Höhe wie seine.
»Detective Carella«, sagte er. »Das ist mein Partner, Detective Hawes.«
»Ja?«
»Miss Stetson«, sagte er, »es tut mir leid, Ihnen das mitteilen zu müssen, aber ...«
»Meine Großmutter«, sagte sie sofort und wirkte dabei eher gefasst als beunruhigt.
»Ja. Es tut mir leid. Sie ist tot.«
Sie nickte.
»Was ist passiert?«, fragte sie. »Ist sie wieder in der Badewanne ausgerutscht?«
»Nein, sie wurde erschossen.«
»Erschossen? Meine Großmutter?«
»Es tut mir leid«, sagte Carella.
»Großer Gott, erschossen«, sagte Priscilla. »Warum sollte ...?« Sie schüttelte noch einmal den Kopf. »Oh, diese Stadt«, sagte sie. »Wo ist es passiert? Irgendwo auf der Straße?«
»Nein. In ihrer Wohnung. Vielleicht war es ein Einbrecher.«
Vielleicht auch nicht, dachte Hawes, sagte aber nichts, ließ Carella einfach am Ball bleiben. Das war der schwerste Teil der Polizeiarbeit – die Angehörigen eines Opfers zu informieren, dass etwas Schreckliches passiert war. Carella machte es richtig gut, vielen Dank, es war sinnlos, ihn zu unterbrechen. Nicht um Viertel vor zwei morgens, wenn die ganze verdammte Stadt schlief.
»War sie betrunken?«, fragte Priscilla.
Knallhart.
»Wir müssen die Autopsie abwarten«, sagte Carella.
»Wahrscheinlich war sie betrunken«, sagte Priscilla.
»Wir werden es Sie wissen lassen«, sagte Carella. Es kam härter über seine Lippen, als er beabsichtigt hatte. »Miss Stetson«, sagte er, »wenn es so gewesen ist, wie es aussieht, wenn sie einen Einbrecher auf frischer Tat überrascht hat, dann suchen wir eine Nadel im Heuhaufen. Denn dann wäre es ein völlig zufälliges Verbrechen.«
»Ja.«
»Andererseits ... Wenn jemand Ihre Großmutter tot sehen wollte, die Wohnung mit der Absicht betreten hat, sie zu ermorden ...«
»Niemand wollte sie tot sehen«, sagte Priscilla.
»Woher wissen Sie das?«
»Sie war schon tot. Niemand wusste, dass es sie noch gab. Warum sollte sich jemand die Mühe machen, sie zu erschießen?«
»Aber jemand hat es getan.«
»Also ein Einbrecher. Wie Sie gesagt haben.«
»Das Problem ist, dass nichts gestohlen wurde.«
»Was gab es denn zu stehlen?«
»Sagen Sie’s uns.«
»Was meinen Sie damit?«
»In der Wohnung befanden sich keine Wertgegenstände. Aber vielleicht gab es welche. Vor dem Einbruch.«
»Was denn? Die Kronjuwelen des Zaren von Russland? Meine Großmutter besaß noch nicht mal das Schwarze unter den Fingernägeln. Was sie von der Wohlfahrt bekam, ging für Schnaps drauf. Sie war ständig betrunken. Sie war ein erbärmliches altes Miststück, eine abgetakelte Klavierspielerin, die ihre besten Jahre hinter sich hatte und nur noch von ihren Erinnerungen lebte. Ich habe sie gehasst.«
Jetzt hör mal auf, um den heißen Brei zu reden, dachte Carella.
Er mochte diese junge Frau mit ihrem geerbten guten Aussehen und ihrem erworbenen klugscheißerischen Großstadtgehabe nicht besonders. Er wäre am liebsten gar nicht hier, hätte es vorgezogen, gar nicht mit ihr zu sprechen, aber er konnte nun mal keine Einbrüche ausstehen, die sich zu Mordfällen ausweiteten. Also würde er etwas über ihre Großmutter herausfinden, irgendetwas, was der Aufklärung dieses Falls dienen würde, selbst, wenn er ihr dazu Daumenschrauben anlegen und ihr jede Information einzeln aus der Nase würde ziehen müssen. Wenn jemand sie mit Vorsatz ermordet hatte, na schön, dann würden sie nach diesem Jemand suchen, bis die Hölle gefror. Wenn nicht, würden sie zum Revier zurückkehren und dort einen Monat lang warten, ein Jahr, falls nötig auch fünf, bis irgendein drogensüchtiger Einbrecher verhaftet wurde und gestand, eine alte Frau ermordet zu haben, damals, als wir alle noch jung und unschuldig waren. Und bis dahin ...
»Hat noch jemand so empfunden wie Sie?«, fragte er.
»Wie meinen Sie das?«
»Sie haben gesagt, dass Sie sie gehasst haben ...«
»Ach, und? Habe ich sie etwa umgebracht? Jetzt hören Sie aber bitte auf!«
»Alles klar, Priss?«
Carella drehte sich erschrocken um. Der Mann, der neben ihm stand, war einer der beiden, zu denen Priscilla gerade unterwegs war, als sie sie abgefangen hatten. Noch bevor Carella die Schusswaffe in einem Halfter unter dem Jackett des Mannes sah, hatte er ihn als Bodyguard oder Gangster eingestuft. Vielleicht war er auch beides. Er war über eins neunzig groß, brachte wohl zwei Zentner auf die Waage und stand auf den Fußballen da, die Hände halb zu Fäusten geballt, eine Pose, die Carella wissen lassen sollte, dass er ihn in einer Minute zu Brei schlagen konnte, falls es sein musste. Carella glaubte ihm unbesehen.
»Alles in Ordnung, Georgie«, sagte Priscilla.
Georgie, dachte Carella und bereitete sich auf Ärger vor, als er sah, dass der andere Mann sich ebenfalls vom Tisch erhob und auf sie zukam. Auch Hawes war plötzlich auf der Hut.
»Denn wenn diese Herren dich belästigen ...«
Carella ließ in der Hoffnung, damit überflüssige Diskussionen zu beenden, seine Marke aufblitzen.
»Wir sind Polizeibeamte«, sagte er.
Georgie betrachtete die Marke unbeeindruckt.
»Gibt’s hier ein Problem, Georgie?«, fragte der andere Mann, als er sie erreicht hatte. Georgies Zwilling, ohne den geringsten Zweifel. Ähnlich gekleidet, bis hin zu der Hardware unter der breitschultrigen Anzugjacke. Hawes ließ seine Marke ebenfalls aufblitzen. Es konnte nie schaden, etwas zweimal klarzustellen.
»Polizei«, sagte er.
Muss in diesem Schuppen ein Echo geben, dachte Carella.
»Hat Miss Stetson irgendwelche Probleme?«, fragte Georgies Zwilling. Zweihundertzwanzig Pfund Muskeln und Knochen, gehüllt in feinen Zwirn von Giorgio Armani. Keine gebrochene Nase, aber ansonsten war das Klischee komplett.
»Miss Stetsons Großmutter wurde ermordet«, sagte Hawes ruhig. »Hier ist alles unter Kontrolle. Warum gehen Sie nicht einfach wieder an Ihren Tisch zurück?«
In dem Raum erklang Gemurmel. Vier stämmige Burschen, die sich um den Star des Abends scharten – das sah ganz so aus, als würde Ärger ins Haus stehen. Und wenn es eins gab, was die Leute in dieser Stadt nicht mochten, dann war es Ärger. Beim ersten Anzeichen eines Problems rafften die Leute in dieser Stadt ihre Röcke hoch und flohen in die Hügel. Selbst ortsunkundige Besucher (und einige Gäste sahen danach aus) machten, dass sie wegkamen, sobald sie witterten, dass sich Ärger zusammenbraute.
Miss Priscilla Stetson, Täglich 21-2 Uhr, lief eindeutig Gefahr, ihren letzten Auftritt vor einem leeren Saal absolvieren zu müssen. Plötzlich fiel ihr ein, dass sie noch arbeiten musste. »Ich bin dran«, sagte sie. »Wir unterhalten uns später.« Und sie ließ die vier Männer einfach stehen wie bestellt und nicht abgeholt.
Wie die meisten Machonarren, die ihre Männlichkeit erfolglos zur Schau gestellt hatten, starrten die Männer sich noch einen Moment lang an und ließen während des Blickkontakts die Muskeln spielen. Dann gingen die beiden Cops zur Bar zurück und die beiden Typen, die Kanonen mit sich rumschleppten – was auch immer sie sein mochten – zu ihrem Tisch. Priscilla, ganz der reservierte Profi, ignorierte die maskulinen Bedürfnisse, die sie umgaben und sang nacheinander die romantischen Songs »My Funny Valentine«, »My Romance«, »If I Loved You« und »Sweet and Lovely«. Eine Frau an einem Tisch fragte ihren Begleiter, warum man solche Liebeslieder heutzutage nicht mehr schrieb und er antwortete: »Weil man heutzutage Hasslieder schreibt.«
Es war zwei Uhr.
Georgie (oder sein Zwillingsbruder Frankie oder Nunzio oder Dominick oder Foongie) fragte Priscilla, warum sie an diesem Abend nicht den Titelsong aus Der Pate gespielt habe. Sie erklärte ihm freundlich, niemand habe sich den Song gewünscht, küsste beide Männer auf die Wange und schickte sie davon. Als die cleveren Detectives, die sie waren, mussten weder Carella noch Hawes bislang, ob es sich bei ihnen um Leibwächter oder kleine Gangster handelte. Priscilla kam zur Bar.
»Zu spät für ein Glas Sekt?«, fragte sie den Barkeeper. Er wusste, dass sie einen Scherz gemacht hatte und schenkte ihr in eine Sektflöte ein. Im Aufbruch befindliche Gäste kamen, um ihr zu sagen, wie toll sie gewesen sei. Sie dankte ihnen freundlich und schickte sie ihres Weges in den frühen Morgen. Priscilla war kein Star, sie war nur eine gute Sängerin in einer kleinen Bar eines bescheidenen Hotels, aber sie hielt sich gut. An der Art und Weise, wie sie an dem Sekt lediglich nippte, sahen die beiden Cops, dass sie keine Trinkerin war. Vielleicht hatte das etwas mit ihrer Großmutter zu tun. Was sie zurück zu der Leiche in dem schäbigen Nerzmantel brachte.
»Ich habe es Ihnen doch gesagt«, fauchte Priscilla. »Alle ihre Freunde sind tot. Ich könnte Ihnen nicht mal die Namen nennen, selbst wenn ich es wollte.«
»Was ist mit Feinden?«, fragte Carella. »Sind die auch alle tot?«
»Meine Großmutter war eine einsame alte Frau, die allein lebte. Sie hatte keine Freunde, sie hatte keine Feinde.«
»Also muss es ein Einbrecher gewesen sein, was?«, fragte Hawes.
Priscilla musterte ihn, als würde sie ihn zum ersten Mal sehen. Betrachtete ihn von oben bis unten. Rotes Haar mit einer weißen Strähne. Und Brüste wie Kleinkindersärge.
»Das ist Ihr Job, nicht wahr?«, fragte sie eiskalt. »Zu entscheiden, ob es ein Einbruch war oder nicht?«
»Außerdem hatte sie eine Freundin«, berichtigte Carella sie.
»Ach was?«
»Eine Frau, die gegenüber wohnt. Sie hat ihr ihre alten Platten vorgespielt.«
»Also bitte. Sie hat diese alten Platten jedem vorgespielt, den sie beschwatzen konnte, sie sich anzuhören.«
»Sind Sie ihr mal begegnet?«
»Wem?«
»Einer Frau namens Karen Todd.«
»Nein.«
»Wann haben Sie sie zum letzten Mal gesehen?«, fragte Hawes.
»Wir sind nicht besonders gut miteinander ausgekommen.«
»Das haben wir schon kapiert. Wann haben Sie sie zum letzten Mal gesehen?«
»Muss gegen Ostern gewesen sein.«
»Schon eine Weile her.«
»Ja«, sagte sie und verstummte dann plötzlich. »Ich muss wohl meine Mutter anrufen, was?«
»Das wäre vielleicht eine gute Idee«, sagte Carella.
»Ihr erklären, was passiert ist.«
»Hm.«
»Wie spät ist es jetzt in London?«
»Keine Ahnung«, sagte Carella.
»Fünf oder sechs Stunden früher, oder?«
Hawes schüttelte den Kopf und zuckte mit den Achseln.
Priscilla verstummte wieder.
Das Sektglas war mittlerweile leer.
»Warum haben Sie sie gehasst?«, fragte Carella.
»Weil sie sich das selbst angetan hat.«
»Sie konnte nichts für die Arthritis«, sagte Hawes.
»Sie konnte was für den Alkoholismus.«
»Was kam zuerst?«
»Wer weiß? Wen interessiert das? Sie war eine der ganz Großen. Sie endete als Niemand.«
»Feinde?«, fragte Carella noch einmal.
»Ich weiß von keinen.«
»Also muss es ein Einbrecher gewesen sein?«, wiederholte Hawes.
»Wen interessiert das?«, fragte Priscilla.
»Uns«, sagte Carella.
Es war an der Zeit, die Uhr anzuhalten.
Die Zeit lief viel zu schnell, irgendjemand da draußen hatte die alte Frau umgebracht und die Zeit war auf seiner oder ihrer Seite – auf welcher Seite auch immer. Je schneller die Minuten vergingen, desto größer wurde die Entfernung zwischen ihm oder ihr – oder wem auch immer – und den Cops. Also war es an der Zeit, einen Augenblick lang innezuhalten und nachzudenken, an der Zeit, sich ans Telefon zu hängen, an der Zeit, durchzuatmen.
Carella rief zu Hause an.