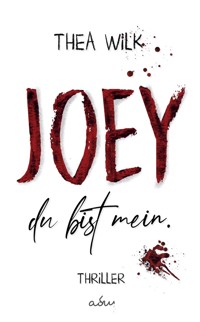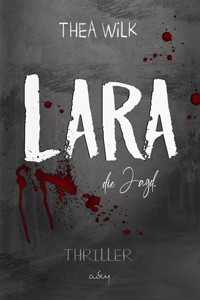4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: adw
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Mitten im Winter. Ein Haus am Meer. An einem menschenleeren Strand. Für Laras Freundin Bobbi klingt es wie das Paradies. Lara selbst möchte das Erbe ihres Großvaters nicht antreten. Sie will nicht in das Haus, aus dem er sie vor achtzehn Jahren verbannt hat. Will den Ursachen für ihre Albträume nicht auf den Grund gehen. Aber sie lässt sich von Bobbi überreden. Und anfangs fühlen sich das kalte Meer und die Einsamkeit richtig an, überlagern das beklemmende Gefühl, das sie beim Anblick der alten Holzmauern überkommt. Bis der Strom ausfällt. Und die Spuren im Schnee nicht mehr nur zu den zwei Frauen gehören ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Epilog
LARA. die Jagd.
LARA. das Ende.
Rezensionen
Über mich
Mein Podcast
Vielleicht war es Liebe.
Vielleicht nur diese Nacht
Vielleicht du und ich
Wenn du wieder gehst
Lu & Nik. Dezember. Ein Jahr später
Lu & Nik. Und Ben. Zwei Jahre später.
Lu & Nik. Drei Jahre später.
Laufe Lebe Liebe.
Nur für diesen Moment.
Siebzehn Jahre. Ohne mich. Mit dir.
Siebzehn Jahre. Ohne mich. Mit dir.
Wenn du wieder gehst
Lu & Nik. Dezember. Ein Jahr später
Lu & Nik. Und Ben. Zwei Jahre später.
Nur für diesen Moment.
Laufe Lebe Liebe.
Jenen, die gelernt haben zu vergeben.
Und jenen, die es noch nicht können.
Prolog
Ich kniete auf dem Boden. Seit Stunden hatte ich mich nicht bewegt. Jedes Gefühl war aus meinen Beinen gewichen. Meine Hände hingen nutzlos neben meinem Körper herab. Die Tränen auf meinen Wangen waren irgendwann getrocknet und etwa zur gleichen Zeit hatte ich aufgehört zu zittern, aber mein Herz raste noch immer. Es klopfte von innen gegen meine Brust, als wolle es mich aus meiner Starre aufwecken, mich zwingen aufzustehen und zu rennen. Zu fliehen vor einer Gefahr, die längst gebannt war. Aber ich konnte es nicht. Die Angst lähmte mich. Hielt mich fest.
Es drangen nur noch ein paar letzte Strahlen des Tageslichts durch das Fenster neben der Tür, aber meine Augen hatten sich an die zunehmende Dunkelheit gewöhnt. Und ich hatte das Bild abgespeichert, von dem ich meinen Blick nicht losreißen konnte, sah es noch immer in den Farben des hellen Tageslichts. Dunkle Flecken auf meinem zerrissenen, rosafarbenen Rock. Ein paar weitere auf meiner Strumpfhose und an meinem linken Oberschenkel, den der kaputte Blümchenstoff nicht länger bedeckte. Sie hatten sich auf meinen Armen und über den dunklen Holzboden verteilt, hatten den kleinen, hellen Teppich ruiniert und sich mit meinen Tränen vermischt.
Sie waren überall. Und ich zwang mich, diese kleineren Flecken zu fokussieren. Ich zwang mich, sie anzustarren, um nicht zur Treppe zu sehen. So lange ich meinen Blick auf dieses Bild richtete, konnte ich verdrängen, was passiert war. Ich konnte mich in den Grenzen meines Blickfeldes verstecken. Ich wusste ohnehin, was mein Blick bei der Treppe finden würde. Noch mehr Blut. Viel mehr Blut. Der metallische Geruch drang in meine Nase und hatte ein übles Gefühl in meinem Magen ausgelöst, das sich seitdem dort hielt.
Ich spürte die Leere, die das Blut an seinem Ursprung, an dem es so lange Leben spendete, hinterlassen hatte. Spürte die Anwesenheit des Körpers, der kein Mensch mehr war, weil ihm dieses Leben im selben Moment entwichen war, in dem ich auf die Knie sank, in dem das Geräusch, mit dem die Waffe zu Boden fiel, den Knall davor übertönte.
Aus den Augenwinkeln nahm ich einen Schatten wahr, der sich vor den Fenstern neben der Haustür vorbeischob. Schwere Schritte begleiteten ihn. Und dann folgten weitere, die leere Stille durchbrechende Geräusche. Die Haustür öffnete sich und ließ das letzte lilafarbene Abendlicht in den Raum fallen. Meine Muskeln fanden endlich ihre Kraft wieder. Ich sprang auf, rannte die wenigen Meter zur Tür und warf mich dem Mann in die Arme, der für all das verantwortlich war.
Kapitel Eins
Dienstag, 3. Dezember
Bobbis nackte Füße hinterließen ein kaum hörbares Geräusch auf den alten Holzdielen. Nicht nur ich kannte inzwischen die Stellen, an denen die Bretter etwas lose waren und jede Berührung ein Knarren verursachte. Bobbi schritt darüber hinweg und trat aus dem Flur in die Küche.
„Guten Morgen.“ Ich legte die Notizen aus der Vorlesung vom Vortag zur Seite. Meinen Blick hatte ich längst der Tür zugewandt. Bobbi war genau mein Typ: etwas kleiner als ich, dunkle, braune Augen und lange, blonde Haare. Ich hatte sie vor fünf Wochen in der Uni kennengelernt, als ich mich aus einem aufdringlichen Anmachversuch kurz vor einer Anglistik-Vorlesung befreien wollte. Sie lud mich auf einen Kaffee ein, den ich bezahlte. Immerhin hatte sie mich gerettet. Und später aßen wir zu Abend. In ihrer Wohnung. Und als wir am nächsten Morgen gemeinsam in ihrer Küche frühstückten, spürte ich, wusste ich, dass diese Begegnung besonders war. Dass sie etwas verändern würde.
Ich hatte mich nicht verliebt. Noch nicht. Aber sie übte einen Reiz auf mich aus, den ich bei anderen Frauen bisher nicht hatte finden können. Wir trafen uns seit unserem Kennenlernen fast täglich. Ich rutschte schon immer schnell in Beziehungen hinein, hatte noch nie verstehen können, warum man etwas langsam angehen sollte, das sich so gut anfühlte. Welchen Grund konnte es geben, einen Menschen erst mühselig über Monate hinweg kennenzulernen, nur um dann herauszufinden, dass man nicht zueinander passte, wenn man sich öfter als zweimal in der Woche sah?
Sie durchquerte die Küche und trat zu mir an den Tisch. Ich wollte mich erheben, um ihr einen Kuss zu geben und einen Kaffee einzuschenken, aber sie drückte mich zurück auf den Stuhl und setzte sich rittlings auf mich. „Guten Morgen!“ Ihre Lippen legten sich zärtlich auf meine, nur um im nächsten Augenblick zwischen sie zu drängen. Ich erwiderte den Kuss. Hungrig.
„Hast du gut geschlafen?“ Sie löste sich nicht von mir. Ihre Hüfte rutschte näher an meine und ihr Atem drang heiß in meinen Mund.
Ich ließ meine Hände auf ihr Becken und von dort aus unter das dünne Shirt mit den schmalen Trägern zurück nach oben gleiten, strich über ihren Bauch, ihre Brüste und spürte erregt, wie sie auch ihre Hände über meinen Körper gleiten ließ. Ich wollte ihr nicht antworten. Wollte ihr nicht von dem Traum erzählen, der mich seit achtzehn Jahren in unregelmäßigen Abständen aus dem Schlaf riss. Jetzt wollte ich sie spüren, wollte ihre Hände in meiner Mitte fühlen, ihre Lippen auf dem Rest meines Körpers.
Doch als ich ihr das Shirt über den Kopf zog, nahm ich ein Geräusch wahr. Ich wollte es ignorieren, aber das Handyklingeln brach nicht ab.
„Lara, dein Telefon klingelt.“ Ein Lächeln lag auf ihren Lippen und ich zog sie fester an mich.
„Egal, dafür habe ich eine Mailbox.“
Das Klingeln verstummte, ertönte aber nach wenigen Sekunden erneut. Ich seufzte und löste mich von Bobbis Lippen.
„Es scheint wichtig zu sein.“ Sie griff nach dem Telefon und reichte es mir.
Ich zuckte mit den Schultern und sah auf das Display. Die Nummer war keinem Eintrag in meiner Kontaktliste zugeordnet. Der Anruf kam aus einer anderen Stadt und es dauerte ein paar Sekunden, bis ich erkannte, welche Verbindung ich zu ihr hatte.
„Ja, bitte.“ Meine Mutter hatte immer darauf bestanden, dass ich mich bei unbekannten Anrufern nicht mit meinem Nachnamen meldete. Ich hatte es nie verstanden, befolgte den Rat aber noch immer widerstandslos.
Ich hörte verschiedene Geräusche am anderen Ende der Leitung und dann eine weibliche Stimme, die mich begrüßte und fragte, ob ich Lara Béyer wäre.
Ich bejahte, ignorierte, dass sie die Buchstaben é und y fälschlicherweise zu einem ‚ei‘ zusammenzog, und die weibliche Stimme sprach weiter: „Ich bin Schwester Barbara aus dem Pflegeheim ‚Wolke Sieben‘. Es geht um Ihren Großvater.“ Wolke Sieben. Ich hatte den Namen des Pflegeheims seit über einem Jahr nicht mehr gehört. Meine Mutter hatte es für meinen Großvater ausgewählt, nachdem er vor anderthalb Jahren beinahe das kleine Haus am Meer angezündet hatte. Die Ärzte hatten ihm irgendeine Form von Demenz diagnostiziert. Ich wusste nicht, welche. Meine Mutter hatte sich um die Formalitäten gekümmert und ich hatte nicht weiter nachgefragt.
Mein Großvater und ich standen uns nicht besonders nah. Doch das war nicht immer so. Laut meiner Mutter hatte ich jedes Jahr einige Wochen bei ihm verbracht. Ich wurde sogar in seinem Haus geboren und sie erzählte mir immer wieder von der besonderen Bindung, die wir in meiner Kindheit zueinander hatten. Aber seit ich etwa sieben Jahre alt war, wollte er mich nicht mehr bei sich haben. Meine Mutter hatte mir nie erklären können, wie es zu dem Bruch kam. Sie beharrte darauf, den Grund selbst nicht zu kennen.
Was ich aber wusste, war, dass zur selben Zeit meine Albträume begonnen hatten. Träume, die nicht meine Erinnerungen abbildeten, sondern einen Teil meiner Seele, auf den ich im wachen Zustand nicht zugreifen konnte. Wenn ich die Augen nicht sofort öffnete, hallten Angst und Hilflosigkeit für einen kurzen Moment nach. Aber danach war der Traum nur ein nicht fassbarer Gedankenfetzen. Und ich hatte nie versucht, seine Einzelteile zu greifen, greifbar zu machen.
Ich wusste nicht, ob die Träume mit meinem Großvater zusammenhingen. Ich hatte ihn nie gefragt. Vielleicht hatte ich zu viel Angst vor der Wahrheit. Vielleicht war ich aber auch immer das siebenjährige Mädchen geblieben, das sich von seinem engsten Verbündeten zurückgestoßen fühlte. Auch wenn ich diese Verbundenheit nur aus Erzählungen kannte. Zumindest hatte ich ihn seit dem Sommer, in dem ich sieben Jahre alt war, nur noch zwei weitere Male gesehen. Am Tag der Beerdigung meiner Mutter vor vierzehn Monaten und kurz darauf.
„Mein Großvater? Was ist mit ihm?“ Ich schloss die Augen und biss mir auf die Unterlippe, als könnte ich die Gleichgültigkeit in meiner Stimme auf diese Weise zurücknehmen. „Ich meine, ist alles okay mit ihm?“
Sie zögerte und da wusste ich, warum sie anrief. „Es tut mir wirklich sehr leid, Ihnen diese Nachricht überbringen zu müssen.“ Ihre Stimme war sachlich und eine Spur zu genervt. Mitleid wollte sie auf diese Weise ganz sicher nicht zum Ausdruck bringen. Ich konnte es ihr nicht verübeln. Sicher hielt sie mich für eine dieser furchtbaren Enkeltöchter, die ihre Großeltern ganz bewusst und aus purer Ignoranz vor sich hinvegetieren ließ und nie die Zeit aufbrachte, um sie zu besuchen. Zumindest musste sie das daraus schließen, dass sie und ich uns kein einziges Mal begegnet waren.
Ich hatte meinen Großvater seit dem Tod meiner Mutter ein einziges Mal besucht. Wenige Wochen nachdem wir die Urne mit ihrer Asche in ein Loch auf einer grünen Wiese sinken lassen hatten, war ich bei ihm gewesen. Ich war seine letzte lebende Verwandte. Und er der letzte Mensch, der mir von meiner Familie geblieben war. Ich hatte das Gefühl gehabt, wir müssten in irgendeiner Form füreinander da sein. Ich hatte gedacht, dass vielleicht nun der Zeitpunkt gekommen war, an dem wir die Vergangenheit überwinden und zueinander zurück finden könnten. Ich hatte mich getäuscht.
Er schickte mich weg. Und noch immer war ich schockiert darüber, wie er mich aus seinem Zimmer geschoben und mir erklärt hatte, er wolle mich nie wieder sehen. Der Ausdruck in seinen Augen wirkte nicht wie der eines verwirrten, kranken Mannes, der seine Enkeltochter nicht erkannte. Nein, der Ausdruck in seinen Augen war entschlossen. Entschlossen, mich aus seinem Leben fernzuhalten. Also befolgte ich seinen Wunsch. Beziehungsweise war ich ihm bisher gefolgt, denn nun war es zu spät, um dagegen anzukämpfen.
„Er ist gestorben.“ Ich sagte es leise, nachdem ich zweimal geschluckt hatte. Ich wusste noch nicht, wie ich mich fühlen sollte.
Die Frau am anderen Ende der Leitung seufzte leise. „Ja. Ja, das ist er. Es tut mir wirklich leid.“ Nun klangen ihre Worte tatsächlich etwas mitfühlend.
„Danke.“
Und dann schwiegen wir. Es war ein unangenehmes Schweigen. Und die Tatsache, dass auf meinem Schoß eine blonde, elfengleiche Frau saß, die ich noch vor wenigen Minuten ihres sehr dünnen, fast durchsichtigen Shirts entledigen hatte wollen, verbesserte die Situation nicht. Bobbi sah mich fragend an und ich formte das Wort ‚Großvater‘ mit den Lippen. Ihre Augen weiteten sich. Ich sah, wie sie schluckte, und dann legte sie die Hand auf den Mund. Ich lächelte, gerührt darüber, dass sie der Tod meines letzten Angehörigen deutlich mehr traf als mich.
Sie stellte die Füße auf den Boden und erhob sich. Meine Beine fühlten sich leer und kalt an und ich wünschte, ich würde meinen Vorsatz, das Telefon erst dann einzuschalten, wenn ich das Haus verließ, häufiger befolgen. Nun musste ich irgendeine Frage stellen, die das Gespräch mit Barbara wieder in Gang brachte. Ich fand keine.
Die Frau aus dem Altersheim räusperte sich. „Also, Ihr Großvater hat klare Anweisungen gegeben, wie seine Bestattung ablaufen soll. Die Kosten dafür sind bereits bezahlt. Er wünscht keine Trauerfeier und auch keine Anwesenheit Ihrerseits bei der Beisetzung.“ Ihre Worte drangen nun wieder ohne jede Emotion durch die Leitung und ich fragte mich, wie viele dieser Gespräche sie jeden Tag führte, heute vielleicht schon geführt hatte.
Gab es in einem Altersheim Menschen, die speziell dazu abbestellt wurden, Angehörige im Todesfall zu kontaktieren? Und wenn ja, hatte man niemand Einfühlsameres für diesen Job finden können? Anderseits war ich fast dankbar dafür, dass am anderen Ende der Leitung niemand künstlich Trauer in mir provozierte.
Ich schluckte und sagte: „Okay.“ Weil es okay war. Ich war froh darüber, nichts mit den Formalitäten zu tun zu haben. Und auch wenn es mich schockierte, dass er mich nicht einmal in diesem Moment bei sich haben wollte, akzeptierte ich seinen Wunsch. Was hätte ich auch anderes tun sollen?
„Sonst gibt es keine weiteren Anweisungen.“
„Was meinen Sie damit?“
„Nun ja, …“ Sie räusperte sich erneut und ich biss mir auf die Lippen, um sie nicht darauf hinzuweisen, dass sie ihren Hals auf diese Weise nur weiter reizte. „Normalerweise …“ Der Ausdruck von leichter Unsicherheit in ihrer Stimme wechselte zu einem routinierten Tonfall. „Da Sie seine einzige Angehörige sind, ist es Ihre Aufgabe, seine Sachen aus seinem Zimmer zu räumen. Außerdem fallen Ihnen laut einem Brief, den wir in seinen Unterlagen fanden, auch seine Besitztümer zu.“ Nun machte ihr Tonfall deutlich, dass sie mit diesem Reglement alles andere als zufrieden war.
„Besitztümer?“ Ich konnte mir nicht vorstellen, dass mein Großvater über irgendwelches Eigentum verfügte, das man als Besitztum deklarieren konnte. Andererseits hatte ich auch keine Ahnung, dass er genug Geld gehabt hatte, um seine eigene Bestattung vorzufinanzieren. Und wer zahlte eigentlich die Kosten für das Pflegeheim?
„Ja Besitztümer. Aber mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Es ist nicht meine Aufgabe, mit Ihnen über diese Details zu sprechen.“
Ich nickte, sagte wieder „Okay“, und fragte: „Können diese … diese Besitztümer nicht gespendet werden? Wie Sie wahrscheinlich wissen, wollte mein Großvater mich nicht sehen.“ Aus irgendeinem Grund war es mir wichtig, diesen Punkt klarzustellen. „Ich glaube nicht, dass er wollte, dass ich sein Erbe antrete.“
Vielleicht irrte ich mich, aber ihre Stimme klang ein wenig sanfter, als sie mir antwortete. „Das müssen Sie entscheiden. Am besten besprechen Sie diese Angelegenheit mit einem Anwalt. Ihr Großvater hat eine Visitenkarte zu seinen Bestattungsanweisungen gelegt. Ich denke, dieser Mann kann Ihnen weiterhelfen.“ Sie zögerte und räusperte sich schon wieder. Sie sollte etwas trinken. „Ich bitte Sie, seine Sachen schnellstmöglich abzuholen. Das Zimmer muss geräumt werden. Ich weiß, das klingt hart. Aber wir haben eine lange Warteliste und die Menschen, die in dieser Schlange stehen, haben dafür nicht ewig Zeit. Und viele können gar nicht mehr stehen.“ Sie lachte spitz auf, schien sich dann aber zu besinnen. „Wie dem auch sei. Wann können Sie vorbeikommen, um die Sachen abzuholen?“
Ich wollte keine Sachen abholen. Ich wollte keine Besitztümer erben und ich wollte nicht diesen Anwalt anrufen. Aber am allerwenigsten wollte ich dieses Gespräch weiterführen. Also nannte ich Barbara das Datum des folgenden Samstags, ließ mir die Nummer des Anwalts geben, bedankte mich für das Gespräch und tippte auf das rot umrandete Hörer-Symbol auf meinem Display.
Kapitel Zwei
Freitag, 6. Dezember
Er klang eigentlich ganz nett.“ Ich legte mein Telefon auf die Holzplatte neben die Tasse Cappuccino, zog meine regennasse Jacke aus und hängte sie über die Stuhllehne. Dann setzte ich mich zu Bobbi an den Tisch. „Etwas jung vielleicht.“ Ich hatte mich heute Morgen endlich dazu durchgerungen, den Anwalt meines Großvaters anzurufen. Er hatte den Anruf nicht angenommen, mich aber soeben zurückgerufen. Um dieses Gespräch nicht in dem gut gefüllten Café zu führen, hatte ich es draußen im Regen getan.
Sie grinste mich verschwörerisch an. „Vielleicht ein Erbschleicher.“
Ich hob meine Tasse an und schlürfte etwas Milchschaum. „Vielleicht.“ Ich erwiderte ihr Grinsen nicht. Tatsächlich war das gar nicht so unüblich, wie er mir selbst erklärt hatte.
„Na, du kannst sein Alter ja bald in persona überprüfen.“
Ich schüttelte den Kopf. „Nein, wir haben beschlossen, dass ein Treffen nicht notwendig ist. Er kümmert sich um alles. Die Ämter und Versicherungen wissen schon über den Tod meines Großvaters Bescheid und auch sonst gibt es nichts für mich zu tun. Er schickt mir alle Unterlagen per Post zu.“
„Per Post? Na zumindest das klingt seriös.“ Sie hob eine Augenbraue.
Ich stellte die Tasse zurück auf den Tisch und musterte sie. „Zweifelst du etwa an ihm?“
Ihre Augen weiteten sich leicht und sie errötete etwas. „Nein, natürlich nicht. Wenn dein Großvater ihn ausgewählt hat, wird das seinen Grund haben.“
Ich zuckte mit den Schultern. Ich konnte keine Auskunft über die Beweggründe oder den Geisteszustand meines Großvaters geben.
„Und was hat er nun gesagt?“
Ich schlang die Arme um meinen Oberkörper. Obwohl wir direkt neben der Heizung saßen, war die Luft im Café kalt. Der Dezember zeigte sich von der unfreundlichsten Seite. Die Luft fühlte sich so eisig an, als wäre sie kalt genug für Schnee. Aber es regnete. Seit Tagen. Die wenigen Stunden, in denen die Sonne den Tag hätte erhellen können, waren wegen der grauen Wolken so dunkel, dass es unmöglich war, den Alltag ohne künstliches Licht zu meistern.
„Ist dir kalt?“
Ich nickte und Bobbi rutschte ihren Stuhl näher zu meinem, um ihren Arm um mich legen zu können. Ich kuschelte mich in ihre Umarmung und trank einen Schluck Cappuccino. „Offensichtlich verfügte mein Großvater über einige Aktienpakete. Er muss sie sich irgendwann in den Achtzigern und Neunzigern zugelegt haben. Ein paar davon sind nichts mehr wert. Aber er hat auch auf einige Firmen gesetzt, ohne die wir heute nicht mehr leben können.“ Ich deutete auf mein Handy.
Ich sah Bobbis Gesicht nicht, nahm jedoch an, dass der Ausdruck erstaunt war. Ihre Aussage passte dazu. „Wow.“
„Ja. Na ja, der Anwalt riet mir, alles so zu lassen, wie es jetzt ist, und mich irgendwann mit einem Experten darüber zu unterhalten. Er sucht jemanden für mich.“ Ich wollte das Geld von meinem Großvater nicht. Es fühlte sich nicht richtig an und ich konnte mir nicht vorstellen, dass es in seinem Sinn war, damit meine nächsten Studiensemester zu finanzieren, in denen ich von einem Hauptfach zum anderen wechselte. Immer in der Hoffnung, etwas zu finden, das mich so sehr faszinierte, dass ich einen Abschluss darin machen wollte.
„Aber das wirst du nicht tun, oder?“ Sie verstand mich und es wunderte mich wieder einmal, wie nah ich mich ihr fühlte. Nach nicht einmal sechs Wochen vertraute ich ihr diese Details an. Aber mit wem hätte ich auch sonst darüber sprechen sollen? Meine Mutter und ich hatten den Wohnort einmal im Jahr gewechselt, weil sie jedes Mal, wenn es mit einem Mann nicht geklappt hatte, die Flucht ergriffen hatte und irgendwo komplett neu hatte anfangen wollen. Und ich hatte dieses Muster fortgesetzt, abgesehen von den Männern. Mein letzter Umzug lag vier Monate zurück und ich kannte niemanden in dieser Stadt außer den Leuten von meiner Uni. Und Bobbi.
„Vermutlich nicht.“
„Sind das alle seine Besitztümer?“ Sie betonte das Wort genau so, wie ich es gegenüber Barbara getan hatte, und ich lächelte.
„Nein. Er hat immer noch das Haus am Meer, in dem ich geboren wurde und wo ich ihn später laut meiner Mutter als Kind ein paar Mal besucht habe.“ Damals, als er mich noch hatte sehen wollen.
„Ein Haus am Meer?“ Sie löste die Umarmung, drehte mich zu sich und sah mich mit großen Augen an.
Ich lachte auf. „Du bist ja ganz aufgeregt.“
Sie nickte und strahlte. „Ja, ja, das bin ich. Ich liebe das Meer. Besonders zu dieser Jahreszeit. Es ist so unglaublich schön, wenn der Strand verlassen ist und der kalte Wind einem um die Nase herumpfeift. Ich liebe es, nach einem langen Spaziergang am Strand einen heißen Tee zu trinken und ein gutes Buch zu lesen.“ Ihr Lächeln wurde anzüglich. „Oder den Rest des Tages ohne Buch und ohne Tee im Bett zu verbringen. Oh, können wir hinfahren?“
Ich presste die Lippen aufeinander. Das klang gut. So gut, dass ich fast Ja gesagt hätte. Aber dann fiel es mir wieder ein. Ich wollte nicht in dieses Haus. Kurze Zeit, nachdem ich meine letzten Ferien dort verbracht hatte, hatten meine Albträume begonnen und ich wollte ihnen noch immer nicht auf den Grund gehen.
„Oh, Lara, bitte!“ Und dann wurden ihre Augen noch größer. „Wir könnten die Weihnachtstage dort verbringen. Wir könnten irgendwo einen Baum kaufen, leckeres Essen kochen und das neue Jahr mit einem eisigen Bad in den Wellen begrüßen. Bitte, bitte, bitte.“
„Das Haus steht seit fast anderthalb Jahren leer. Und mein Großvater war sicher kein Putzkönig. Vermutlich werden uns Spinnen so groß wie Aragogs Kinder begrüßen und riesige Ratten krabbeln aus allen Löchern, wenn wir den Käse auf den Frühstückstisch stellen.“ Ich verzog das Gesicht
„Dann frühstücken wir im Bett.“ Sie kräuselte die Stirn. „Und vielleicht gibt es ja auch jemanden, der sich um das Haus kümmert. Deine Mama hat das Haus bestimmt nicht verrotten lassen wollen.“ Sie klatschte in die Hände. „Und wenn nicht, übernehmen wir diese Aufgabe. Wir kaufen einen Besen, ein paar Mausefallen und Putzmittel. Wir bringen dein neues Haus auf Vordermann. Ach, komm schon. Das wird großartig. An der Küste ist das Wetter auch besser.“ Sie sah mit einem gequälten Gesichtsausdruck zu dem großen Fenster hinaus, das die komplette Wand neben der Tür einnahm. Eigentlich waren es mehrere Glasscheiben, die man wie eine Ziehharmonika aufschieben konnte. Und die Ritzen zwischen den Scheiben waren der Grund, weshalb es hier so kalt war.
Ich atmete tief ein und schloss die Augen. „Ich mag keine Mausefallen.“ Aber sie hatte recht. Ich hatte keine Lust, zwei freie Wochen in diesem grauen Niesel-Schmutzmatsch zu verbringen. „Okay.“ Ich flüsterte.
Bobbi packte mein Gesicht und ich öffnete die Augen, nur um im nächsten Moment aufzulachen. „Du siehst aus wie ein fünfjähriges Mädchen, dem ich gerade erlaubt habe, zum dreißigsten Mal die ‚Eiskönigin' zu gucken."
Sie schüttelte grinsend den Kopf. „Oh, nein. Ich sehe aus, wie ein dreijähriges Mädchen, das die ganz echte Elsa endlich auf Schloss Arendelle treffen darf.“
Am nächsten Tag fuhr ich mit Bobbis Auto in das Pflegeheim meines Großvaters. Ich hatte kein eigenes und sie hatte mir angeboten, ihres zu nehmen. Sie hatte auch angeboten mitzukommen, doch ich wollte dieses Erlebnis allein hinter mich bringen. Ich hatte keine Ahnung, wie ich auf seine Sachen reagieren würde. Bisher hatte ich keine Tränen vergossen. Um ehrlich zu sein, hatte ich kaum an seinen Tod gedacht. Oder an ihn. Ich spürte, dass es mich irgendwie hätte treffen müssen, aber ich fühlte nichts. Sollte es zwischen meinem Großvater und mir jemals ein Band gegeben haben, dann war es verschwunden oder gerissen oder er hatte es mir vor die Augen gebunden.
Ich konnte mich zumindest nicht daran erinnern, dass wir uns einmal nahegestanden hatten. Eigentlich konnte ich mich überhaupt nicht an ihn oder an unsere gemeinsame Zeit erinnern. Ich war schließlich erst sieben Jahre alt gewesen, als ich ihn das letzte Mal besucht hatte.
Das Pflegeheim lag etwa eine Stunde von der Stadt entfernt, in der ich wohnte. Ich hatte mich nicht bewusst für diese Nähe entschieden. Mein Studienwunsch und mein schlechter Notendurchschnitt bei meinem Schulabschluss hatten mir keine andere Wahl gelassen.
Ich erreichte den Parkplatz gegen zehn Uhr am Vormittag, stieg mit zwei großen, leeren Einkaufstaschen über den Schultern aus dem Auto und steuerte auf das Gebäude zu. Und ich war nicht die Einzige. Außer mir befanden sich mehrere Familien, ein paar einzelne Erwachsene mit und ohne Hunde, sowie zwei Paare auf dem Weg zum Eingang oder wartend mit einer Zigarette in der Hand davor. Im Gegensatz zu mir trugen die meisten von ihnen Blumen oder nett verpackte Geschenke mit sich.
Mich überkam kein schlechtes Gewissen bei diesen Bildern. Und dafür gab es schließlich auch keinen Grund. Es war nicht meine Entscheidung gewesen, dass ich keinen Scotch für meinen Großvater an den Pflegerinnen vorbei geschmuggelt hatte.
Obwohl ich nur ein einziges Mal hier gewesen war, fand ich die Etage, auf der mein Großvater seine letzten Monate verbracht hatte, problemlos. Barbara war nicht da. Überhaupt war nur eine einzige Person anwesend, die nicht wie ein Besucher oder Bewohner aussah. Sie trug eine weiß-rosafarbene Uniform und ein strahlendes Lächeln auf dem Gesicht.
Das Mädchen, das nicht älter als achtzehn sein konnte, brachte mich in das Zimmer meines Großvaters. Es lag in der Mitte eines Ganges, an dessen mintgrünen Wänden fröhliche Bilder hingen. Ich sah Drucke, die Makroaufnahmen von Marienkäfern, Laubfröschen und Bienen zeigten. Dazwischen fanden sich selbst gemalte Bilder und Fotos von Katzenbabys und anderen Tieren.
Wir passierten drei weitere Zimmer auf dem Weg. Aus zwei von ihnen dröhnten verschiedene Fernsehprogramme bis auf den Flur hinaus. Das eine war eine Seifenoper, wie die dramatische Musik, die zwischen den Sprechphasen gespielt wurde, eindeutig erkennen ließ. Auf dem anderen Fernseher lief das Programm eines Shoppingkanals. Hinter der Tür des dritten Zimmers war es still. So wie in dem meines Großvaters.
Ich hatte erwartet, dass seine Habseligkeiten bereits in Kisten verpackt wären, aber es wirkte, als wäre er nur kurz zum Frühstück gegangen. Und als hätte jemand in dieser Zeit das Bett abgezogen und die Heizung abgestellt, um gleichzeitig den Raum zu lüften. Ich fröstelte, schlang die Arme um meinen Körper und rieb mit den Händen meine Oberarme, die nur durch den Stoff eines dünnen Pullis vor der Kälte geschützt wurden. In der Erwartung, die nächste halbe Stunde in einem warmen Gebäude und mit dem Schleppen von Kisten zu verbringen, hatte ich meinen Mantel im Auto gelassen.
„Wir stellen die Heizung ab, sobald … Wegen der Umwelt, wissen Sie?“ Die Pflegerin, die Mindy hieß, lächelte mich unsicher an.
Ich dachte, dass sie es wohl, verständlicherweise, eher wegen der Kosten taten, und nickte freundlich. „Ihre Kollegin klang, als wäre es sehr eilig, dass das Zimmer geräumt würde. Ich dachte, Sie hätten seine Sachen vielleicht schon verpackt.“ In meinen Worten versuchte ich, die Hoffnung mitschwingen zu lassen, dass sie mir helfen würde.
„Oh, nein. Das dürfen wir nicht.“ Sie schüttelte den Kopf und wandte sich zum Gehen. Dabei schwang ihr roter Zopf über ihrem Rücken hin und her. „Bitte geben Sie Bescheid, wenn Sie etwas brauchen.“
Ich nickte, etwas enttäuscht. Ich hatte keine Lust, in Schubfächern zu kramen und auf Dinge zu stoßen, auf die ich nicht stoßen wollte. Wie zum Beispiel die Unterwäsche eines alten Mannes oder seine Inkontinenz-Utensilien. „Ähm, Mindy?“
Sie stoppte an der Tür und sah mich mit einem Lächeln an, das nur zur Hälfte gekünstelt wirkte.
„Mir hat … Ich weiß gar nicht …“
Sie runzelte die Stirn und wurde ungeduldig. Es ließ sie älter wirken und gab mir einen Eindruck von ihrem zukünftigen Selbst.
„Wie ist er denn eigentlich gestorben?“
Ihre Augen wurden etwas größer und die Falte auf der Stirn verschwand zusammen mit der Ungeduld. Sie überlegte für einen Moment, sah hinaus auf den Flur und kam dann zurück in das Zimmer. Bevor sie zu sprechen begann, schloss sie behutsam die Tür. Ganz so, als würde sie keine Aufmerksamkeit durch ein lautes Einrasten des Riegels auf uns ziehen wollen. Auf ihr Gesicht trat ein Ausdruck, der zwischen Aufregung und Unwohlsein wechselte. Sie würde mir ein bisschen Tratsch erzählen und sie wusste, dass sie mit den Angehörigen eigentlich nicht auf diese Art reden durfte.
„Er ist eine Treppe hinuntergefallen.“
Eine Treppe? Das Wort drang langsam in mein Bewusstsein, als mein Körper bereits darauf reagiert hatte. Mein Herzschlag setzte für einen Moment aus und meine Lungen stießen die verbrauchte Atemluft schnell aus. Eine Treppe. Konnte das tatsächlich sein? Gab es solche Zufälle? „Eine Treppe?“
Sie nickte und zögerte, bevor sie sagte: „Das ist wirklich eine sehr ungewöhnliche Geschichte.“
„Ungewöhnlich?“ Mein Herzschlag setzte wieder ein und raste nun. Was meinte sie denn mit ungewöhnlich?
Sie nickte erneut. „Herr Béyer …“ Sie sprach den Namen korrekt aus. „… verbrachte die meiste Zeit des Tages im Bett. Er stand nur auf, wenn er ins Bad musste.“ Sie verzog das Gesicht. „Manchmal nicht einmal dafür.“ Dann schlug sie die Hand auf ihren rot geschminkten Mund. „Oh, bitte entschuldigen Sie. Das war nicht sehr taktvoll von mir.“ Sie wartete ab, wie ich reagieren würde, und als ich sie nicht abwertend ansah oder empörte Worte von mir gab, sprach sie weiter: „Na ja, jedenfalls, sein Zimmer verließ er nie. Aber in dieser Nacht tat er es.“ Sie machte eine Pause und ich fragte mich, wann sie merken würde, wie taktlos es war, eine Angehörige auf diese Weise auf die Folter zu spannen. Es waren zehn Sekunden. „Er ging den ganzen Flur hinunter, öffnete die Tür zur Außentreppe und …“ Das war der Moment, in dem sie erkannte, dass sie diese Geschichte nicht einer ihrer Freundinnen erzählte.
„Und was?“
„Wir haben ihn am nächsten Morgen am unteren Ende der Treppe gefunden.“
Ich schloss die Augen und sah hinter ihnen einen anderen Menschen, der auf einem Treppenabsatz ins Stolpern kam und dessen Leben auf diese Weise endete. Ein Bild, das ich mir im letzten Jahr viel zu oft mit grauen Farben ausgemalt hatte. Ich runzelte die Stirn, als mich ein Gedanke traf. „Könnte es sein, dass er … nun ja, dass er diese Treppe … hinunterfallen wollte?“ Die letzten zwei Worte sprach ich sehr leise aus.
Sie schüttelte den Kopf. „Es gab keine Anzeichen. Er war zwar nicht besonders aktiv, aber immer freundlich und versuchte jedes Mal, uns in ein Gespräch zu verwickeln.“ Ihre Stimme senkte sich. „Wir haben im Team darüber gesprochen, ob es vielleicht Selbstmord gewesen sein könnte. Aber wir alle glauben, dass es ein Unfall war.“
Ich nickte, konnte ihr aber nicht mit Worten zustimmen. Die Parallele war zu deutlich. „Hat ihn denn jemand gesehen, als er das Zimmer verlassen hat?“
„Nein. Der Pfleger, der in dieser Nacht Dienst hatte, hat nichts mitbekommen. Er war viel mit anderen Patienten beschäftigt.“ Sie verzog das Gesicht. „Eine Bewohnerin hatte Geburtstag und am Abend zuvor hatte sie diesen mit den anderen Bewohnern bei Kaffee und Kuchen gefeiert.“ Nun flüsterte sie: „Irgendetwas war wohl nicht in Ordnung mit dem Kuchen, denn ein paar Bewohner …“ Sie beendete den Satz nicht.
Ich verdrängte das Bild von sich übergebenden Menschen, die dabei Hilfe brauchten. „Und warum war mein Großvater dann draußen?“
Sie flüsterte noch immer: „Das ist ja das Seltsame. Es ist nicht mal ein normaler Ausgang. Die Bewohner sollen diese Tür nicht benutzen, weil es zu gefährlich ist. Wenn es geregnet hat, kann man auf dem glatten Metall sehr leicht ausrutschen, wissen Sie?“
Ich nickte. „Hatte es in dieser Nacht geregnet?“
Sie überlegte. „Ich glaube nicht. Vielleicht lag etwas Schnee? Na ja, jedenfalls ist es eigentlich nur ein Notausgang und normalerweise informiert ein Alarm uns darüber, wenn die Tür geöffnet wird.“
„Hätte man ihn dann aber nicht viel früher finden müssen?“
Sie nickte. „Es gab aber keinen Alarm.“
Ich stutzte. „Es gab keinen Alarm?“
Eine zarte Röte trat auf ihr Gesicht. „Ich sollte Ihnen das wahrscheinlich nicht sagen.“ Sie tat es trotzdem. „Manchmal schalten wir ihn aus, weil wir ein paar Minuten Pause auf der Treppe machen.“ Sie zögerte. „Nur die Chefin hat den Schlüssel für die Tür. Eigentlich.“
Ich verstand und nickte, fragte aber dennoch: „Wissen die Patienten, wie der Alarm ausgeschaltet werden kann?“
Sie zuckte mit den Schultern. „Kann schon sein.“ Sie zögerte. „Manchmal vergessen wir aber auch einfach, ihn wieder einzuschalten.“ Sie presste die Lippen aufeinander, redete dann aber schnell weiter, um eine mögliche Schuld von ihren eigenen und den Schultern ihrer Kollegen zu nehmen. „Aber es hätte Ihrem Großvater nicht geholfen, wenn wir ihn früher gefunden hätten. Er hat sich das Genick gebrochen und ist ganz bestimmt sofort gestorben.“
Ich schloss die Augen und öffnete sie wieder, als ich den Film in meinem Kopf nicht pausieren konnte. Ich wollte das nicht hören und erst recht nicht sehen. Also sah ich das Mädchen an. „Mindy, ich würde jetzt gern anfangen.“
Sie nickte.
„Danke, dass Sie mir das erzählt haben.“
„Ja, ja, natürlich. Ich bin schon weg.“
Ich überlegte. „Und ich werde niemandem von der Tür und dem Alarm erzählen.“
Ihr Brustkorb hob und senkte sich mit einer kräftigen Bewegung. „Danke.“
Ich nickte und erwiderte das Wort.
An der Tür drehte sie sich noch einmal um. „Oh, und wenn Sie seine Notizbücher finden, verraten Sie mir, ob er etwas über mich geschrieben hat? Wir haben uns immer so nett unterhalten.“
Ich hob beide Augenbrauen und erwiderte nichts. Wieder überzog eine nun etwas stärkere Röte ihr helles Gesicht und sie verschwand mit gesenktem Kopf aus dem Zimmer. Als sie die Tür hinter sich geschlossen hatte, drang der Inhalt ihrer objektiv betrachtet unverschämten Worte zu mir durch. Notizbücher. Mein Großvater hatte Notizbücher mit Gedanken gefüllt.
Und er war die Treppe hinuntergestürzt. Genau wie meine Mutter.
Kapitel Drei
Samstag, 14. Dezember
Eine Woche später beluden wir Bobbis alten Kombi mit einer Menge an Dingen, die eher meinem letzten Umzug glich als einem zweiwöchigen Trip ans Meer. Wenn man die Gegenstände zählte und ihre Größe außer Acht ließ, waren es sogar mehr Sachen, als ich von der letzten Stadt mit in diese genommen hatte.
Bobbi hatte darauf bestanden, nicht nur Handtücher und Klamotten einzupacken. Nachdem sie den Wetterbericht verfolgt hatte, war sie überzeugt, dass es schwer sein würde, das abgelegene Grundstück meines Großvaters regelmäßig genug verlassen zu können, um Einkäufe zu erledigen oder essen zu gehen. Trotz des Räumdienstes, den ich wegen der Vorhersage benachrichtigt hatte. Also stapelten wir neben Flaschen mit Putzmitteln auch Kisten mit alkoholfreien Getränken, Wein, Bier und Schnaps und Konservendosen. Eine Kühlbox mit Frischeartikeln wie Fleisch, Obst und Gemüse, Käse und dergleichen schlossen wir an den Zigarettenanzünder an und hielten ihren Inhalt auf diese Weise auf Kühlschranktemperatur. Daneben stapelten wir einen DVD-Player und diverse Filme, die Bobbi im Keller gefunden hatte, Weihnachtsbaum-Dekoration und jede Menge anderen Kram.
Meine Wohnung glich danach einer Wüste und falls Bobbi und ich nach der Reise getrennt auseinander gingen, könnte ich den restlichen Kram in etwa einer Stunde zusammenräumen und meine vier Wände in weniger als einem Tag aufgeben.
„Das war’s.“ Bobbi schlug die Kofferraumklappe zu und hob die Hände, um zu klatschen. Aber die Klappe hatte sich nicht vollständig geschlossen und sie musste sie noch einmal öffnen und den Vorgang wiederholen. Und dann klatschte sie. Das tat sie häufig. Sie war ein so viel positiverer Mensch, als ich es jemals sein würde, und ich fragte mich nicht zum ersten Mal, was sie an mir fand. Sie lachte viel, lächelte dazwischen und wenn sie sich unbeobachtet fühlte, sang sie. Wenn ich mich unbeobachtet fühlte, fluchte ich oder überprüfte in meiner Handykamera, ob ich etwas zwischen den Zähnen hatte.
„Dann hole ich jetzt meine Tasche und wir können losfahren.“
„Kannst du das hier mitnehmen?“ Sie streckte mir ihr Telefon entgegen.
Ich runzelte die Stirn. „Es ist nicht mehr genug Zeit, um es zu laden.“
„Sehr witzig! Nein, ich will von diesem ganzen Internet-Digital-Kram mal eine Weile Pause machen.“
„Du willst es hierlassen?“
Sie nickte. „Das wird mir guttun. Ich verbringe viel zu viel Zeit damit, in sozialen Netzwerken irgendwelchen Leuten zu folgen, die spontane Fotos posten, für die sie zwanzig Minuten gebraucht haben.“
„Okay.“ Ich zog das ‚ay‘ in die Länge, nahm aber das Handy und drehte mich in Richtung Haus. In mir drängte alles darauf, endlich loszufahren. Wir würden eine ganze Weile unterwegs sein und ich wollte das Haus vor Sonnenuntergang erreichen.
Als ich die Haustür fast erreicht hatte, rief Bobbi mir hinterher. „Willst du nicht mitmachen?“ Es klang etwas unsicher.
„Mitmachen? Wobei soll ich mitmachen?“
„Na, bei meinem digitalen Detox.“
„Deinem was?“ Aber dann verstand ich, was sie meinte. Ich atmete tief durch. Ich hatte kein Problem mit sozialen Medien. Ich nutzte sie nicht. Aber ich mochte es, ein Telefon in der Tasche zu haben, mit dem ich einen Krankenwagen rufen konnte, wenn ich in einen Straßengraben gefahren war. Vorausgesetzt, ich befand mich noch in der Lage dazu zu telefonieren. Aber auch sonst hielt ich es für praktisch, mich um Staus herumnavigieren zu lassen und den Wetterbericht zu verfolgen. „Bobbi, ich finde es schlau, wenn wir eine technische Errungenschaft dieses Jahrtausends mitnehmen, die es uns ermöglicht, mit der Außenwelt zu kommunizieren, wenn unsere Vorräte aufgebraucht sind oder ein Irrer versucht, uns umzubringen.“ Ich streckte ihr grinsend die Zunge raus. Wir hatten die letzten Tage damit verbracht, Teenager-Horrorfilme aus den Neunzigern zu gucken.
„Dein Großvater hat doch sicher einen Telefonanschluss in diesem Haus.“ Für einen Moment klang sie genervt, aber sie fing sich innerhalb weniger Sekunden. So wie sie es immer tat. Ich bewunderte sie dafür.
Ich sah sie verständnislos an und deutete auf den Kofferraum, der so voll war, dass es schwierig sein würde, durch die Heckscheibe den Verkehr hinter uns einzuschätzen. „Du hast einen kleinen Teppich eingepackt. Und Töpfe. Und einen Toaster.“
„Ja, und?“
„Du glaubst, er hätte keine Töpfe, aber der Telefonanschluss sei nach über einem Jahr noch aktiv.“
Sie zuckte mit den Schultern und lachte dann. „Du hast recht. Ich habe nicht nachgedacht. Na gut, dann darfst du dein Telefon als Notfall-Hilfe mitnehmen. Aber wirklich nur dazu.“
„Wie gnädig von dir.“ Ich drehte mich lachend von ihr weg und schloss die Haustür auf.
Nach fast drei Stunden hatten wir etwas mehr als die Hälfte der Strecke hinter uns gebracht. Meine Blase machte es mir inzwischen unmöglich, eine bequeme Sitzposition zu finden, und mein Magen gab immer wieder Geräusche von sich, die selbst das Knarzen des alten Autoradios übertönten.
Bobbi schien es ähnlich zu gehen, denn an der nächsten Raststätte bremste sie den Wagen ab und zog auf die Spur, über die man die Autobahn verlassen und auf den Parkplatz fahren konnte. „Geh du ruhig schon mal aufs WC. Ich tanke den Wagen voll. Wir treffen uns dann dort, wo es etwas zu essen gibt.“
„Nein, das kann ich doch machen.“ Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil wir ihr Auto nahmen und ich wusste, dass sie sich Sorgen darüber machte, ob es durch die nächste Inspektion kommen würde. Jeder Kilometer auf der Autobahn verringerte die Chance darauf.
„Schon okay.“ Sie stieg aus, umrundete das Auto und näherte sich der Zapfsäule.
Ich öffnete meine Tür ebenfalls und drückte mich aus dem Auto in eine stehende Position. „Warte wenigstens mit dem Bezahlen. Du weißt doch, ich habe jetzt Besitztümer.“
Sie winkte ab und studierte die Zapfhähne. Es gab nur drei, aber offensichtlich hatte sie vergessen, mit welchem Sprit ihr Wagen fuhr. „Richtig, Besitztümer, die dir kein Bargeld ins Portemonnaie spielen. Zumindest noch nicht. Du übernimmst einfach die Rückfahrt.“
Ich war nicht länger dazu in der Lage, ihr zu widersprechen, denn sobald ich meine Sitzposition verlassen hatte, drängte mein Körper mich noch mehr in Richtung Toilette. „Also gut.“ Ich ging auf das Tankstellen-Gebäude zu.
„Wir treffen uns im Restaurant“, wiederholte sie. Ihre Worte erreichten mich, als sich die Schiebetüren vor mir öffneten, und ich rannte fast den Schildern hinterher, die die Toiletten auswiesen.
Es befand sich außer mir, dem Tankwart und einem älteren Herrn, der an einem Stehtisch stand und Zeitung las, niemand in der Tankstelle. Der letzte Rastplatz lag nur etwa zwanzig Minuten zurück und ich vermutete, dass die meisten Reisenden nicht bis zu diesem hatten warten wollen. Zumal es dort einen beliebten Burgerladen gegeben hatte, mit dem sich das kantinenähnliche Etablissement an dieser Raststätte sicher nicht messen konnte.
Alles wirkte altbacken und so, als benötigte der gesamte Laden eine grundlegende Renovierung. Oder eine Rekonstruktion, nachdem man den Siebzigerjahrebau dem Erdboden gleich gemacht hatte. Deshalb war ich positiv überrascht, dass die Sanierung der WCs offensichtlich bereits von einem großen Sanitär-Dienstleister übernommen worden war.
Auch hier fand sich keine Menschenseele. Zwei der fünf Waschbecken schienen heute noch nicht benutzt worden zu sein und der Korb für die benutzten Papiertücher war bis auf ein paar wenige zusammengeknüllte graue Knäuel leer. Da ich es ohnehin nicht mochte zu pinkeln, wenn andere Menschen im Raum waren, war ich dankbar für die Stille, die nur durch ein gleichmäßiges Rauschen aufgeweicht wurde, das sowohl von einer Heizungsanlage als auch von einer naheliegenden Großküche stammen konnte.
Ich ging in die Kabine und ließ den Liter Wasser, den ich während der bisherigen Fahrt getrunken hatte, in die WC-Schüssel laufen. Dabei las ich eine Werbeanzeige für den Einbau von Kaminen in Haushalte mit und ohne Schornstein, die an der Tür angebracht war. Gab es im Haus meines Großvaters einen Kamin? Meine Erinnerungen zeigten mir einen dunklen Eingangsbereich, eine Küche und ein Wohnzimmer, dessen große Fenster den Blick auf das Meer freigaben. Außerdem sah ich eine Treppe, die ins Obergeschoss führen musste. Mehr nicht.
Ich zog die Hose wieder hoch, betätigte die Spülung, öffnete die Tür und schrie auf. Mein rasendes Herz stachelte meinen Atem an, sich ebenfalls zu beschleunigen. Und das, obwohl keine Gefahr von dem drohte, was für meinen Aufschrei verantwortlich war.
„Bobbi! Spinnst du? Du hast mich zu Tode erschreckt.“
Sie grinste und lachte dann auf. „Für mich siehst du ziemlich lebendig aus.“ Ihr Lachen verklang und ein Ausdruck des Verlangens legte sich auf ihr Gesicht.
Ich schluckte und versuchte, sie auf andere Gedanken zu bringen. Mich auf andere Gedanken zu bringen. Denn ihr Blick sorgte dafür, dass sich mein eigener Bauch zusammenzog und mich drängte, sie in die Kabine zu ziehen. „Du kannst dich ja ziemlich gut anschleichen. Wo hast du das denn gelernt? Gib’s zu, früher hast du den Leuten heimlich die Geldbörse aus der Hosentasche gezogen.“
Sie trat einen Schritt näher und zwinkerte mir kopfschüttelnd zu. „Ich musste mich ein paar Mal wegschleichen.“
„Ach, ja?“ Ich sah über ihre Schulter zu den Waschbecken, doch wir waren noch immer allein.
Sie nickte, trat einen weiteren Schritt zu mir und drückte mich so zurück in die Kabine. Und dann legte sie ihre Hand an meinen Hinterkopf und zog mich zu sich. Ihr Kuss sorgte dafür, dass ein keuchender Laut meine Kehle verließ, was sie erneut veranlasste zu grinsen. „Was? Du wirkst ja fast so, als hättest du so etwas noch nie getan.“
Ich lachte unsicher auf, während sie die Tür hinter sich schloss und mit einer Hand in den Bund meiner Hose fuhr. Ich schnappte nach Luft, aber als ihre Fingerspitzen meine Haut hinunterstrichen und über dem Slip weiter zwischen meine Beine glitten, wich die Nervosität meinem eigenen Verlangen. Wieder entfuhr mir ein Stöhnen und ich hatte ihre Frage vergessen. Stattdessen legten sich nun meine Finger mehr oder weniger von selbst an den obersten Knopf ihrer Jeans. Aber sie hielt meine Hand fest. „Lass mich.“
Und dann öffnete sie meine Hose, fuhr mit dem Zeigefinger zunächst zwischen meine Schamlippen und dann in mich. Ihr Mund hatte zurück zu meinem gefunden und ihre Zunge umkreiste die meine, während sie mit dem Finger immer wieder und immer weniger sanft in mich stieß. Ihr Daumen umkreiste meine Klitoris und ihre Lippen fuhren mein Kinn entlang zu meinem Hals, wo sie sich festsaugten. Ein Kribbeln erfasste meinen gesamten Körper und mein Bewusstsein für den Rest der Welt tauchte in eine rauschende Wolke.
Ich stöhnte auf und sie legte die freie Hand auf meinen Mund, hob den Blick und grinste mich kopfschüttelnd an. Ich wollte zurücklächeln, als sie dem anderen Zeigefinger einen weiteren Finger folgen ließ und die Berührung mir gemeinsam mit der Öffentlichkeit, in der sie geschah, vor Erregung die Luft zum Atmen nahm.
Bobbi drückte sich an mich. Verstärkte auf diese Weise den Druck ihrer Hand und küsste mich so intensiv, dass ich vergaß, wo wir uns befanden. Ich schloss die Augen und spürte nur noch sie. Spürte einzig das Verlangen und die langsam heranrollende Erfüllung. Und als sie mich daran hinderte, durch ein letztes Stöhnen Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen, war ich froh, dass sie mich gegen die Wand drückte, und ich nicht selbst dafür sorgen musste, mich aufrecht zu halten. Sie hielt mich, bis das Beben abebbte und ihr Grinsen mich zurück in die Realität holte.
Kapitel Vier
Samstag, 14. Dezember
Bobbis Hand lag auf meinem Oberschenkel. Sie streichelte sanft über den Stoff meiner Jeans, während ich versuchte, mich auf meinen E-Reader zu konzentrieren. Doch die Worte des Thrillers konnten nicht durch das Rauschen dringen, das die wenigen Minuten im Waschraum ausgelöst hatten. Ich wollte nicht daran denken, dass es ein Klo gewesen war.
„Hast du eigentlich etwas von den Dingen behalten, die dein Großvater im Pflegeheim zurückgelassen hat?“
Ich ließ die Hand sinken, die den Reader hielt, und sah zu Bobbi. „Sachen?“
Sie lachte auf und reichte mir eine Flasche Wasser. „Ich hab dich wohl etwas durcheinandergebracht.“
Ich verzog den Mund und fühlte mich ertappt und ein kleines bisschen peinlich berührt. Anstatt zu antworten, zuckte ich deshalb nur mit den Schultern, öffnete den Verschluss und trank.
Ihr Lachen erstarb und sie atmete tief durch. Bedauern legte sich auf ihr Gesicht. „So habe ich es doch gar nicht gemeint.“ Sie überlegte. „Genau genommen spricht es absolut für dich, dass du noch nie Sex auf einem Klo hattest.“
Jetzt musste auch ich lächeln. Ich lehnte mich wieder zurück, rutschte näher zu Bobbi und legte meinen Kopf auf ihre Schulter. „Danke, dass du mich zu diesem Trip überredet hast.“ Es würde eine gute Zeit werden.
Ich hörte das Lächeln in ihren Worten. „Ja, das war eine gute Idee, oder? Wir werden großartige zwei Wochen haben. Oder drei.“ Sie zwinkerte mir zu. Bobbi wollte gern den Jahreswechsel am Meer verbringen. Ich hatte dem noch nicht zustimmen können. Bisher waren bereits zwei Wochen länger, als ich uns zutraute. Aber mit jedem Kilometer, mit dem wir uns unserem Ziel näherten, verschwand dieses Misstrauen ein wenig.
Ich nickte nur und wollte die Augen schließen, als sie ihre Frage wiederholte: „Also, hast du irgendetwas von dem Zeug behalten, das dein Großvater im Heim zurückgelassen hat?“
Ich schüttelte den Kopf. „Nein.“
„Warum nicht?“
„Es gab nichts, das mich interessiert hätte.“ Das stimmte nicht. Zwischen alten Unterlagen von seinem Segelverein hatte ich einen Brief meiner Mutter gefunden. Sie bat meinen Großvater darin, ihr endlich die gesamte Wahrheit zu erzählen. Solange er sich noch daran erinnerte. Ihren Worten hatte ich entnehmen können, dass sie mehr gewusst hatte. Mehr als sie mir erzählt hatte. Ich hatte diese Gewissheit von mir geschoben. Es würde keine Möglichkeit geben, aufzuklären, warum mein Großvater mich seit diesem Sommer nicht mehr hatte sehen wollen. Warum sollte ich mich mit dem Wissen quälen, dass meine Mutter mir etwas verheimlicht hatte?
„Nicht mal sowas wie … hm, lass mich überlegen … vielleicht eine Armbanduhr?“
„Nein.“ Eine der wenigen Erinnerungen, die ich an meinen Großvater hatte, war die Art, wie er am Abend seine Uhr ablegte und wie er sie am Morgen aufzog. Es war ein Chronograph der Marke Omega mit einer ungewöhnlichen Gehäuseform, die in meiner Erinnerung irgendwie verdreht aussah.
Und der einzige Grund, aus dem ich dieses Detail nicht vergessen hatte, war, dass er diese Uhr auch bei der Beerdigung meiner Mutter getragen hatte. Aber die Armbanduhr, die auf seinem Nachttisch im Pflegeheim gelegen hatte, war ein billiges Exemplar, das man als Werbegeschenk bekam, wenn man eine Zeitung in einem Probeabo bestellte. Das Armband war kaum gebogen, Das Gehäuse kratzerfrei und auf dem Glas befand sich noch die Schutzfolie. Sie sah nicht so aus, als hätte mein Großvater sie oft getragen. Oder überhaupt.
Und noch etwas anderes hatte gefehlt. Die Notizbücher, von denen Mindy gesprochen hatte, lagen weder neben dem Bett, noch in einem der Schubfächer in der hüfthohen Kommode, die neben dem Kleiderschrank gestanden hatte. Sie waren ebenfalls verschwunden. Ich hatte die Pflegerin danach gefragt, aber sie hatte nur mit den Schultern gezuckt.
„Was geht dir durch den Kopf?“
„Hm?“ Ich löste meine Schläfe von Bobbis Schulter und sah sie an.
„Woran denkst du?“
„Ach, an nichts.“ Ich rutschte auf dem Sitz hin und her, um die Müdigkeit abzuschütteln, die mich plötzlich überkam. Ich würde einen langen Spaziergang brauchen, wenn wir unser Ziel endlich erreicht hatten. Das Wetter schien ideal dafür zu sein. Der Himmel war mattblau und die Sonne würde noch ein paar Stunden scheinen.
„Was hast du mit den Sachen gemacht?“
„Einen Teil habe ich weggeworfen. Den Rest habe ich dem Heim gespendet. Bücher für die Bibliothek. Klamotten und solche Dinge für die anderen Bewohner.“ Ich gähnte.
„Vielleicht solltest du etwas schlafen.“
Ich nickte. Das war eine gute Idee. Wir waren bereits um fünf Uhr aufgestanden und hatten gestern bis in die Nacht hinein gepackt. Ich griff auf die Rückbank, wo Bobbi unser Bettzeug deponiert hatte, und schnappte mir ein Kissen.