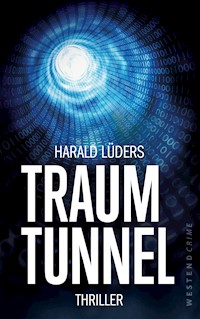14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sein dritter Fall führt den Journalisten Mitch Berger in seine Stadt – mitten hinein in das Frankfurter Bahnhofsviertel, um vor Ort einen brisanten Auftrag zu erledigen. Integrationsprobleme, Drogenhandel, offene und versteckte Prostitution, Bandenkriege und die immer heißer werdende Spekulation mit Immobilien im Viertel bilden den Hintergrund dieses atemlosen Thrillers. Was im multikulturellen und schaurig schönen Rotlichtviertel zunächst harmlos beginnt, steigert sich zu einem blutigen Verwirrspiel mit Menschen, die nichts zu verlieren haben – außer ihrem Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 566
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Ebook Edition
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-86489-802-0
© Westend Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2020
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Satz und Datenkonvertierung: Publikations Atelier, Dreieich
Harald Lüders
Lass Gott aus dem Spiel
Mitch Bergers dritter Fall
Inhalt
Zur Erinnerung an meinen Freund Fred Prase,Polizist und Fotograf des Bahnhofsviertels.
And the only sound that’s left after the ambulances go
Is Cinderella sweeping up on Desolation Row.
Bob Dylan
Es ist heiß heute Nacht.
Die Hitze dämpft die Geräusche, das Heulen der Sirenen ist leiser als sonst.
Flackerndes Blaulicht dringt durch die staubigen Fenster, wie jede Nacht.
Er wischt sich den Schweiß von der Stirn.
Trocknet seine Hand an der fleckigen Jeans.
Die Hand ist voller kleiner Wunden, die Haut rissig, die Kuppen von Zeige- und Ringfinger gelb vom Nikotin.
Langsam, fast zärtlich gleitet seine Hand über das Blatt Papier.
Ein höhnisches Lächeln umspielt seinen eingefallenen Mund.
Er nimmt einen tiefen Zug, greift wieder zu dem Kugelschreiber.
»Der letzte Auftritt muss sitzen. Ich bin bereit, mir mein Leben zurückzuholen.«
Um 17:35 des Tages danach befestigt ein schwarz gekleideter Mann, das Gesicht hinter einer Sturmhaube verborgen, die Hände in dünnen, weichen Lederhandschuhen versteckt, mit ruhigen und präzisen Handgriffen eine kleine, sehr professionell aussehende Kamera an einem Kopfgurt. Er tippt einen Code in sein Handy, stellt damit eine Bluetooth-Verbindung zur Kamera her. Er wählt einen YouTube-Kanal an, der aufgrund hoher Abonnentenzahlen zu Liveübertragungen berechtigt ist.
Um 17:39 zieht er ein G36-Sturmgewehr von Heckler & Koch aus einer schwarzen Lederhülle. Er lädt durch, kontrolliert die Waffe, tritt dann an ein Fenster im zweiten Stock.
In dem großen leeren Raum knirschen seine Schritte auf den Glassplittern, die den Boden bedecken.
Unten im Hof versammeln sich allmählich die Gläubigen.
Um 17:41 verlässt der Mann mit ruhigen Schritten das Fenster und wendet sich zum Treppenhaus.
Um 17:43, als der Ruf zum Gebet ertönt, aktiviert der Mann den YouTube-Kanal und geht auf Sendung
1
Mitch starrt einen Moment ungläubig auf das Display seines Handys, dann knallt er es fluchend auf den Tisch.
»Was zum Teufel bildet sich dieser Schnösel ein? Legt einfach auf, der Idiot. Verdammt, ich habe schon als Journalist gearbeitet, als der noch in Istanbul in den Kindergarten ging. Was für eine Schnapsidee, zwei Autoren auf eine Story zu setzen, das klappt vielleicht mit einem guten Freund, aber nicht mit zwei völlig Fremden.«
Mitch weiß ganz genau, dass der Mann, über den er flucht, nicht in Istanbul in den Kindergarten gegangen ist, sondern wahrscheinlich in Bornheim oder in Offenbach. Aber er ist sauer, und wer sauer ist, darf auch ungerecht sein, meint er.
Endlich hat er wieder einen Job, seit gestern, um genau zu sein, aber sein Auftraggeber, der Redaktionsleiter eines großen deutschen Magazins, besteht darauf, ihm einen Partner zur Seite zu stellen: einen gut zwanzig Jahre jüngeren Mann namens Enis, einen begabten jungen Journalisten mit türkischen Wurzeln.
»Diese Feiglinge. Weil in der Story zwangsläufig eine Menge Türken vorkommen, buchen sie gleich einen türkischen Schreiber dazu. Das nennt man neudeutsch Political Correctness, so macht man sich unangreifbar.«
Die Vorsichtsmaßnahme der Redaktion schmälert sein Honorar und trifft sein Ego. Trotzdem wird Mitch den Auftrag annehmen, seine Kontoauszüge sprechen eine deutliche Sprache. Es ist weiß Gott nicht leicht, sich als freier Journalist durchs Leben zu schlagen.
Mitch springt auf, läuft auf seine Terrasse und wartet, dass der Blick auf die Frankfurter Skyline bei Sonnenuntergang ihn beruhigt.
Fehlanzeige.
Also muss ein guter Schluck Rioja Reserva helfen.
Klappt schon besser.
Wer auch immer am Himmel Regie führt, er gibt alles, um Mitch Berger zu beruhigen. Ein wunderschöner Sonnenuntergang wird heute Abend geboten, einer von denen, die nicht mit violetten Tönen geizen. Wenn selbst ein solcher Sonnenuntergang nicht reicht, um seinen Blutdruck zu senken, dann hat Mitch ein Problem.
Und er weiß auch, was für eins.
Es geht nicht um den Job.
Sein Leben erscheint ihm zunehmend als Endlosschleife. Alles wiederholt sich, immer wieder von vorne.
Okay, er hatte vor Kurzem Erfolg gehabt. Er hatte international Schlagzeilen gemacht, weil es ihm unter hohem persönlichem Einsatz gelungen war, ein übles Psycho-Sanatorium zu schließen und auf den Datenmissbrauch eines großen Internetkonzerns aufmerksam zu machen.
TV-Auftritte in wichtigen Nachrichtensendungen folgten, sogar eine Live-Schalte für CNN, an dem Tag, als der amerikanische Ableger des Sanatoriums aufflog.
Mitch Berger auf allen Kanälen.
Er hat so ein Hoch nicht zum ersten Mal erlebt, er kennt den Rhythmus inzwischen, denn plötzlich ist die Story durch – und in Mitchs Leben waren die Scheinwerfer ausgegangen.
Claire hatte ihn verlassen. Claire, deren Leben er riskiert und deren Leben er gerettet hatte.
Claire, die Stil hatte – und sich mit einem Brief von ihm verabschiedete.
Und gegen diesen Brief hilft kein noch so schöner Sonnenuntergang.
Claire schrieb, sie müsse endlich verstehen, was mit ihr los sei. »Und neben dir, Mitch«, schrieb sie, »neben dir werde ich mich nie finden, weil du leider ein unglaubliches Talent besitzt, jedem Date mit dir selbst auszuweichen.«
»Was für ein blöder Spruch«, murmelt Mitch, »warum können wir beide nicht ganz einfach zusammenbleiben und glücklich sein?«
»Weil du es gar nicht willst, weil du in jedem Moment an die Vergänglichkeit denkst, weil du dich im Sonnenschein schon nach dem Mondlicht sehnst, weil du so bist, wie du bist«, antwortet die Claire in seinem Kopf.
Er hatte den Brief wieder und wieder gelesen, hatte ihn um die Zeilen ergänzt, die Claire aus Feingefühl weggelassen hatte.
»Weil du fast zwanzig Jahre älter bist als ich, weil ich nicht in dein Leben einziehen will, weil ich mein eigenes suchen muss, weil du deinen Blues mehr liebst als dich selbst, weil du dich in deinem Unglücklichsein eingerichtet hast, weil du mich damit runterziehst.«
Das hatte Claire zwar nicht geschrieben, aber sie hatte es gemeint. Und sie hatte verdammt recht.
Mitch schüttelt den Kopf, er hat jetzt keinen Bock mehr, weiter zu grübeln.
Der neue Job ist einfach und doch anspruchsvoll.
Mitch hat diesmal ein Heimspiel gewonnen. Das Magazin will einen großen Artikel über das Frankfurter Bahnhofsviertel, über das Quartier, das gerade einen Riesenhype erfährt, in dem die Preise für Immobilien explodieren, was Investoren aus aller Welt anzieht. Die paar Straßen zwischen Hauptbahnhof und Städtischen Bühnen, zwischen Mainzer Landstraße und dem Main standen bis vor Kurzem für ein runtergekommenes Rotlichtmilieu, für eine krasse Junkieszene, aber auch für ein weitgehend friedliches Multikultimit- oder besser -nebeneinander. Dann aber kamen junge Hipster, Studenten, Künstler, die das Viertel aufmischten. Clubs und Bars eröffneten neben Moscheen und türkischen Gemüsemärkten. Neue Lokale siedelten sich an, hatten Erfolg. An warmen Abenden entwickelte sich die Münchener Straße, eine der drei parallelen großen Achsen des Viertels, zur Partymeile.
Mitch geht zu seinem Schreibtisch, auf dem Hochglanzprospekte von Immobilienfonds liegen, die ihm der Redaktionsleiter gestern in die Hand gedrückt hat.
»Ihr Job, lieber Herr Berger«, hatte der Magazinmann ausgeführt, »ist ganz einfach. Zunächst will ich wissen, wie das Leben jetzt funktioniert, also wie kommen die Leute miteinander klar, die türkischen Händler mit den neuen Hipstern, die Moscheebesucher mit den Junkies, die Nutten mit den paar Uraltbewohnern, die es auch noch gibt. Hat sich durch die Flüchtlinge etwas verändert? Und dann erzählen Sie unseren Lesern, was passiert, wenn über so einem Viertel ein paar hundert Millionen Immobilien-Euro abgeworfen werden.«
Ein gutes Bild, muss Mitch zugeben.
Und die Prospekte vor ihm zeigen, dass es ein stimmiges Bild ist. Internationale Immobilienfonds sammeln Gelder ein, russisches, chinesisches, arabisches Geld, dazu ein wenig Drogengeld aus Kolumbien und Mexiko, und alles verwandelt sich in strahlend schöne Eigentumswohnungen im Frankfurter Bahnhofsviertel, alle Konten sind sauber, alles ist ganz legal. Ob die Käufer jemals dort einziehen, ob sie vorhaben, die Wohnungen zu vermieten, oder sie als Kapitalanlage auf unbestimmte Zeit leer stehen lassen, wird von niemandem kontrolliert.
Das neue Geld wird alles Gewachsene vernichten, aber in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Das Rotlichtmilieu wird schrumpfen, sich jedoch halten, solange die Bordelle Geld machen und sich das Sexgeschäft nicht völlig ins Internet verlagert. Hart treffen wird es die Mieter hier und vor allem die vielen kleinen Läden, die heute das Viertel prägen, türkische Fischgeschäfte, indische Gewürzläden, marokkanische Teestuben. Nicht zu vergessen die letzten übrig gebliebenen Eckkneipen, in denen samstags die Spiele der Eintracht laufen und deren Siege mit einer Lokalrunde nach der anderen gefeiert werden. Wild Gewachsenes wird langfristig eintönigen Esstempeln, coolen Bars und hippen Champagnerschwemmen weichen.
Für die türkischen Händler ist sein neuer Partner Enis zuständig, man wird sich streiten müssen, wer die Inder bekommt. Mitch weiß jetzt schon, wie die Redaktion den Streit entscheiden wird – alles, wo Muslim draufsteht, gehört Enis. Einfache Logik: Tritt man einem Muslim auf die Füße, macht das besser ein anderer Muslim.
So lösen das deutsche Redaktionen.
Mitch kennt Enis nur vom Hörensagen und jetzt gerade von dem Anruf.
»Scheint ein harter Knochen zu sein«, denkt Mitch, »der Typ bestellt mich einfach um 21:00 in eine Bar, von der ich noch nie gehört habe, und erklärt mir noch dreimal, wie die Tür aussieht, als hätte ich je Schwierigkeiten gehabt, den Eingang zu einer Bar zu finden. Und legt dann einfach auf, ohne abzuwarten, ob mir der Platz passt. Arroganter Typ.«
Da bei ihm noch nie etwas gegen das Kennenlernen einer neuen Bar gesprochen hat, verzichtet Mitch darauf, auf Eskalation zu schalten und die Zusammenarbeit mit einem Hahnenkampf zu beginnen. Er macht sich rechtzeitig auf den Weg ins Bahnhofsviertel, das er von früher her gut kennt. Nur die letzten Veränderungen hat er verpasst.
Die Hauptachse des Viertels, die Kaiserstraße, ist schon in der neuen Zeit angekommen. Schicke Esslokale dominieren, die Tische sind voll mit Touristen aus aller Herren Länder. Einzig ein Dolly-Buster-Sexshop zeigt üppig, womit hier früher Geld gemacht wurde.
Mitch biegt in die Elbestraße ein, wundert sich, dass viele zum Teil prächtige Häuser vernagelt sind. Und das legendäre »Pik-Dame« ist in einer Baugrube verschwunden. Zwei Kräne ragen in die Höhe. Da, wo Enis die Tür der Bar beschrieben hat, kauern gut dreißig Junkies auf der Straße.
Einige stehen nur mühsam, schwanken. Mitch beobachtet einen jungen Mann, der sich nach einem heruntergefallenen Crackstein bückt. Seine Bewegung ist unnatürlich verlangsamt. Er braucht fast eine Minute, bis seine Finger das Straßenpflaster erreichen.
Erstarrte, gezeichnete Gesichter mit nach innen gedrehten Augen. Zwei Gestalten kauern in einem Hauseingang, der eine hält ein Feuerzeug an eine kurze Crackpfeife. Zwei Meter weiter wird auf einem Kochlöffel eine braune Flüssigkeit erhitzt, die Soße dann in eine Einwegspritze gezogen und in eine freie Vene am Unterschenkel gejagt. Inmitten der Elendsgruppe fällt Mitch eine blonde Frau auf, der man ansieht, dass sie einmal in ganz anderen, eindeutig besseren Kreisen verkehrte. Sie hält sich gerade, und über ihr von Drogen zerstörtes Gesicht huscht eben ein leicht ironisches, fast stolzes Lächeln.
Mitch spürt plötzlich ein tiefes Verlangen nach einer Zigarette, obwohl er schon seit Jahren clean ist. Verdammt, man müsste alle hier einpacken, zu einer Therapiestation fahren, ihnen eine Chance geben.
Dann schüttelt er den Kopf. Wahrscheinlich hatten sie alle schon dreimal ihre letzte Chance.
Die Tür ist schwarz gestrichen, ziemlich schmal. Daneben ein unauffälliger goldener Klingelknopf. Mitch drückt, wartet, und nach einigen Minuten öffnet sich die Tür und ein freundlich lächelnder Mann bittet ihn herein.
Es ist düster, alles in dunklen Farben gehalten, eine kleine Sitzgruppe, im Hintergrund leuchtet geheimnisvoll eine verdammt gut ausgestattete Bar.
Mitch betrachtet die Flaschen, grinst anerkennend.
»Du musst Mitch Berger sein, willkommen im Kinly, ich bin Enis Citoglu.«
Vor Mitch steht ein gut aussehender Mann Ende zwanzig, mit einem intelligenten, offenen Gesicht, dunklen Augen und einer Frisur, die Mitch sonst nur von Fußballern kennt.
»Hi Enis, Kompliment, spannende Location hier. Und starke Frisur, ich dachte, Undercut sei out?«
»Aber nicht doch, höchstens für Leute mit schwachem Haarwuchs. Bei dir würde es ziemlich albern aussehen.«
Mitch grinst. »Alles klar. Und schlagfertig bist du auch noch. Ist doch was.«
Die beiden grinsen sich an, der Anfang hat geklappt. Mitch bestellt einen Sidecar auf Whisky-Basis mit einigen Hundert anderen Zutaten.
Er schlürft genüsslich, dann blickt er Enis an. »Die Location passt zur Story, oben Crack, unten serious drinking. Gefällt mir. Eine Sache aber muss geklärt sein, bevor wir hier zusammen trinken. Hast du dich in den Auftrag gedrängt oder haben die Hamburger dich reingedrückt?«
Der Konter kommt sofort. »Die Redaktion weiß, dass ich mich im Bahnhofsviertel auskenne, bei dir waren sie sich wohl nicht so sicher. Sie wollen aber wohl eine Edelfeder, die mein schlechtes Deutsch aufbrezelt.«
Dann erzählt Enis, dass er schon öfter für das Magazin gearbeitet hat, dass aber nach der Affäre um einen fälschenden Reporter neuerdings gerne mit zwei Autoren gearbeitet werde. »Wir sollen wohl gegenseitig drauf achten, dass hier keinem die Fantasie durchgeht.«
Mitch grummelt. »Okay, passt, das kann gut sein.«
Er nippt wieder an seinem Drink. »Von wo aus der Türkei kommst du eigentlich?«
Enis stöhnt. »Nicht dein Ernst jetzt, ich komme aus Bornheim, habe mein Leben lang hier gelebt, frag bitte nicht so ne dumme Scheiße.«
»Hey, komm runter, dann halt: Woher kommt dein Großvater? Bist du Kurde oder Türke, oder was?«
»Warum interessiert dich das? Ich frage dich auch nicht, ob du evangelisch oder katholisch bist oder ob du Annalena Baerbock schärfer findest als Saskia Esken?«
Mitch schüttelt sich. »Mann, hör auf, weder noch, zweimal weder noch. Ihr regt euch immer so fürchterlich schnell auf. Wie beim Fußball. Mann, wenn wir tausend Fahnen mit ins Stadion schleppen, dann kommt ihr mit zwanzigtausend und alles tobt, Türkiye, Türkiye, als wolltet ihr gleich irgendwo einmarschieren. Und wenn ihr gerade mal wieder irgendwo einmarschiert seid, dann muss jeder Torschütze beim Jubeln strammstehen und salutieren.«
»Mitch, mach langsam und fang nicht mit Fußball an. Wo wäre denn die deutsche Nationalmannschaft ohne Gündogan oder Emre Can? Und wenn die Deutschen schon mal einen begnadeten Mittelfeldspieler haben, dann wird der fast gelyncht, nur weil er nicht Einigkeit und Recht und Freiheit schmettert.«
»Und weiter, trifft mich nicht. Ich habe immer zu Özil gehalten. War ein guter Spieler. Löw brauchte nach der beschissenen WM halt einen Sündenbock. Aber warum, verdammt noch mal, stellt sich Özil auch mit Erdogan aufs Foto und macht den Typ später noch zu seinem Trauzeugen?«
»Aus Respekt vor seinen Eltern vielleicht und weil er all den Leuten einen Finger zeigen wollte, die ihn im Stadion auspfeifen. Mitch, ja, es stimmt, viele Türken sind ein wenig hysterisch, wenn es um Erdogan und die alte Heimat der Eltern geht. Aber mach mich nicht an wegen Erdogan, meine Freunde sitzen in der Türkei im Knast, nicht deine. Und noch was, ich sage dir, es ist verdammt schwer, sich in dieses Deutschland einzuleben. Weißt du, warum? Weil viele Deutsche zu sich selbst und ihrem Land ein total verklemmtes Verhältnis haben. Manchmal denke ich, die Deutschen ersticken an ihrer Geschichte. Entweder sind sie total stolz darauf, dass ihr Großvater in Stalingrad den Heldentod für den Führer gestorben ist, oder aber sie haben Probleme mit Deutschland, eben weil der Großvater ein verdammter Nazi war. Die ganze 68er-Generation ist doch so drauf. Nur, was habe ich mit dem verdammten Opa zu tun?«
Mitch blickt Enis nachdenklich an, nickt. »Stimmt, Enis, stimmt ziemlich genau. Ich kenne den Opa gut, von dem du da erzählst, bei älteren Freunden war es auch der Vater. Aber, sorry, als du den deutschen Pass angeklickt hast, da war der Opa mit im Warenkorb. Sorry, keine Retoure möglich, den wirst du nicht mehr los. Willkommen in Deutschland, einem Land mit Geschichte.«
Mitch schweigt einen Moment, winkt dann dem Barkeeper. »Noch mal dasselbe, die Runde geht auf mich.« Dann dreht er sich zu Enis. »Okay, wir machen die Story. Cheers! Lass uns morgen anfangen zu arbeiten, jetzt trinken wir einen.«
2
Um acht Uhr ist es noch ruhig im Viertel.
Ein Transporter hält in der zweiten Reihe vor einem türkischen Markt, ein Mann in einem weißen Kittel und einer Frisur, die an die Haartracht des Liverpooler Stürmers Mo Salah erinnert, springt aus dem Fahrerhaus, läuft um den Wagen, öffnet die Flügeltüren hinten, holt ein rötlich-metallisch schimmerndes, enthäutetes Lamm heraus und trägt das Tier in den mit Waren überladenen Laden.
Eine schwarze Mercedes-Limousine nähert sich, blinkt, quetscht sich mühsam an dem Transporter vorbei. Der Fahrer, ein übergewichtiger Schlipsträger, macht eine wütende Geste Richtung Hindernis.
Der Mercedes beschleunigt kurz, blinkt dann links, biegt in die Toreinfahrt eines prächtigen, aber jetzt langsam verfallenden großen Gebäudes ein. Die Tore sind über und über mit Graffiti besprüht. Über der Einfahrt hängt ein Schild »Hotel Kölner Hof, bitte rechten Nebeneingang benutzen«.
Der Wagen hält jetzt in dem heruntergekommenen Hinterhof. Es ist still hier, die belebte Straße draußen scheint weit entfernt. Unmittelbar neben dem dunklen Mercedes türmen sich Bauschutt, gebogene Kupferrohre, Fliesenreste aller Art. Die Gebäude, die den Hinterhof umschließen, wirken verlassen. Fast alle Scheiben sind zerschlagen, die Fensterrahmen herausgerissen. Nur über dem Eingang des bewohnten Querflügels hängt ein windschiefes Schild »Hotel Kölner Hof«.
Der Mann, der leicht hinkend den Wagen verlässt, fällt auf in dieser Umgebung. Der korpulente Endvierziger trägt schwarze Budapester Schuhe, eine untadelig gebügelte schwarze Hose, ein leuchtend weißes Hemd, geschmückt mit einer roten Krawatte, darüber einen dunkelgrünen Janker mit silbernen Knöpfen.
Er achtet bei jedem Schritt peinlich genau darauf, seine Garderobe möglichst staubfrei zu halten. Durch eine Tür zu einem der Seitenflügel erreicht er ein Treppenhaus, in dem man unter all dem Schutt und Staub die Pracht vergangener Zeiten noch immer erahnen kann.
Die Tür, vor der er stoppt, passt überhaupt nicht zu diesem heruntergekommenen Haus, eine sauber blitzende Tür aus schwerem Eichenholz, darauf ein poliertes goldenes Schild: STEINHOFFPROPERTIES.
Er öffnet die Tür, und fast im gleichen Moment erscheint eine grauhaarige, sehr schlanke und äußerst gepflegt wirkende Dame Ende vierzig. »Guten Morgen, Dr. Steinhoff, Ihre Post liegt bereit, alles ruhig so weit, nur die Herren der CCB-Fondsgesellschaft erwarten Ihren Rückruf.«
»Danke, Marianne, ich werde gleich zurückrufen. Könnte ich einen Cappuccino kriegen?«
»Sofort, Chef.«
Dr. Steinhoff betritt einen modern und nüchtern möblierten Raum, der durch seine Größe und den voluminösen Glasschreibtisch an der Stirnseite besticht. Nachdem er den Raum betreten hat, ist sein Hinken kaum noch zu bemerken. An der Wand hinter dem Schreibtisch hängt ein teuer gerahmtes großformatiges Schwarzweißfoto des Gebäudes, aufgenommen Ende der zwanziger Jahre. Ein imposantes Haus in all seiner Pracht, mit einigen wunderschönen alten Cabriolets im Vordergrund. Daneben, ebenfalls gerahmt und unter Glas, Baupläne und Bilder einer monoton wirkenden modernen Ferienhaussiedlung auf der Kanareninsel Fuerteventura.
Carl Steinhoff war am Bau der Siedlung beteiligt gewesen und hatte endlich einmal ein gutes Geschäft gemacht, eher die Ausnahme bei ihm. Dem Schreibtisch gegenüber sind eine Sitzgruppe in schwarzem Leder und ein Couchtisch aus Metall und Glas platziert. An der Wand rechts vom Schreibtisch glänzt ein gläserner Barschrank mit schweren Metallfurnieren.
Kaum hat er Platz genommen, steht ein frischer Cappuccino vor ihm. Die Sekretärin schiebt ihm zuvorkommend den Zucker zu, dann verändert sich ihr Gesichtsausdruck. Dr. Steinhoff weiß genau, was jetzt kommt, er hört es jeden Tag.
»Chef, müssen wir eigentlich noch lange in diesem schrecklichen Haus bleiben? Ich hasse es hier, wir sind eine kleine zivilisierte Insel in einem Meer der Verwüstung. Ich weiß nicht, wie man in so einer Ruine erfolgreich Geschäfte machen will.«
Steinhoff lächelt gequält. »Sie haben es immer noch nicht kapiert. Der einzige verbliebene Geschäftszweck unserer Firma ist der Verkauf dieses Gebäudes. Und jeder mögliche Käufer wird hier außer der Fassade keinen Stein auf dem anderen lassen. Je schlimmer es hier im Treppenhaus und im Innenhof aussieht, desto leichter bekommen die Käufer eine Genehmigung zum kompletten Umbau, und das ist das Einzige, was Investoren interessiert. Oder glauben Sie etwa, ich will an Denkmalschützer verkaufen? Wann kapieren Sie das endlich?«
Beleidigt verlässt die Sekretärin den Raum. Carl Steinhoff ist froh, dass er allein ist.
Er sucht nervös in seiner Hosentasche, kramt einen Jeton des Wiesbadener Spielkasinos hervor, spielt mit dem Plastikchip, dreht ihn, flippt ihn hoch, fängt ihn wieder. Ihn erwartet ein unangenehmes Telefonat.
Als er sich vor einem guten Jahr entschloss, auf die Avancen der CCB einzugehen, hatte er Informationen über die Fondsgesellschaft eingeholt. Alles seriös, lautete die Auskunft, ein konservativ geführter, sehr großer Fonds, weltweit aufgestellt. Jetzt aber haben die Frankfurter Vertreter der CCB begonnen, ihr wahres Gesicht zu zeigen und die Phase der Höflichkeiten hinter sich zu lassen. Sie treten zunehmend fordernder auf, immer häufiger erinnern sie an gewisse, leider nicht unerhebliche Zahlungen, die er entgegengenommen hat. Geld war schon immer seine Achillesferse, seine Ausgaben übersteigen bei Weitem seine Einnahmen. Steinhoffs Leidenschaft für Spielcasinos ist daran nicht ganz unschuldig.
Er hat keinerlei Lust, jetzt mit den Herren zu sprechen, aber wenn er nicht zurückruft, werden sie ihn den ganzen Tag lang verfolgen. Steinhoff seufzt, wischt sich mit einem Taschentuch über die Stirn. Dann greift er zum Hörer. »Marianne, bitte verbinden Sie mich mit der CCB.«
Es dauert keine zwei Minuten, dann hört er eine fast jungenhaft klingende Stimme mit leicht amerikanischem Akzent, die ihn übertrieben freundlich begrüßt. »Hallo, Doktor Steinhoff, schon so früh am Schreibtisch? Wir hatten eigentlich gestern mit Ihrem Anruf gerechnet. Sie sind halt ein gefragter Mann. Wir müssen uns sehen. Ja, heute noch, am besten so gegen 16 Uhr, nein, nicht im Office, wie üblich im Hotel. Sie finden uns in Suite 116. Und, lassen Sie uns nicht warten!«
Mit einem angeekelten Gesichtsausdruck legt Steinhoff auf, wischt sich erneut mit dem Taschentuch über den Kopf, steht auf, jetzt hinkt er wieder, geht zu dem Glasschrank, öffnet die rechte Tür und bewundert seine gut bestückte Hausbar. Ein beruhigender Anblick.
Er gießt sich einen kleinen Armagnac ein, lässt den Schwenker kurz kreisen, kehrt dann zu seinem Schreibtisch zurück.
»Marianne, geben Sie mir bitte Benno Stiller.«
Etwa um dieselbe Zeit wacht Mitch auf und hat das untrügliche Gefühl, dass der letzte Cocktail einer zu viel war. Eine Ibuprofen 600 und ein doppelter Espresso helfen in der Regel schnell. Er kennt diese morgendliche Stimmung nur zu gut. Halb hängt er noch den Traumfetzen der Nacht nach, halb wartet schon die Traurigkeit des kommenden Tages. Traurigkeit trifft es nicht, es ist eher Sehnsucht, nur hat Mitch bei allem Grübeln noch nicht herausgefunden, wonach er sich sehnt. Er nennt es den Blues, ein Gefühl, das sein Leben dominiert. Er ist mittlerweile Ende vierzig, hat schon mehr als die Hälfte seiner Zeit auf dieser Erde gelebt, und doch fühlt sich manchmal alles an wie ein müdes Vorspiel – und so, als würde das Eigentliche noch irgendwo auf ihn warten.
Mitch kneift die Augen zusammen und peilt seinen Wecker an. Kurz nach 10 Uhr, er muss los, er ist um elf mit seinem neuen Kollegen verabredet.
Nach einer ausgiebigen kalten Dusche startet er in den Tag. Wieder ist das Bahnhofsviertel sein Ziel, er ist mit Enis in einem Café auf der Münchener Straße verabredet. Mitch nimmt die U-Bahn, da unten in Bahnhofsnähe gibt es fast nie einen Parkplatz. Eine Story zu schreiben, die in der eigenen Stadt spielt, ist neu für ihn, macht Mitch ein wenig nervös.
Im Frankfurter Bahnhofsviertel waren schon immer die Probleme des Landes wie unter einem Brennglas sehr früh erkennbar. Obwohl es als Rotlichtviertel viel kleiner und weniger glamourös ist als St. Pauli. Aber was zum Teufel ist eigentlich glamourös an einem Rotlichtviertel?
Im Frankfurter Bahnhofsviertel wurde nicht nur seit ewigen Zeiten heftig gegen Cash gevögelt und mit Drogen aller Art gedealt, hier wurde auch schon früh mit deutscher Asylpolitik Geld gemacht. In den siebziger Jahren sorgte ein neuer Club namens Sauna 2000 für Furore. Der Laden gehörte einem Newcomer im Viertel. Der hatte ein einfaches, aber geniales Konzept entwickelt. Von der Straße aus betraten zahlungskräftige Messegäste eine Bar, in der sie durch eine Glaswand an der Rückseite des Raums in eine Badelandschaft blicken konnten, in der einige gut aussehende Damen einladend plantschten. Nach ein paar Drinks wollten einige der Gäste nicht mehr nur zuschauen. Der Weg zu den Damen führte durch den Hinterhof. Die Bar war ein reiner Durchlauferhitzer, das Konzept lockte vor allem gut betuchte Herren an, die ein einfaches Laufhaus nie betreten hätten. Als den Bossen im Viertel der Erfolg des neuen Ladens zu groß wurde, hatten auch sie eine originelle Idee. Sie intervenierten beim Hausbesitzer, der sich kurz darauf gegenüber der Stadt bereit erklärte, einige Dutzend afrikanische Asylbewerber in seinem Haus einzuquartieren.
Ein Schachzug, der auf das Herz des Konzepts der Sauna 2000 zielte: Ein beschwingter Messegast hat sich Mut angetrunken, will die Damen nicht länger nur anschauen, will zugreifen. Aber auf dem Weg zum Saunaeingang im Hinterhof steht vor ihm plötzlich eine größere Gruppe Schwarzer, die auf dem Hof herumsteht. Die meisten Herren aus der Provinz machen auf dem Absatz kehrt und gönnen sich lieber einen Porno im sicheren Hotelbett.
Mitch hat die Geschichte vom Aufstieg und Fall der Sauna 2000 schmunzelnd verfolgt. Zu dem Zeitpunkt waren fast alle Hotels im Viertel mit Asylbewerbern belegt, manche vom Keller bis zur letzten Dachkammer.
Mitch schüttelt sich. »Mann, wenn heute einer auf die Idee kommen würde, Asylbewerber in Hotels einzuquartieren, was für eine Vorlage wäre das für die AfD.«
Einige Kilometer vom Bahnhofsviertel entfernt schlägt in Frankfurt-Höchst die Glocke des Kirchturms der katholischen Gemeinde Sankt Josef 12 Uhr.
Aus einem vorbeifahrenden tiefergelegten 5er BMW mit abgedunkelten Scheiben donnert brutal laute türkische Rapmusik.
Ein junger Mann mit schwarzem Vollbart schaut missbilligend dem Wagen nach. Er trägt über seinem weißen Kaftan eine dunkle Kapuzenjacke, eine schwarze Gebetsmütze und rote Sneakers. Der junge Mann überquert die Straße, schaut etwas irritiert in die Auslage eines Ladens, der rumänische Spezialitäten anbietet. Der Anblick von fetten Würsten und Schnapsflaschen ist nichts für ihn. Ihm kommt ein Rentner entgegen, der mühsam eine größere Topfpflanze in einer Plastiktüte schleppt. Der Mann im blütenweißen Kaftan weicht dem Rentner aus, stößt dabei fast gegen eine übergewichtige Osteuropäerin, deren voluminöse Oberschenkel in eine enge Stretchhose mit Leopardenmuster gepresst sind. Dann fällt der Blick des jungen Mannes auf das Schaufenster des Reisebüros Manatours. Ein Lächeln huscht über sein Gesicht, ein knallbuntes Plakat mit einem Bild der Kaaba fordert die Gläubigen auf, ihre Reise zur Hadsch nach Mekka jetzt und hier zu buchen. Der Mann wendet sich Richtung Bahnhof Höchst. Er biegt nach rechts ab auf den Parkplatz eines großen Asia-Supermarktes. Er läuft durch eine überdachte Einfahrt, in der jede Menge Holzpaletten gespeichert sind. Durch das gelbliche Plexiglasoberlicht fällt fahles Licht. Eine Taube flattert laut gurrend auf, der Mann stoppt eine kurze Sekunde, läuft dann weiter, bis er vor Hinterhofgaragen und einer schmalen Tür steht.
Er klopft, die Tür öffnet sich, er huscht in einen halbdunklen, schmucklosen, mit Teppichen ausgelegten Raum.
Er wird von fünf jungen, ebenfalls bärtigen Männern mit allen Zeichen des Respekts begrüßt.
»Ahlan wa sahlan, Ibrahim, sei gegrüßt im Namen Gottes.«
Mitch macht sich auf den Weg, er ist mit Enis in einem Café in der Münchener Straße verabredet. Auf der Kaiserstraße spricht ihn ein hochgewachsener weißhaariger Schwarzer in perfektem Deutsch an, bittet im Namen Gottes um einen Euro. Mitch ist verblüfft, das Auftreten und die gepflegte Sprache des Mannes erstaunen ihn. Er wühlt in seiner Hosentasche, findet keine Münzen, sieht die Enttäuschung in den Augen seines Gegenübers und drückt ihm kurz entschlossen, ganz gegen seine Gewohnheiten, einen Fünf-Euro-Schein in die Hand. Vor Überraschung fällt der Mann in seine Muttersprache und wünscht Mitch im weichen Englisch der Karibik ein langes glückliches Leben, auch für alle seine Kinder. »Schade, dass ich keine habe«, flüstert Mitch.
Gut gelaunt kommt er vor dem Café an und wird von Enis begrüßt, der es sich in einem kleinen Korbsessel auf dem Bürgersteig bequem gemacht hat. Er lacht, als Mitch ihm von der Sauna 2000 erzählt.
»So Stories gab es viele in den wilden Zeiten. Als die großen Bordelle oder Laufhäuser aufmachten, gaben die Betreiber die strikte Parole aus: Keine Zuhälter in den Häusern. Dann drängten schwarze Frauen auf den Markt, die bei den Kunden schnell hoch im Kurs standen. Nur kamen mit ihnen schwarze Zuhälter, die meistens auch die Dealer der fast immer drogenabhängigen Frauen waren. Und die scherte es einen Scheiß, dass die Häuser für sie gesperrt waren. Plötzlich bemerkten die Bosse, dass sie ihre Befehle nicht durchsetzen konnten. Ihnen fehlten schlicht genügend Soldaten auf der Straße. Also wurden Zuhälter aus Hamburg und Berlin eingeflogen. Dann begann im Bahnhofsviertel die große Jagd auf alles, was schwarz war. Dummerweise waren die deutschen Zuhälter zu blöde, um zwischen afrikanischen Zuhältern und schwarzen GIs zu unterscheiden. Die US-Jungs aber waren damals eine sehr kaufkräftige Klientel. Als die Umsätze in den Bordellen merklich zurückgingen, wurde die Aktion abgebrochen.«
Beide lachen, nippen an ihren Tassen. Mitch wird plötzlich nachdenklich: »Ja, es gibt hier eine Menge starker Geschichten. Mich fasziniert die Story der Beker-Brüder, die lange Zeit als die heimlichen Chefs des Viertels galten. Dass nur gut drei Jahrzehnte nach dem Holocaust sich zwei Juden in einem deutschen Rotlichtviertel durchsetzen konnten, aus dem Stoff würde man in Hollywood einen Blockbuster machen. Aber für unsere Story sind das natürlich alte Kamellen, unsere Geschichte spielt heute und muss danach fragen: Ist das hier wirklich ein friedliches Multikulti-Biotop, oder laufen unter der bunten Decke ganz andere Sachen ab? Wir dürfen auf keinen Fall eine Friede-Freude-Eierkuchen-Story abliefern. Wir müssen auch die bösen Jungs beschreiben, die Konflikte zwischen den alten Bewohnern und den neu Angekommenen. Und dann sehen, wie der Einmarsch des Geldes alles verändert.«
Die beiden vertiefen sich jetzt in ihre Unterlagen, da wird es mit einem Mal laut. Mitch und Enis sehen, wie ein älterer, leicht angetrunken wirkender Mann auf der anderen Straßenseite eine Frau mit Kopftuch anschreit, ihr plötzlich das Tuch vom Kopf reißt und es mit höhnischem Gelächter über seinem Kopf schwenkt. Zwei arabisch aussehende junge Männer, die die Szene beobachtet haben, packen den Mann, entreißen ihm das Kopftuch. Eine rechte Gerade trifft die Nase des Alten, der blutend zu Boden geht. Die beiden jungen Männer reichen der Frau ihr Tuch, schimpfen noch einen Moment auf den Angreifer am Boden ein und gehen dann weiter.
Der ältere Mann erhebt sich stöhnend, wischt sich mit dem Ärmel das Blut von der Nase, dann überquert er leicht schwankend die Straße, kommt auf Mitch und Enis zu.
Mitch steht auf, reicht ihm ein Tempotaschentuch. »Mann, warum machst du auch die Frau an, was soll der Schwachsinn?«
Der Alte blickt Mitch an, zuckt die Schultern, nuschelt: »Geht dich nen Scheiß an, ich kann die Kopftuchweiber nicht ab.« Dann dreht er sich abrupt um, schlurft die Münchener Straße hoch.
»Den Kerl kenn ich«, murmelt Enis, »heißt Erwin, ein ziemlich fertiger Typ. Schleicht hier seit Jahren rum, macht Botengänge, hauptsächlich für den alten Steinhoff vom Kölner Hof. Da passt er gut hin.«
Mitch schaut Enis fragend an.
»Na, der Steinhoff war mal ne große Nummer hier, dem gehört das Hotel Kölner Hof. Das war früher dreimal so groß, aber ihm gehört immer noch die gesamte, sehr große Immobilie. Er ist ein alter Nazi, in seinem Büro hängt angeblich ein Hitlerbild. Früher hat er zu seinen Geburtstagen legendäre Feten geschmissen. In der Zeit der Bekers hat er wohl ein paar Mal aufs Maul gekriegt. Heute ist er scheintot, früher aber war immerhin Benno Stiller sein Mann fürs Grobe.«
»Und wer bitte ist Benno Stiller?«
Enis blinzelt Mitch an. »Du hast doch gerade gesagt, dass du die bösen Jungs kennenlernen willst. Dann wirst du früher oder später auf Benno Stiller treffen. Nur so viel, der war mal Bulle, eine richtig große Nummer sogar. Er soll für einen Beamten eine viel zu dicke Brieftasche gehabt haben. Er durfte in allen Bordellen frei vögeln, nur irgendwann eröffnete die Innenrevision ein Verfahren gegen ihn. Danach quittierte er ziemlich schnell den Dienst. Man ließ ihn gehen, die Ermittlungen wurden eingestellt, der Mann wusste einfach zu viel über zu viele. Du wirst ihn kennenlernen.«
»Kann es kaum erwarten«, murmelt Mitch.
Der Mann mit der blutenden Nase, sein voller Name lautet Erwin Fredeking, bleibt vor einem sehr großen Block stehen, dessen Eingangstore geschlossen sind. Erwin läuft an der mit Graffiti übersäten Hauswand entlang, bis er einen Nebeneingang erreicht hat, über dem ein Schild auf das Hotel Kölner Hof hinweist. Erwin stoppt jetzt, kramt nach einem Tempotaschentuch und säubert sich notdürftig das Gesicht.
Dann verschwindet er in dem Eingang, läuft an einer leicht vergammelten Rezeption vorbei, der man ansieht, dass sie schon bessere Tage gesehen hat. Er steht jetzt im ehemaligen Dienstbotentreppenhaus des Blocks. Erwin nimmt einen Seitengang, geht an einem PRIVAT-Schild vorbei, folgt dem Gang, passiert schwere altdeutsche Möbel, klopft an einer Tür, die einmal schön und wertvoll gewesen sein muss.
Die Tür öffnet sich, eine Wolke aus kaltem Rauch strömt ins Treppenhaus, Erwin betritt die Wohnung. Der Alte befindet sich, wie fast immer, wenn Erwin ihn besucht, in seinem Wohnzimmer. Ein mehr als merkwürdiger Raum, eine Mischung aus deutschem Rittersaal mit einem orientalisch anmutenden Diwan in hinteren Teil des Raums. Erwin läuft an einem überdimensionierten altdeutschen Esstisch aus dunkler schwerer Eiche vorbei, um den sechs schwere Stühle mit hohen Lehnen stehen.
Hier riecht es nicht nur nach kaltem Rauch, sondern auch nach altem Mann.
Hermann Steinhoff liegt auf dem mit Teppichen und Decken bedeckten Diwan, auf einem flachen Tisch daneben steht ein übervoller Aschenbecher und ein leerer Cognacschwenker. Zu Steinhoffs Füßen hat sich sein alter Schäferhund ausgebreitet, ein Riesenvieh, das auf den schönen Namen Bübchen hört. Heute wirkt er handzahm, aber Erwin kann sich noch gut an die Tage erinnern, als Hermann Steinhoff immer wieder wegen diverser Attacken seines Hundes auf Dunkelhäutige von der Polizei einbestellt wurde. »Kann ich doch nichts dafür, dass der Hund bestimmte Ausländer nicht leiden kann, ist halt ein deutscher Schäferhund und kein Pudel.«
Der Alte greift in die Gesäßtasche, fingert nach seinem Geldbeutel, flucht, da er nur noch einen Zehn-Euro-Schein findet. »Verdammt, Erwin, drüben auf dem Schreibtisch steht eine Kassette mit Geld drin. Nimm dir einen Fünfziger und hol mir eine Flasche Courvoisier. Kannst den Rest behalten.«
Erwin nickt, geht in das Arbeitszimmer, findet tatsächlich die Kassette auf dem Schreibtisch. Er fischt sich einen Fünfziger heraus, alles unter den neugierigen Blicken eines Regiments von Tonsoldaten aus dem Regal gegenüber.
Erwin verlässt jetzt die Wohnung, wendet sich im ersten Hinterhof in die andere Richtung, steht nun vor einer schmucklosen zweistöckigen Lagerhalle, die wie eingeklemmt zwischen dem Hotelflügel und dem leer stehenden prächtigen Gründerzeithauptgebäude steckt. Erst auf den zweiten Blick erkennt man an Schildern in arabischer Schrift, dass es sich bei der Halle um eine Moschee handelt. Die Hinterhofmoschee wirkt wie ein Relikt aus einer anderen Zeit. Sie erinnert an die Jahre, als Muslime in Deutschland noch eine seltene Spezies waren. Die Halle stand lange leer, dann hat der alte Steinhoff sie vor gut zehn Jahren an einen paschtunischen Moscheeverein vermietet. Dafür wurde der Alte von seinem Sohn, aber auch von den meisten seiner Bekannten heftig kritisiert.
Erwin schimpft vor sich hin, als er zwei Frauen mit Kopftuch aus dem Gebäude kommen sieht. Er wird nie begreifen, warum der Alte ausgerechnet an Muslime vermietet. »Er gibt den großen Deutschen, erzählt mit Inbrunst, wie er seinen Hund auf bettelnde Zigeuner gehetzt hat, aber er vermietet an gottverdammte Muslime!«
Mitch und Enis schlendern durch das Viertel. Enis ist gut bekannt hier, er begrüßt da einen Gemüsehändler, plaudert dort mit einem Kebabverkäufer, klatscht sich mit einem Friseur ab, dessen Haarschnitt seinem ziemlich ähnlich sieht. »Ist das der Mann, der dir zu deinem Kunstwerk verholfen hat?«, frotzelt Mitch.
Enis schüttelt den Kopf, biegt in die Elbestraße ein und zeigt auf einen prächtigen, offenbar leer stehenden Block von gut achtzig Meter Länge. »Das Ding hier gehört dem alten Steinhoff, über den wir gerade gesprochen haben. Steht alles leer, vergammelt, ist Millionen wert. Dazu gehört noch ein Hinterhaus, genauso groß, das ist mit Quergängen mit dem Vorderhaus verbunden. Das ganze Areal hat mehrere Hinterhöfe, in einem steht sogar eine kleine Moschee. Vom letzten Hinterhof aus kommst du bis rüber zur Kaiserstraße. Hier vorne in dem Seitenflügel betreibt der Alte noch sein Hotel, den Kölner Hof, wohl mehr als Hobby.«
»Wieso lässt er den Riesenkasten leer stehen, ist doch reine Verschwendung?«
»Keine Ahnung, angeblich gibt es Krach in der Familie, sein Sohn, hab ich mal gehört, will den ganzen Laden verkaufen, der Alte wehrt sich dagegen. Er ist verrückt. Kennst du die Geschichte des Kölner Hofs?«
Mitch schüttelt den Kopf. »Nein.«
»Es gab früher einen Kölner Hof ganz nah am Bahnhof. Das war ein Riesenschuppen, der 1892 eröffnet wurde und damals damit warb, das einzig judenfreie Hotel in Frankfurt zu sein. Der Besitzer war ein glühender Antisemit, dem es gelang, sein Hotel stetig zu vergrößern. Natürlich trat er schon weit vor der Machtergreifung in Hitlers Club ein und saß als Stadtverordneter im Römer. Hermann Laass hieß der Typ. Anscheinend hält sich der alte Steinhoff für seine Reinkarnation, heißen ja auch beide Hermann.«
»Was für eine miese Geschichte, deswegen der Name Kölner Hof. Musst du erst mal drauf kommen, ich dachte, der Mann ist aus Köln. Oder Karnevalfan oder so was. Hermann, kein schlechter Name für ihn. Der Namenspatron aller Hermanns, der fette Göring, war Fixer. Passt doch ins Viertel.«
»Echt, der Göring war Fixer?«
Mitch schüttelt sich, spuckt auf den Boden, blickt dann rüber zu Enis. »Ja, war er. Hat halt immer cleanes Zeug gehabt, dann hältst du das jahrelang durch. Da sind wir wieder bei dem Großvater im Einkaufswagen. Wie gesagt, den wirst du nicht los in unserem schönen Deutschland.«
3
Dr. Carl Steinhoff hat einige Telefonate geführt, einige Mails bearbeitet und ein sehr langes Gespräch mit Benno Stiller geführt. Stiller hat ihm deutlich wie selten gesagt, dass er endlich mit dem Ausweichen und Taktieren aufhören müsse.
Carl Steinhoff war wütend danach, Benno war sehr fordernd aufgetreten, völlig respektlos. Aber er hat keine Wahl, er kann Benno nicht zum Teufel jagen, noch nicht. Er braucht ihn und seine Verbindungen.
Carl Steinhoff erhebt sich ächzend aus seinem bequemen Schreibtischstuhl. Leicht hinkend, aber nach wenigen Schritten sicherer, strebt er Richtung Tür.
»Marianne, ich bin weg, habe ein Treffen mit den CCB-Leuten, dann werde ich zu Mittag essen. Ich möchte die nächsten Stunden nicht gestört werden, keine Gespräche durchstellen, bitte. In ganz dringenden Fällen schicken Sie eine SMS.«
Marianne nickt, Steinhoff weiß nur zu gut, dass sie es hasst, jetzt völlig allein im Büro zu bleiben. Als die Außentür des Büros ins Schloss fällt, wartet Steinhoff draußen einen Moment, dann hört er, dass von innen die Tür verriegelt wird. Es gibt zwei Schlösser, und beide werden zweimal abgeschlossen.
Steinhoff lächelt, dann macht er sich auf den Weg. Trotz der Schmerzen im Bein geht er den kurzen Weg zum Hotel Roomers in der Gutleutstraße zu Fuß.
Schon nach wenigen Metern bereut er das. Es ist ein warmer Tag heute, er wischt sich mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn. Er hat zugenommen, das macht sich jetzt bemerkbar. Er bleibt einen Moment stehen, beobachtet sein Spiegelbild in der Heckscheibe eines illegal geparkten SUVs. Eigentlich ist er zufrieden mit seinem Aussehen, die weißen Haare verleihen ihm eine gewisse Seriosität. Seine Augen sind müde, vom Grübeln wie vom Trinken. Dann flucht er plötzlich vor sich hin: »Da steh ich, ein Mann Ende vierzig, schon mit weißen Haaren, und habe immer noch ein verdammtes Vaterproblem. Was hat sich eigentlich geändert in meinem Leben? Immer noch springt mir der verrückte Alte auf der Nase rum.«
Carl Steinhoff hat einen Großteil seiner Jugend alleine mit seinem Vater verbracht. Als der Junge sieben war, warf der Alte seine Mutter raus. Die Frau sackte lieber einen fetten Scheck ein, als um ihren Sohn zu kämpfen. Carl hatte eine freudlose Jugend. Mit fünfzehn wurde er von seinem Alten in einen Puff geschleppt, in dem sein Vater selbst Stammgast war. Carl hasste es, wenn ihm die Frauen erzählten, was für ein toller Typ der Alte sei. Seine Jugend war eine Achterbahnfahrt zwischen Nazisprüchen und einem Schuss Bahnhofsviertel-Gangsterromantik.
Ja, er hatte sich oft alleine, hilflos, ungeliebt gefühlt. Er war nicht nur ohne Mutter, sondern auch fast ohne Freunde aufgewachsen. Sobald er konnte, verließ er die kalte, verhasste Wohnung im Kölner Hof, er mochte die Zinnsoldaten nicht mehr sehen und auch nicht die Spielzeugausgabe von Hitlers Mercedes-Cabrio mit der am Kotflügel montierten Hakenkreuzflagge. Carl studierte Betriebswirtschaft in Heidelberg, fuhr selten nach Hause, bekam einen monatlichen Scheck und versuchte den Alten zu vergessen. Erst wollte er ihn ärgern und spielte mit dem Gedanken, einer linksradikalen Studentengruppe beizutreten. Deren Versammlungen aber langweilten ihn zu Tode. Also beschloss er, die Finger von der Politik zu lassen, und stürzte sich ins Studium. Ihn interessierte nichts wirklich, er wollte nur schnelle Bestätigung und Geld. Geld hatte er bald, aber Bestätigung fehlte, also begann er sie zu kaufen. Wenn er mit Freunden ausging, zahlte er. In dieser Zeit begann er sich für Glücksspiele zu begeistern. Trotz allem gelang ihm ein passables Diplom, mit Mühe schaffte er sogar den Doktor. Dann allerdings fuhr er kurz hintereinander drei Firmen, die er mit wechselnden Partnern gegründet hatte, an die Wand. Unter Hinweis auf sein zu erwartendes Erbe besorgte er sich verschiedene Kredite von der Bank.
Ein einziges Mal hatte er geschäftlichen Erfolg – mit der Beteiligung an einem Fonds, der auf der Kanareninsel Fuerteventura eine Retortenstadt namens Caleta de Fuste hochzog. Er verkaufte rechtzeitig seine Anteile und hatte erstmals Geld. Davon leistete er sich eine Villa in Kronberg, die jetzt sein Ein und Alles ist.
Danach gelang ihm nicht mehr viel, und er begann gezwungenermaßen für den Alten zu arbeiten. Sein Vater liebte es, ihn mit Herr Doktor anzureden und ihn dann zu einem Haufen schwachsinniger Jobs zu verdonnern. Für Carls Selbstbewusstsein war die Konstellation fatal.
Er kompensierte die Beleidigungen des Alten durch Erhöhung seiner Ausgaben. Bald wurde Carl Stammgast der Casinos in Bad Homburg, Wiesbaden und Baden-Baden. Am Roulettetisch fühlt er sich bis heute lebendig. In den letzten Jahren hat sich Carl ausschließlich um die Immobilien des Alten gekümmert. Er begriff, dass das leer stehende Haupthaus samt dem Hotelflügel im heutigen Bahnhofsviertel einen riesigen Wert hatte. Es war einen Pool voller 500-Euro-Scheine wert, und nur der Alte stand zwischen ihm und dem Geld.
Wieder stärker hinkend, überquert er jetzt die Gutleutstraße und betritt die perfekt gestylte Lobby des Designhotels Roomers. Er verschwindet kurz auf der Herrentoilette, um sich frisch zu machen. Sein Spiegelbild gefällt ihm nicht. Der Schweißfilm auf der Stirn stört ihn und die Tränensäcke, die noch größer zu werden drohen. Die kleine Warze links von der Nase wird er sich weglasern lassen. Er trinkt einen Schluck Wasser aus dem Hahn, schreitet dann so energisch wie möglich durch die Lobby zum Aufzug. Er kennt die CCB-Suite 116 nur zu gut.
Zur selben Zeit verlassen in Frankfurt-Höchst zwei bärtige junge Männer, locker westlich gekleidet mit Jeans und Turnschuhen, das alte Postamt, in dem die Arbeiterwohlfahrt Integrationskurse für Flüchtlinge anbietet. Sie überqueren die Hauptstraße, laufen am vorderen Eingang des Asia-Markts vorbei und klopfen an der Tür der kleinen Lagerhalle.
Notdürftig hat man hier versucht, dem Raum das Aussehen einer Moschee zu verleihen. Er ist mit Teppichen ausgelegt, aber an den Wänden fehlt jeglicher Schmuck. Eine einzige Kachel zeigt in arabischen Schriftzeichen den Namen Gottes, sie schmückt die Stirnseite des Raums.
Ibrahim steht etwas abseits, sein hageres Gesicht wirkt nachdenklich, und seine tiefliegenden Augen sind nach innen gerichtet. Immer wieder treffen ihn neugierige Blicke der anderen Anwesenden, auch die der beiden später gekommenen jungen Männer. Niemand im Raum ist älter als dreißig. Hier trifft sich keine normale Gemeinde, hierhin kommt man nur auf Einladung.
Ibrahim ist erst seit wenigen Monaten in Frankfurt, sein Deutsch ist passabel. Ihn umwehen Geheimnisse, Gerüchte, Andeutungen. Er war einige Zeit im Krieg in Syrien, wo er eine gewisse Position im IS gehabt haben soll. Keiner der Leute, die gekommen sind, um ihn zu hören, weiß Genaueres, niemand hat je versucht, das, was man über Ibrahim sagt, zu überprüfen.
Jetzt richtet sich Ibrahim auf, durch seinen weißen Kaftan unterscheidet er sich deutlich von den anderen. Das Gewand verleiht ihm Würde und Autorität.
Er spricht das Gebet.
Die anderen sprechen ihm nach.
Jetzt schweigt Ibrahim, lässt die Stille wirken, hält den erwartungsvollen Blicken stand. Dann spricht er mit klarer, ruhiger, lauter Stimme. Er beginnt mit dem Gotteslob. »Die Herrschaft liegt bei Dir, die Größe liegt bei Dir, es gibt keinen Gott außer Dir.«
Wieder schweigt er. Als er fortfährt, hat sich der Klang seiner Stimme geändert, jetzt spricht er schneller, fordernder, voller Leidenschaft.
»Meine Brüder, wir leben in schweren Zeiten. Unsere Feinde, die Feinde unseres Glaubens, triumphieren. Das Kalifat scheint besiegt, die Armeen der Ungläubigen sind auf dem Vormarsch. Ich aber sage euch, das ist das Bild von heute, nicht die Wahrheit von morgen. Lasst euch davon nicht irre machen, denn das Bild ist falsch. Wir kämpfen mit Gott, und wer mit Gott kämpft, der kann und wird nicht untergehen. Eine neue Phase des Kampfes hat begonnen. Wir wissen jetzt, dass die Soldaten des Islam noch nicht in der Lage sind, gleichzeitig gegen die Flugzeuge und Soldaten Russlands und Amerikas zu kämpfen. Aber das heißt nicht, dass der Kampf verloren ist. Nein, meine Brüder, das heißt, dass der Kampf ein anderer wird.«
Ibrahim schweigt einen Moment, er spürt, dass er seine Zuhörer im Griff hat.
»Hört genau zu, Brüder, wir müssen die Ungläubigen da angreifen, wo sie nicht mit unserem Angriff rechnen. Nicht da, wo ihre Panzer stehen, sondern da, wo sie leben, wo ihre Frauen sind, wo ihre Kinder spielen, wo sie feiern, nämlich hier in ihren Ländern. Deswegen hat Gott uns in ihre Länder geführt. Die Märtyrer in Paris haben uns den Weg gezeigt, die Helden, die den Hurentempel Bataclan gereinigt haben. Die Brüder in Sri Lanka, tapfere Soldaten des Kalifats, haben uns den richtigen Weg gewiesen. Es gibt ein Video, das zeigt, wie ein Bruder mit dem Rucksack, in dem die Bombe steckt, die verfluchte Kirche der Ungläubigen betritt. Achtet auf seine Haltung, er geht schnell, er ist stolz, er ist mit sich und seinem Gott im Reinen. Er ist bereit, sich zu opfern. Dies ist ein heiliger Krieg, und wir haben unsere Lektion gelernt. Wir suchen weiche Ziele. Zivile Opfer verbreiten größeren Schrecken, schaffen noch mehr Ängste. Und wir werden diesen Kampf mit Gottes Hilfe siegreich beenden.«
Vor der Tür zu Suite 116 wischt sich Dr. Steinhoff noch einmal über die Stirn. Dann streckt er sich, klopft fest gegen die Tür. Eine knappe Minute später öffnet der junge Mitarbeiter der CCB, der immer einen leicht ironischen Gesichtsausdruck zur Schau trägt, die Tür.
»Dr. Steinhoff, wie schön, dass Sie es einrichten konnten.«
Wieder wundert sich Carl Steinhoff über den amerikanischen Akzent des jungen Mitarbeiters, der schließlich auf den guten deutschen Namen Rainer Nester hört. Werde ihn bei Gelegenheit fragen, denkt Steinhoff und erschrickt, als plötzlich ein hochgewachsener Mann auf ihn zukommt, Mitte vierzig, der einen teuren, gewiss maßgeschneiderten Nadelstreifenanzug trägt.
»Dr. Steinhoff, ich darf mich vorstellen, Dr. Thomas Dietze, ich komme aus der Europa-Zentrale der CCB in London, ich will Sie unbedingt kennenlernen.«
Zwei kalte graue Augen mustern Steinhoff, der sich sofort unbehaglich fühlt. Weit hinten im Raum fällt ihm ein Beistelltisch auf, auf dem eine Flasche Scotch, Wasser und etwas Eis steht. Er muss sich beherrschen, dem Verlangen nach einem Drink widerstehen.
Dr. Dietze bittet Steinhoff, Platz zu nehmen. Dann gibt er seinem Mitarbeiter ein Zeichen, der ins Nebenzimmer eilt und mit einigen Papierrollen zurückkommt.
»Ich möchte Ihnen, lieber Herr Dr. Steinhoff, zeigen, dass wir in den letzten Wochen alles andere als untätig waren. Unserer Gesellschaft liegt sehr daran, unser gemeinsames Projekt voranzubringen, vor allem endlich mehr Geschwindigkeit zu entwickeln. Wir sehen dieses Projekt als Leuchtturm für unser Engagement in Frankfurt. Damit wollen wir uns auf dem Frankfurter Markt festsetzen.«
Auf dem Tisch werden Baupläne entrollt. Alle tragen oben rechts den Stempel CCB Invest.
Steinhoff blickt auf eine der Zeichnungen, erkennt unschwer die Außenfassade und die aufgeschnittenen Geschosse des Gebäudes seines Vaters. Dr. Dietze lenkt mit leuchtenden Augen die Aufmerksamkeit auf eine Zeichnung des Dachgeschosses. »Hier, das wird das Flaggschiff, ein Duplex mit Dachterrasse und Rooftop-Pool, knapp 300 Quadratmeter. An der Messe und im Westend werden für etwas Vergleichbares vier Millionen aufgerufen, hier in dieser Lage sind bis zu fünf Millionen drin. Der Markt ist günstig, es wimmelt von chinesischen und russischen Investoren, die ihr Geld im sicheren Westen parken wollen. Besser als jetzt kann es nicht mehr werden. Wir müssen nur bald loslegen, ein Projekt dieser Größenordnung braucht Zeit. Es wird ein politisches Gezeter geben, wir werden erleben, dass Gutmenschen und Puffbesitzer gemeinsam für die gewachsenen Strukturen des Viertels demonstrieren werden. Wir brauchen Zeit und Geld für die politische Landschaftspflege. Und damit bin ich beim Thema. Wir können die genaue Finanzierung erst festmachen, wenn wir eine glasklare Absichtserklärung des Eigentümers der Immobilie haben. Wie weit sind Sie damit?«
Die beiden schlanken Herren in den eleganten Businessanzügen blicken jetzt beide ihr Gegenüber an.
Steinhoff fährt sich mit einer fahrigen Handbewegung über sein fast weißes Haar. Sein fülliges Gesicht schimmert wieder feucht, er fühlt sich unwohl und beginnt noch stärker zu schwitzen. Er weiß, dass er dadurch einen unsicheren Eindruck macht, und so richtet er sich auf, zeigt seine stattlichen 185 Zentimeter. Er zerrt seinen Janker gerade und versucht sich an einem entschlossenen Gesichtsausdruck. »Verdammt, es ist nicht einfach mit dem alten Herrn. Sie kennen ihn nicht. Ich versuche es zweigleisig. Auf die gutmütige Tour, ich bin der liebe Sohn, der sich um ihn Sorgen macht, und gleichzeitig bereite ich die harte Variante vor und treibe seine Entmündigung voran. Ich habe bereits Kontakt zu seinem Hausarzt.«
Jetzt ergreift der jüngere Mann, der mit dem amerikanischen Akzent und dem deutschen Namen, das Wort. »Bitte, Dr. Steinhoff, überraschen Sie uns doch mal. Wie rasch kommen Sie voran?«
»Geben Sie mir Zeit, ich kann nicht sagen, wie lange ich brauche, aber wir reden von Monaten, nicht von Jahren.«
Jetzt federt der Londoner Chef von seinem Stuhl hoch. »Wo leben Sie eigentlich, Dr. Steinhoff? Jahre, Monate, noch was? Ich rede von Wochen, von wenigen Wochen. Ihnen ist schon klar, dass wir nicht unerhebliche finanzielle Vorleistungen auf uns genommen haben, nicht zuletzt in Form von knapp einer Million Euro, die auf Ihr Konto geflossen sind. Wir sind geduldige Menschen, aber wir sind auch nicht das Rote Kreuz.«
Die Spannung im Raum ist jetzt zu greifen.
»Bitte, halten Sie den Ball flach, angesichts der Größe des Objekts ist die Million ja nun wirklich Kleingeld und ein zu vertretender Vorschuss.« Dr. Steinhoff steht auf und gießt sich einen ordentlichen Scotch ein. Er schaut fragend in die Runde, die beiden Nadelstreifen schütteln abwehrend den Kopf.
»Kleingeld ist relativ, wir müssen unsere Ausgaben rechtfertigen, und zwar vor recht unangenehmen Kollegen. Die möchten Sie nicht kennenlernen. Sie, Dr. Steinhoff, haben uns gegenüber eine rechtsverbindliche Vorvereinbarung unterzeichnet, in der Sie so tun, als könnten Sie über das Grundstück frei verfügen. Erst scheibchenweise kam dann die ganze lächerliche Story mit Ihrem senilen Vater hoch. Es ist ganz einfach: Entweder unterzeichnet Ihr Vater innerhalb von einem Monat den Kaufvertrag oder die CCB wird Sie, Herr Dr. Steinhoff, für alle bisher angefallenen Kosten und alle Vorauszahlungen in Regress nehmen. Haben wir uns verstanden?«
Steinhoff hält das Glas gegen das Licht, erfreut sich an dem bernsteinfarbenen Leuchten des Whiskys. »Ist klar, ich regle das. Und verklagen Sie mich ruhig, dann werden Sie weder die Immobilie noch Ihr Geld sehen.«
Dr. Dietzes Augen sind jetzt eiskalt. »Irren Sie sich da nicht, Herr Steinhoff? Nach meinen Informationen ist die von Ihnen bewohnte Villa in Kronberg auf Ihren Namen eingetragen. Da war Papi wohl mal großzügig. Die können Sie gerne an uns abtreten. Verdammt, zeigen Sie endlich dem Alten, dass Sie ein Mann sind. Und noch etwas: In dem Gebäude befindet sich eine Moschee, von der noch nie die Rede war. Hallo, die muss weg, und zwar subito, sodass niemand einen Zusammenhang zwischen unserem Erwerb des Gebäudes und der Schließung der Moschee konstruieren kann. Da brauchen wir einen klaren zeitlichen Puffer. Ich habe keine Lust, mir eine Religionsdebatte einzufangen, und ich will auch keine Kopftücher und Gutmenschen vor unseren Büros demonstrieren sehen. Ist das klar? Sehen Sie zu, dass der Mietvertrag zeitnah gekündigt wird, Gründe dafür sollten zu finden sein. Ich will keinen Krieg, aber wenn es sein muss, können Sie ihn haben.«
Der Mann im Janker betrachtet noch einmal sein Glas, nimmt einen Schluck, nickt, verlässt abrupt den Raum, ohne sich zu verabschieden.
Als die Tür ins Schloss fällt, nickt der jüngere der beiden Nadelstreifen: »Wenigstens hat er diesmal nur zwei Drinks genommen, das letzte Mal waren es mindestens vier.«
Dr. Dietze wiegt zweifelnd den Kopf. »Gut, wir haben ihm jetzt etwas Dampf gemacht, aber ich bin mir nicht sicher, ob es reicht. Er hat die Hosen gestrichen voll, ich weiß aber nicht, ob er mehr Angst vor uns oder vor dem Alten hat. Muss ein echt harter Brocken sein, der Steinhoff senior. Vielleicht müssen wir selber einen Plan B vorbereiten. Der Mann ist schließlich schon ziemlich alt.«
Ibrahims rechte Hand mit dem ausgestreckten Zeigefinger schießt nach oben, er zeigt den Gruß des IS.
»Der Bruder Abu Bakr Naji hat uns folgenden Satz gelehrt: Militärische Macht nach außen hat keinen Wert ohne den inneren Zusammenhalt der Gesellschaft. Was meint er damit? Wir leben inmitten der Gesellschaft des Feindes. Wir müssen den inneren Zusammenhalt der westlichen Gesellschaften zerbrechen, wir müssen den Feind zu Reaktionen provozieren, die vom liberalen Teil der westlichen Gesellschaften abgelehnt werden. Bruder Abu Bakr Naji, er war ein hochgeachtetes Mitglied der Führung von Al Qaida, sagt weiter: Werden Muslime angegriffen, werden sie bei anderen Muslimen Schutz suchen. Für die Gesellschaften hier, in denen wir zurzeit zu leben gezwungen sind, heißt das, wir müssen mit allen Mitteln die Gesellschaft spalten, wir müssen polarisieren. Es gibt keine Gemeinsamkeit, keine Freundschaft mit den Kreuzfahrern. Es heißt immer SIE gegen UNS, WIR gegen SIE. Wenn wir die Kreuzfahrer dazu bringen, uns Muslime anzugreifen, dann werden sich die Gläubigen unter der Fahne des Kalifats versammeln.«
Ibrahim holt Luft, nimmt einen Schluck Wasser. Er genießt die faszinierten Blicke, das Glitzern in vielen Augen. Er ist zufrieden, kommt jetzt schnell zum Ende.
Einer seiner Zuhörer, ein junger Türke namens Ahmed, will ein Selfie mit Ibrahim, der aber schüttelt ablehnend den Kopf. »Bitte, Bruder, keine Fotos hier, das ist zu gefährlich.«
Ahmed nickt entschuldigend, steckt sein Handy ein, verabschiedet sich von Ibrahim. Dann verlässt er die Halle, draußen vor der Tür checkt er sofort sein Handy, nickt zufrieden, er hat Ibrahims Rede komplett mitgeschnitten. Auch das ist streng verboten, aber Ahmed will sich die Predigt unbedingt noch mal in Ruhe anhören.
Drinnen leert sich langsam die Halle. Alle verabschieden sich respektvoll, versichern Ibrahim ihrer Treue und Gefolgschaft. Am Ende bleiben zwei junge Männer mit ihm zurück.
Der Jüngere, dem man seine Erregung deutlich ansieht, fasst sich ein Herz. »Du hast klar und weise gesprochen, Ibrahim, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, kommt es nicht nur auf das Reden und das Beten an. Wann wirst du uns lehren zu handeln?«
Ibrahim lächelt. »Das will ich dir sagen, mein Bruder, an dem Tag, an dem nicht einer, nicht zwei, sondern zehn nach der Predigt bleiben und deine Frage stellen. An dem Tag hören wir auf zu reden.«
Der Junge nickt begeistert. »Zähl auf mich, mein Leben gehört dir.«
Nicht eine Minute später ist Ibrahim allein in der Halle. Er wischt sich den Schweiß von der Stirn, setzt sich in eine Ecke des Raums, lehnt den Oberkörper gegen die Wand. Er schließt die Augen, hört in sich hinein.
Er kehrt zurück in seine afghanische Heimat, er sieht die staubigen Straßen von Kundus, hört lautes Schreien, spürt die Panik, die damals wie Feuer in den schmalen Körper eines sechsjährigen Kindes gefahren war. Er sieht den Vater zusammenbrechen, sieht wilde bärtige Männer mit ihren Maschinenpistolen fuchteln, sieht plötzlich Blut auf dem Gewand der Mutter, sieht sie ins Dunkle fallen, ahnt ihren letzten Blick voller Liebe und Verzweiflung.
Dann ist Stille um ihn, die Bilder sind zerhackt, ihr bescheidenes Haus brennt, er sieht den Esel im brennenden Stall, das Maul weit aufgerissen, die Zähne gebleckt, er weiß genau, der Esel schreit um sein Leben, aber er hört keinen Ton. Immer wieder erschrickt ihn das Bild des lautlos schreienden Esels. In dieser Nacht damals endete seine Kindheit, und alles, was von ihr blieb, ist ein stumm schreiender Esel.
Ibrahim wuchs bei einem Onkel auf, der den Jungen vor eine unlösbare Aufgabe stellte. Er erzog Ibrahim im Sinne eines strengen Islam, aber er schärfte ihm auch ein, nie zu vergessen, dass es ein Taliban-Kommando war, das seine Familie ausgelöscht hatte.
Als der Onkel spürte, dass seine Zeit gekommen war, schickte er Ibrahim nach Kabul, wo er ihm einen Platz in der amerikanischen Schule besorgt hatte. Seinen Lehrern fielen schnell seine außergewöhnliche Auffassungsgabe und sein Talent zur Anpassung auf.
Ibrahim schüttelt sich jetzt, versucht sich von den Erinnerungen zu befreien. Er braucht eine gute Minute, bis er wieder klar denken kann.
Manchmal verliert er sich in seinen Gedanken, immer häufiger hat er das Gefühl, nicht wirklich zu wissen, wer er eigentlich ist. Wenn er mit sich allein ist, verspürt er Trauer und eine tiefe Verlorenheit. Und dagegen hat bisher kein Gebet geholfen.
Er wühlt in den Tiefen seines Kaftans nach seinem Handy und tippt eine längere Nummer ein. Er schreibt: »Ich bin es, Ibrahim. Verdammt, sie sind blutleer wie eine Horde Schafe, wir müssen ihnen Feuer machen. Christchurch ist schon zu lange her, zu weit weg. Wir müssen nachdenken, sonst hänge ich ewig in dieser Stadt fest.«
Mitch und Enis ziehen weiter durch die Straßen des Viertels. Enis hat die Gabe, Menschen zu öffnen, er verwickelt sie spielend leicht in Gespräche. Mitch beginnt zu verstehen, wie mühsam das Leben der kleinen Händler ist. Viele haben Angst um ihre Geschäfte, alle bekommen die Veränderungen im Viertel mit, alle fürchten, die ersten Opfer der befürchteten Verdrängung zu werden. Vor einem Fischladen klatscht Enis einen Bekannten ab. Der Fischhändler redet sich in Rage, fixiert Mitch und legt los.
»Immer wenn der Erdogan eine Wahl gewinnt, fragt mich jeder zweite Deutsche, warum wir so einen Mist wählen. Wenn aber ein CHP-Mann in Istanbul zum Bürgermeister gewählt wird und die ganze Welt das als Ohrfeige für Erdogan feiert, dann gratuliert mir höchstens ein deutscher Kunde. Warum, sag mir, warum? Den Deutschen ist es immer lieber, wenn sie schimpfen und kritisieren können. War schon immer so. Damals bei der WM in Deutschland, werde ich nie vergessen, habe ich Fische zum Italiener um die Ecke geliefert. Der Mann lebt seit Jahrzehnten in Deutschland, seine Kinder gehen hier zu Schule. Luigi war völlig fertig. Am Abend vorher hat Italien gegen irgendwelche Afrikaner gespielt, und alle seine deutschen Kunden haben für die Schwarzen gejubelt. Aber danach wollten sie von ihm einen Grappa aufs Haus. Hat er gesagt: Holt euch euren verfickten Grappa in Afrika. Ist doch verrückt. Die trinken jeden Abend bei ihm und halten dann mit seinem Gegner.«
Der Fischhändler klopft Mitch aufmunternd auf die Schulter. »Kannst ja nichts dafür, aber ihr seid echt komisch. Bei mir kommt das Amt und kontrolliert Küche und Kühlhaus. Wenn irgendwas nicht stimmt, gibt es Riesenärger. Aber draußen auf der Straße sitzen die Junkies, und die Polizei läuft vorbei und schaut weg. Wenn ich mich beschwere, den Bullen sage, dass ich keinen Bock habe, morgens die Spritzen aufzukehren, dann laufen sie einfach weiter.«
Mitch nimmt dankend ein Bier an. Mehmet, der Fischhändler, hat sich in Rage geredet und ledert jetzt gegen die deutsche Asylpolitik. »Ich kenne die Araber viel besser als ihr. Ihr lasst euch von denen verarschen. Gut, dass die Syrer kommen, denen muss man helfen in dem fürchterlichen Krieg. Sind ja auch viele in der Türkei. Aber warum gebt ihr Dealern aus Marokko und Algerien Asyl, die da vorne die Leute am Bahnhof abzocken? Die lachen über eure Polizisten. Die werden am Montag von den Bullen festgenommen und holen sich am Dienstag Stütze ab. Ihr seid zu blöd. Die Jungs lachen euch aus. Und dann werden eure Leute sauer und wählen die Nazis. Und was machen die Nazis? Die killen uns. Haben die beiden vom NSU