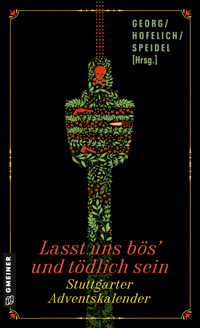
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Öffnen Sie jeden Tag ein literarisches Türchen und lassen Sie sich überraschen, welcher packende Kurzkrimi in und um Stuttgart heute auf Sie wartet! 12 renommierte Autorinnen und Autoren erkunden die Abgründe ihrer Heimat und jagen Ihnen in 24 fesselnden Kurzgeschichten rund um die Kesselstadt einen wohligen Schauer über den Rücken. Jede Geschichte ist ein kleines Meisterwerk, das Sie in die düstere Welt des Verbrechens und der Geheimnisse eintauchen lässt. Von frostigen Schandtaten bis hin zu bösen Überraschungen im festlichen Glanz - jede Geschichte hält Sie in Atem und sorgt für spannende Lesestunden in der Vorweihnachtszeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rudolf Georg; Julia Hofelich; Joachim Speidel (Hrsg.)
Lasst uns bös’ und tödlich sein
Stuttgarter Adventskalender
Zum Buch
O du Mörderische …Stellen Sie sich vor, Sie öffnen jeden Tag im Dezember ein Türchen und werden mit einem neuen, packenden Krimi überrascht. Dieser »Stuttgarter-Krimi-Adventskalender« mit seinen 24 fesselnden Kurzgeschichten bietet genau das! Jede Geschichte ist ein kleines Meisterwerk, das Sie in die düstere Welt der Verbrechen eintauchen lässt. Von frostigen Schandtaten und bösen Überraschungen in festlichem Glanz über tödliche Delikatessen beim Raclette auf der Gänsheide oder beim Italiener in Ludwigsburg bis zu gruseligen Erlebnissen von Bestattern in Fellbach und im Schurwald. Von Weihnachtsmännern, die in Stuttgart versehentlich zu Helden werden oder in Waiblingen schwer bewaffnet auftauchen, bis hin zu Auftragsmorden auf Mittelaltermärkten, schaurigen Ereignissen auf dem Hoppenlau-Friedhof, finsteren Gestalten in rauen Nächten und noch vielem Abgründigem mehr. 24 Geschichten von 12 renommierten Stuttgarter Autorinnen und Autoren warten auf Sie – für spannende Lesestunden in der Vorweihnachtszeit!
Die Krimi-Autoren Rudolf Georg, Julia Hofelich und Joachim Speidel bestreiten mit ihrem Programm »MordsFrau trifft MordsKerle« seit Jahren gemeinsame Lesungen. Sie haben sich mit neun weiteren Autorinnen und Autoren aus der Region Stuttgart zusammengetan, um diesen Adventskalender mit kriminellen Kurzgeschichten zu füllen.
Rudolf Georg ist eines der Pseudonyme eines Stuttgarter Rechtsanwalts. Die Sprache ist stets sein Handwerkszeug. Während er im Berufsleben juristische Fachliteratur veröffentlicht, schreibt er zur Entspannung, was ihm selbst Spaß macht – nämlich Krimis.
Julia Hofelich war Rechtsanwältin, bis die Protagonistin ihrer ersten Thriller-Reihe diese Tätigkeit für sie übernahm. Seither verteidigen ihre Hauptfiguren Angeklagte in verzwickten Mordprozessen oder ermitteln in gefährlichen Fällen – und Julia kann sich endlich in Ruhe dem Schreiben widmen.
Joachim Speidel hat vor vielen Jahrzehnten Germanistik »durchaus studiert mit heißem Bemühen« und ist anschließend Lektor und Autor von Kurzgeschichten und Romanen geworden. Wenn es um das Schreiben von Krimis geht, hat er eine ausgeprägte Schwäche für schräg-skurrile, aber auch für Storys im »Hardboiled«-Stil.
Impressum
Autoren und Autorinnen im Syndikat. Spannung garantiert!
Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2025 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Susanne Tachlinski
Satz/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Illustration Lutz Eberle mit Elementen von KatyaKatya / stock.adobe.com
ISBN 978-3-7349-3446-9
Inhalt
Zum Buch
Impressum
Vorwort
1. Türchen: Eine Praline für Herzogin Franziska
2. Türchen: Cinghiale speciale
3. Türchen: Das Genovese-Syndrom
4. Türchen: Mordmanntanne
5. Türchen: Weihnachtswerwolf
6. Türchen: PULP Christmas
7. Türchen: Schneetreiben
8. Türchen: Der dritte König
9. Türchen: Weihnachtswünsche
10. Türchen: Mein schönstes Weihnachtsfest
11. Türchen: Weih. Nachts. Tod.
12. Türchen: Dannemann
13. Türchen: Weihnachtsmann, geh du voran!
14. Türchen: Hubi ist tot
15. Türchen: Schlussakkord
16. Türchen: Stirb langsam auf dem Hoppenlau-Friedhof
17. Türchen: Weihnachtsmann anstelle des Weihnachtsmanns
18. Türchen: Weih. Nachts. Beichte.
19. Türchen: Marie
20. Türchen: Weihnachts-Äh
21. Türchen: Wünsch dir was
22. Türchen: Der Joker
23. Türchen: Triggerwarnung
24. Türchen: Raunacht
Autoren
Vorwort
Weihnachtlich geschmückt ist jedes Haus, Tannen- und Plätzchenduft vermischen sich zu dieser unnachahmlichen Melange, die am Ende eines jeden Jahres für Gemütlichkeit steht. Besinnlichkeit und Frieden ziehen ein ins Ländle.
Doch manchmal kann es in dieser ach so beschaulichen Zeit auch laut und ungemütlich werden. Und bösartig, mörderisch …
Zwölf Krimi-Autorinnen und -Autoren aus der Region Stuttgart haben hinter jedem Türchen dieses Adventskalenders eine Kurzgeschichte versteckt, mal mit, mal ohne Mord, aber immer spannend. Mal aus Täter-, mal aus Opfer-Perspektive. Teils klassisch-kriminell, teils lustig, teils skurril, teils schräg, aber immer für eine Überraschung gut.
Die drei Herausgeber, die mit ihrem Programm »MordsFrau trifft MordsKerle« seit Jahren Krimi-Lesungen bestreiten, haben sich mit neun weiteren Mitgliedern des Syndikats, des Vereins für deutschsprachige Kriminalliteratur, zusammengetan, um Leserinnen und Lesern in der Vorweihnachtszeit ein Mordsvergnügen zu bereiten.
Rudolf Georg
Julia Hofelich
Joachim Speidel
1. Türchen: Eine Praline für Herzogin Franziska
von Martina Fiess
Ob Herzogin Franziska von Hohenheim jemals eine Bratwurst auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt verspeist hat? Überliefert ist davon nichts, auch wenn es diese Veranstaltung zu ihren Lebzeiten bereits gab. Heute würde die beliebte Landesherrin dort eine zu ihren Ehren entwickelte Weihnachtspraline verkosten – und das gut 200 Jahre nach ihrem Tod. Was nach einem Weihnachtswunder klang, war eine Idee meines geschäftstüchtigen Chefs André Hohlberg. Im Auftrag seiner Werbeagentur führte ich zahlungskräftige Kunden zu den Highlights unserer Stadt wie der Markthalle, den Weinbergen oder Schloss Solitude. Um den Teilnehmern ein authentisches Erlebnis zu bieten, musste ich mich dabei als adelige Ländles-VIP verkleiden.
Bei der heutigen Tour begleitete ich einige Manager eines Schokoladenherstellers, der zu den Agenturkunden gehörte, über den Weihnachtsmarkt. Krönender Abschluss sollte die Verkostung einer Weihnachtspraline mit dem Namen »Franzi-Kugel« sein. Zu dieser Weltpremiere hatte André das Regionalfernsehen und weitere Medienvertreter eingeladen. Für den prestigesüchtigen Agenturchef war das Event ein gelungener Coup, für mich eine Tortur, denn im Kostüm von Herzogin Franziska steckte niemand anderes als ich. Mein riesiger Strohhut mit grauer Schleife und Straußenfeder passte nicht zur Jahreszeit und war im Gedränge genauso unpraktisch wie der Reifrock.
Mit meinen ausladenden Trompetenärmeln bahnte ich mir einen Weg durch die gaffenden Besucher zum Alten Schloss, der letzten Station meiner Führung. Im prunkvollen Innenhof sollte gleich die Schokoladenpremiere stattfinden. »Wie Sie vielleicht wissen«, erklärte ich gerade, »wurde das Alte Schloss im zehnten Jahrhundert als Wasserburg gegründet, um ein Gestüt namens Stutengarten zu schützen.«
»Das ist interessant«, meldete sich ein Teilnehmer mit Hipsterbrille im blauen Wollanzug zu Wort, dessen Stirn von Schweißperlen bedeckt war. Statt winterlicher Kälte und Schneetreiben brüteten 14 Grad im Stadtkessel. »Stammt daher der Name Stuttgart?«
»Richtig, Herr Dannecker«, sagte ich zu dem Mann, der kürzlich zum neuen Leiter der Produktentwicklung befördert worden war, und nickte vorsichtig. Mein Kopfputz war mit altmodischen Hutnadeln befestigt, dennoch wollte ich nicht riskieren, dass er verrutschte und ich mich zum Gespött machte.
»Der Name unserer Landeshauptstadt geht auf das Gut Stutengarten zurück«, erwiderte ich und hob den Reifrock an, um die Treppe zum Innenhof des Alten Schlosses unfallfrei hinaufzuschreiten. Dabei kamen meine nicht mehr ganz weißen Sneaker zum Vorschein, die bequemer als die vorgesehenen Samtpantöffelchen waren und außerdem ein kleiner Akt der Rebellion gegen meinen Chef, der mich zu dieser Maskerade verdonnert hatte.
Für die Weltpremiere hatte André den Schlosshof exklusiv gemietet und keine Kosten gescheut, um die Medien zu beeindrucken. Ein Beduftungsspezialist sorgte für Glühwein- und Zimtaromen, die Arkadengänge waren mit Tannenbäumen festlich dekoriert, und Laser projizierten leuchtende Sterne aufs Schlossdach. Aus unsichtbaren Lautsprechern drang dezentes Glockenläuten. Obwohl ich wusste, dass mein Chef Schnee aus dem Nordschwarzwald hatte herkarren lassen, staunte ich über die gut zehn Zentimeter hohe Schneedecke auf dem Kopfsteinpflaster und auf der Bühne neben dem Reiterdenkmal von Graf Eberhard. Ein gutes Dutzend Medienvertreter wartete unter einem Banner mit der Aufschrift »Weltpremiere«.
Auf der Bühne rückte meine Agenturkollegin Jeannette die Etageren voller Schokoladen-Köstlichkeiten zurecht und winkte mich zu sich. Ich bedankte mich bei meiner Gruppe und ging zu ihr. Der schmelzende Schnee durchnässte meine Sneaker und ich bekam kalte Füße. Auch im übertragenen Sinn, denn ich hasste es, in lächerlicher Verkleidung öffentlich zur Schau gestellt zu werden.
»Gleich geht’s los«, raunte Jeannette und wischte den Schweiß von meiner Stirn. Wie üblich hatte sie ihrem schwarzen Hosenanzug, der dem Agentur-Dresscode entsprach, einen Farbtupfer hinzugefügt, heute war es ein mit goldenen Barockengeln bedrucktes Halstuch.
»Jake ist startklar.« Sie wies zum Bühnenrand. Von dort aus würde unser Influencer die Verkostung per Livestream in die sozialen Medien übertragen.
»Verehrte Damen und Herren«, begrüßte unser Agenturchef die Gäste und richtete seine 1,75 Meter, von denen extrabreite Schulterpolster ablenken sollten, zu voller Größe auf. »Willkommen zur Weltpremiere einer neuen Schokoladen-Kreation, der Franzi-Kugel, zu Ehren von Herzogin Franziska von Hohenheim, die sie heute persönlich verkosten wird.«
Während er sich in Vorfreude auf den Umsatz die Hände rieb, übte ich mich im herzoglichen Winken, das ich mir von Queen Elizabeth abgeschaut hatte. Ein Raunen ging durch die Zuschauer, und sämtliche Handys filmten meinen Auftritt. Trotz des beinharten Korsetts sank ich zusammen und wäre am liebsten hinter den geschmückten Weihnachtsbaum neben dem Eingang des Landesmuseums geflüchtet.
Während der Chef die Manager der Schokoladenfirma und den neuen Produktentwickler Dannecker vorstellte, zischte Influencer Jake etwas zur mir herüber.
»Bea, deine Christbaumkugeln sind verrutscht.« Mit dem Kinn wies er auf mein Dekolleté. Unauffällig rückte ich das Korsett zurecht, bis es meine Brüste wieder staatstragend präsentierte.
Landesherrinnengleich ließ ich den Blick über die Journalisten gleiten, als mir ein schwarz gekleideter Mann mit Rucksack auffiel, dessen finstere Miene nicht zu den begeisterten Gesichtern passen wollte. Der Mann kam mir bekannt vor, doch bevor mein Gehirn die passende Information parat hatte, drängte mich André zu der silbernen Etagere, auf der eine Franzi-Kugel lag.
Um kein Wort zu verpassen, schob ein Reporter sein an einem Teleskoparm befestigtes Mikro auf uns zu.
»Nun ist es endlich so weit: die Weltpremiere der Franzi-Kugel«, verkündete mein Chef voller Stolz, so als hätte er persönlich die Schokolade angefertigt. Er hob die Etagere an. Feierlich nahm ich die mit Kokosstreuseln verzierte Praline aus ihrer Seidenpapiermanschette.
»Eine fantasievolle Kreation aus Lebkuchen und Schlehenlikör, Eure Hoheit«, lobte mein Chef sich selbst. »Nach meinem Geheimrezept hergestellt in der hauseigenen Manufaktur der Schokoladenfirma und mit viel Liebe …«
Im Publikum wurde es unruhig. Die Menge teilte sich, und der Mann in Schwarz, der mir eben aufgefallen war, hielt direkt auf die Bühne zu. Er griff in seine Blousonjacke und zog eine Pistole heraus.
Vor Schreck ließ ich die Franzi-Praline fallen, die mit vernehmbarem »Plopp« im schmelzenden Schnee verschwand.
Der Mann mit der Pistole sprang beherzten Schrittes auf die Bühne, deren Bretter unter meinen Sohlen vibrierten. Genau in diesem Moment verstummten die Glockenklänge, und jeder konnte hören, was nun folgte.
»Hohlberg, du Betrüger!«, stieß der Angreifer aus und richtete die Pistole auf meinen Chef. »Nun musst du endlich Farbe bekennen!« Er ließ den Rucksack von seinem Rücken gleiten und nahm ihn zwischen die Beine.
Andrés Gesicht wurde vanillefarben wie die hellen Pralinen hinter ihm. »Hajek! Was willst du denn hier?«, rief er und rückte seine Krawatte zurecht, als wäre ihm der Hemdkragen zu eng geworden. »Das ist meine Weltpremiere, hier hast du nichts zu suchen!«
Nun ging mir auf, woher ich den Störenfried kannte. Es war niemand anderes als Hans Hajek, der frühere Produktentwickler der Schokoladenfirma. Die untere Hälfte seines Gesichts war von einem dunklen Bart bedeckt, und die Haare hingen ihm über die Ohren, als wäre ihm sein Äußeres unwichtig geworden.
Ende Oktober war Hajek von einem Tag auf den anderen verschwunden, und Dannecker hatte die Produktentwicklung übernommen. Unsere Werbeagentur hatte den Grund für diesen Wechsel nicht erfahren. Vielleicht traf das auch nur auf mich zu, denn Andrés betretene Miene verriet mir, dass er mehr darüber wusste als ich.
Als Hajek sich bückte und den Verschluss seines Rucksacks aufschnappen ließ, wich die erste Reihe des Publikums zurück.
»Da ist eine Bombe drin!«, stieß jemand aus.
Eine Frau schrie: »Die Polizei! Alarmiert die Polizei!«
Hajek kümmerte sich nicht um den Aufruhr vor der Bühne. Seelenruhig wandte er sich zu mir und befahl: »Du da in dem Kleid, sammel die Handys ein! Nur die Journalisten können ihre behalten.«
»Meinen Sie mich?«, stotterte ich und schüttelte den Kopf so energisch, wie ich es mit meinem Kopfputz wagen konnte, ohne ihn ins Rutschen zu bringen.
Kurz lachte Hajek auf. »Ach, das sind ja Sie, Frau Pelzer. Mit dem Monster auf dem Kopf habe ich Sie gar nicht erkannt.« Seine Züge wurden wieder ernst.
Mit weichen Knien verließ ich die Bühne und formte mangels Tasche eine Vertiefung in meinem Reifrock. Ein Schokoladenmanager nach dem anderen warf sein Handy hinein.
Inzwischen hatte Hajek veranlasst, dass die Gittertür zum Schlossplatz geschlossen wurde. Vermutlich wollte er nicht gestört werden. Die Frage war nur, bei was.
Zurück auf der Bühne, ließ ich die Handys auf den Boden gleiten.
Hajek wies mit der Pistole auf meine Agenturkollegen. »Die da auch.« Er wandte sich an das Publikum. »Alle aus meiner Firma ein Stück zurück, die Journalisten treten bitte zur Bühne. Filmen Sie alles, was ich gleich sagen werde, verstanden? Und übertragen Sie es live ins ganze Land.«
Die Medienvertreter hoben sensationslüstern ihre Handys, Kameras und Mikrofone an. Offenbar wog die Quote schwerer als die Angst um das eigene Leben.
Unser Influencer Jake reichte mir nur widerwillig sein Smartphone. André war der Nächste. Seine Miene war undurchdringlich. Ob er wusste, was Hajek vorhatte? Ich ging weiter zu Jeannette, die in Zeitlupe ihren Blazer abtastete, als könnte sie ihr Handy nicht finden.
»Bea, was hat der Typ nur vor?«, flüsterte sie. »Hast du gesehen, was er in seinem Rucksack hat? Etwa eine Bombe?«
Auch wenn beim Wort »Bombe« mein Herzschlag aussetzte, schüttelte ich den Kopf. »Ich glaube nicht, dass Hajek uns in die Luft sprengen will.«
Jeannette fuhr mit ihren Hosentaschen fort. »Wie ist der Typ mit der Pistole überhaupt auf den Weihnachtsmarkt gekommen? Die Polizei kontrolliert doch alle Zugänge.«
»Vielleicht hat er sie bereits vor der Eröffnung hier versteckt.«
»Oder er hat einen Komplizen.« Jeannette kniff die Lider zusammen und fixierte das Publikum, als könnte sie denjenigen dort ausmachen.
»Hey, was ist da hinten los?«, brüllte Hajek in unsere Richtung. »Frau Pelzer, her mit den Handys, und zwar sofort!«
Nervös bahnte ich mir den Weg zurück zur Bühne und legte die Telefone zu den anderen auf den Boden. Dann schob ich den Strohhut aus meiner stressfeuchten Stirn. Was, wenn Hajek doch eine Bombe in seinem Rucksack hatte?
Wie aufs Stichwort drang von außerhalb der Schlossmauern das Heulen einer Polizeisirene in den Innenhof. Die Polizei wusste demnach von unserem Schlamassel. Durch die Gittertür zum Schlossplatz waren das Knallen mehrerer Autotüren und Stimmen im Befehlston zu hören. Offenbar räumte die Polizei die angrenzenden Straßen und Weihnachtsmarktbuden, um keine weiteren Menschenleben zu gefährden.
Der neue Produktionsleiter Dannecker trat zur Bühne. Er hob die Hände an und signalisierte damit, dass er nur verhandeln wollte. »Hajek, lass die Gäste gehen. Wir sollten das unter uns regeln. Du, André Hohlberg und ich.«
Die einzige Regung unseres Kidnappers war ein Heben der Augenbraue. Dann warf er einen verächtlichen Blick auf meinen Chef, dessen Gesichtsfarbe von Vanille zu Erdbeere wechselte.
Ein Journalist in der ersten Reihe fuchtelte mit seinem verlängerten Stabmikro vor Hajeks Gesicht herum. »Herr Habek, mein Sender bietet Ihnen ein Exklusivinterview an. Es wird live gesendet.«
»Hajek, mein Name ist Hajek«, stellte der frühere Produktionsleiter richtig. »Geduld, Sie bekommen gleich Material. Es dauert nicht mehr lange.«
Statt an meinen bisherigen Platz zurückzukehren, wählte ich einen größeren Sicherheitsabstand zu Hajek. Plötzlich spürte ich etwas Weiches unter meiner Schuhsohle. Schnee konnte das nicht sein, der war inzwischen fast weggeschmolzen. Ich hob den Reifrock an und musterte meinen feuchten Sneaker. Was war das für eine braune Masse? Als der Geruch von Alkohol und etwas Fruchtigem aufstieg, ging mir auf, dass die Franzi-Praline an meinem Schuh klebte. Nun, das war jetzt nicht mehr wichtig. Wichtig war nur, lebend hier rauszukommen.
Unser Kidnapper griff in seinen Rucksack. Um mich herum wurde heftig eingeatmet, und mein Chef stieß ein »Ogottogott« aus.
»Keine Angst«, sagte Hajek. Was er aus seinem Rucksack zog, waren nicht etwa Dynamitstangen oder Plastiksprengstoff, sondern ein Bündel Kabelbinder. »Frau Pelzer, fesseln Sie alle bis auf die Reporter.«
Der Kerl hatte seine Aktion bis ins Detail durchdacht. Was hatte er nur vor?
Wie befohlen, fesselte ich allen außer den Journalisten die Handgelenke aneinander. Als Letztes kam Dannecker an die Reihe. Von seinem blauen Wollanzug ging Schweißgeruch aus.
»Wissen Sie, was hier gespielt wird?«, fragte ich im Flüsterton.
Dannecker musterte mich durch die Gläser seiner Hipsterbrille. »Frau Pelzer, ich kann Ihnen nur versichern, dass ich …« Er brach ab, als über uns ein sirrendes Geräusch zu hören war.
Bevor ich zum Himmel aufsah, hielt ich den Strohhut fest. Ein graues Gebilde bewegte sich langsam über den Innenhof. Es sah aus wie ein fliegender Käfer mit vier Beinen, an denen sich kleine Propeller drehten.
»Eine Drohne«, rief Dannecker und zeigte auf das Objekt. »Sie filmt uns.«
Die Pressevertreter schwenkten ihre Objektive und Displays nach oben. Die Drohne sank tiefer und kreiste über uns, als würde sie von einem unsichtbaren Beobachter gesteuert.
»Die ist von der Kripo«, erklärte der Reporter mit dem Stabmikro. »Damit checken sie die Lage hier am Tatort.«
»Okay, dann kann es jetzt losgehen«, kam Hajeks Stimme von der Bühne. Er winkte André mit der Pistole zu sich.
Als mein Chef dieser Anweisung nicht folgte, lief unser Kidnapper zu ihm und zog ihm mit der Pistole eins über den Schädel. Dann zerrte er den jammernden André zum Bühnenrand.
»Sind wir live?«, erkundigte Hajek sich bei den Journalisten. Auf deren Nicken hin wandte er sich erneut an meinen Chef, der eingeschüchtert zurückwich. Alle konnten sehen, was für eine Memme der großspurige André in Wirklichkeit war. Trotz meiner gefährlichen Lage spürte ich Schadenfreude.
»André Hohlberg«, sagte Hajek laut. Seine Stimme wurde von den Steinwänden zurückgeworfen. »Geben Sie zu, dass Sie mein Rezept für die Franzi-Praline gestohlen und es als Ihres ausgegeben haben?«
Andrés Adamsapfel bewegte sich heftig auf und ab. »Herr Hajek, ich habe keine Ahnung, wovon Sie …«
Hajek zielte mit der Pistole nach oben. Ein ohrenbetäubender Knall ließ alle zusammenfahren. Erst als mir ein scharfer, chemischer Geruch in die Nase stieg, ging mir auf, dass unser Kidnapper gerade in die Luft geschossen hatte. Nun nahm Hajek meinen Chef ins Visier.
André zog den Kopf ein, was seine überdimensionierten Schulterpolster wie kleine schwarze Höcker wirken ließ. »Ja, das stimmt«, gestand er mit zittriger Stimme. »Das Rezept habe ich … äh, ich habe es von Ihnen geliehen.«
»Ohne mein Wissen«, ergänzte Hajek.
»Genau«, sagte André. »Das alles ist ein Missverständnis, das ich sofort aufklären …« Ein Wink mit der Pistole brachte ihn dazu, seinen Satz zu ändern. »Ich kann das aufklären, Herr Hajek. Ihr Rezept war so einzigartig, dass ich es … ich habe es … also ja, ich habe es gestohlen.«
»Und dann …«, soufflierte Hajek und lehnte sich an den Tisch mit den Pralinenetageren.
Im Innenhof herrschte gespannte Stille, und ich hörte das Blut in den Ohren rauschen.
»Dann habe ich dafür gesorgt, dass Sie entlassen werden. Fristlos«, vervollständigte André.
»Gut. Damit ist alles gesagt.« Hajek stand auf und wandte sich an die Journalisten. »Haben Sie alles mitbekommen? Und live gesendet?«
Die Pressevertreter nickten.
Hajek sah auf und suchte nach der Drohne. Sie kreiste nach wie vor über dem Innenhof. Dann schaute er in die Kamera des Regionalsenders. »Als Entschädigung fordere ich eine Million Franken auf ein Konto in der Schweiz und freies Geleit für mich und meine Geiseln.«
Geiseln? Hatte ich richtig gehört? Unwillkürlich machte ich mich klein und verfluchte meinen auffälligen Hut.
»Außerdem will ich ein Flugzeug, das für 8.000 Kilometer Reichweite aufgetankt ist und in Echterdingen bereitsteht. Dafür haben Sie eine Stunde Zeit. Sollte es länger dauern, erschieße ich eine Geisel.« Nach einer dramaturgischen Pause nannte er eine Handynummer.
Keine fünf Minuten später schrillte ein Klingelton durch den Hof. Automatisch sah ich zu dem Haufen Telefone, die ich eingesammelt hatte. Erst als Hajek in seine Hosentasche fasste, verstand ich.
»Das ging aber schnell«, sagte Jeannette neben mir.
Während Hajek mit jemandem verhandelte, wahrscheinlich der Kripo, rückte ich näher zu ihr. »Hast du gehört, was er gesagt hat?«
»Du meinst, dass er jemanden von uns erschießen wird?«
Ich nickte verängstigt und spürte zu meinem Entsetzen, dass meine Blase sich meldete. Sie folgte einem uralten Gesetz der Natur. Bei Gefahr galt es zu fliehen und dabei überflüssiges Gewicht zurückzulassen. Unauffällig sah ich mich um. Sollte ich hinter die Bühne klettern? Keine gute Idee, solange alle Kameras auf uns gerichtet waren.
Plötzlich wurde es dunkler im Hof.
»Der Projektor für die Sterne hat den Geist aufgegeben«, stellte ein Reporter fest.
Während alle nach oben zum Dach schauten, raffte ich meinen Rock und rannte hinter die Weihnachtstanne vor dem Landesmuseum. Schnell leerte ich meine Blase und schmolz damit den restlichen Schnee weg. Nachdem ich mein Kostüm geordnet hatte, trat ich hinter der Tanne hervor.
»Machen Sie das nicht noch mal, Frau Pelzer, sonst bringe ich Sie um.« Hajeks Stimme erschreckte mich beinahe zu Tode. »Fragen Sie mich beim nächsten Mal einfach, schließlich bin ich kein Unmensch.« Er zeigte mit der Pistole auf meinen Kopf. »Wollen Sie sich nicht umziehen? Ihr Hut sieht unbequem aus.«
»Nicht nötig. Außerdem sind meine Kleider im Auto, und das steht …« Vage deutete ich in Richtung Züblin-Parkhaus. Den Hut wollte ich keinesfalls absetzen, weil ich wusste, wie ich darunter aussah. Solange eine Kamera in der Nähe war, bestand die Gefahr, in diesem peinlichen Zustand im Fernsehen oder auf den Titelseiten zu landen.
»Verstehe«, brummte Hajek und sah auf seine Uhr. »In einer halben Stunde starten wir.«
Ich wagte nicht zu fragen, was er damit meinte.
Wir kehrten zurück auf die Bühne. Wenig später klingelte das Handy unseres Entführers, und er verhandelte erneut. Diesmal ging es um einen Hubschrauber.
Er beendete das Gespräch mit zufriedenem Gesichtsausdruck. »Alle mal herhören«, rief er. »Ihr könnt den Hof verlassen. Nur André Hohlberg und Bea Pelzer bleiben hier.«
»Meinen Sie mich?«, entfuhr es mir.
Hajek sah mich schweigend an, und sein Blick jagte mir Angst ein. Falls die Kripo seinen Forderungen nicht nachkam, wen würde er zuerst erschießen? Mich oder meinen Chef?
Als meine Schicksalsgenossen durch das Gittertor in die Freiheit traten, drehte sich Jeannette um und winkte mir zu.
Nun waren Hajek, André und ich allein im Innenhof. Schweigend saßen wir am Bühnenrand, bis ein knatterndes Geräusch uns aufschreckte. Ich hielt den Hut fest und sah auf. Das Knattern wurde lauter, und dann flog ein Hubschrauber über den Innenhof. Das Banner mit der Aufschrift »Weltpremiere« flatterte in der Luft, und die Zweige der Weihnachtsbäume wedelten wie bei Sturm. Der Hubschrauber flog zum Schlossplatz, dort schien er eine Weile in der Luft zu stehen.
Dann verstummte das Knattern.
Hajek machte eine auffordernde Bewegung mit der Pistole. »Los geht’s. Durch das Tor zum Neuen Schloss.«
Als ich mit gerafftem Rock die Eingangsstufen hinunterging, kam ich mir vor wie in einer Filmkulisse. Die Buden des Weihnachtsmarktes waren noch da, aber niemand aß eine Bratwurst oder shoppte Geschenke. Die Straßen waren abgesperrt, überall standen Einsatzwagen von Feuerwehr und Polizei. Eine Gasse führte durch Absperrungen hindurch zum Ehrenhof des Neuen Schlosses, und dort wartete der Hubschrauber. Von der menschenleeren Eisbahn drang »Atemlos durch die Nacht« herüber.
Hajek trieb uns vor sich her. Meine nassen Sneaker quietschten bei jedem Schritt. Vor Panik bekam ich kaum Luft, aber dies schien kein guter Zeitpunkt, um über meine Flugangst zu sprechen. Links funkelte der Lichterteppich an der Jubiläumssäule, dann fiel mein Blick auf den schwarzen Hubschrauber hinter den Granitsockeln, auf denen Hirsch und Löwe, die württembergischen Wappentiere, thronten.
»Steht das Flugzeug in Echterdingen bereit?«, fragte Hajek, als wir zur offenen Seitentür des Hubschraubers traten.
Der Pilot im Cockpit hob den Daumen und ließ die Rotoren an.
»Hohlberg, rein mit dir.« Unser Entführer schob meinen Chef ins Innere, folgte ihm und forderte mich auf, es ihm nachzutun.
Aber wie sollte ich das mit Reifrock und dem riesigen Hut hinbekommen? Ratlos erwiderte ich Hajeks Blick. Der schob die Pistole in den Hosenbund und streckte mir die Hand entgegen. Ich hielt meinen Kopfputz fest und wollte schon einsteigen, als ich eine riesige Perle an meinem Strohhut ertastete.
Ohne zu zögern, zog ich die altmodische Hutnadel heraus und rammte sie Hajek in die Hand. Er schrie auf, wich zurück und knallte mit dem Hinterkopf gegen eine Metallstange. Noch während er zu Boden sank, hörte ich laute Schreie hinter mir. Ein Polizist in Kampfmontur riss mich zur Seite, ein anderer sprang in den Hubschrauber und überwältigte unseren Entführer.
Wenig später kam Jeannette auf mich zugerannt und umarmte mich. »Bea, du Heldin! Wetten, André macht dich zur Mitarbeiterin des Monats, ach was, des Jahres?«
Ich stand noch unter Schock und begriff kaum, was sie sagte. »Wo ist dein Halstuch geblieben?«
»Ach ja, das hätte ich beinahe vergessen.« Jeannette griff in die Blazertasche, zog ein Tuch mit aufgedruckten goldenen Barockengeln heraus und faltete es auf. »Sieh mal, Herzogin Franziska. Ich hab ein paar deiner Pralinen für dich gerettet.«
2. Türchen: Cinghiale speciale
von Alessio Guerrini
Bei ihrem Anblick schüttelte Lorenzo wie schon so oft den Kopf. Donato Giuseppe Frisoni war ein italienischer Baumeister und Architekt. Ein Italiener. Also gewiss ein Katholik. Er hatte die barocke Predigtkirche an der Westseite des Ludwigsburger Marktplatzes geplant und Anfang des 18. Jahrhunderts ihre Errichtung beaufsichtigt. Die evangelische Stadtkirche. Che vergogna! Nun gut, gestand er sich im Stillen ein, eine Schande war es vielleicht nicht, es gab Schlimmeres als Protestanten, gerade in jüngster Zeit, in der die Ludwigsburger für die Vielfalt auf die Straße gingen, aber schade war es doch. Che peccato! Es tröstete ihn, dass Frisoni den gesamten Marktplatz gestaltet hatte, einschließlich der etwas kleineren katholischen Kirche zur Heiligsten Dreieinigkeit im Osten. Die malerischen Arkaden, die den Platz umgaben, verliehen dem ganzen Ensemble den Charme einer italienischen Piazza.
Lorenzo atmete tief durch. Hier fühlte er sich heimisch, deshalb hatte er an dieser Stelle sein »Refugio Toscana« eröffnet, nirgends anders wollte er ein Restaurant betreiben. Vor nicht allzu langer Zeit hatte er erweitert, mit dem Baurechtsamt und dem Denkmalschutz um jeden Quadratmeter Gastraum gekämpft, viel Geld investiert – und dann kam Corona. Die Gäste blieben weg. Natürlich. Was sollten sie auch anderes machen? Er stellte rasch auf Außer-Haus-Verkauf um, doch die Speisen, die er so anbieten konnte, waren für ihn kein richtiges Essen. Selbstverständlich waren Pizza und Pasta typisch italienisch, aber nicht die Art von Gastronomie, für die er stand. Der gehobenen Küche galt sein Streben, seit er damals aus der Toskana hierher zurückgekommen war. Es war eine harte Zeit gewesen. Er hatte sie überstanden, hatte sich freigeschwommen. Kaum war wieder so etwas wie Normalität eingetreten, wurde die Mehrwertsteuer erhöht. Erneut gingen die Gästezahlen zurück. Wenigstens hatte er keine Personalsorgen, die famiglia half, jeder kannte jemanden, der jemanden kannte. So hatte er genügend cameriere, die die Gäste bedienten. In die Küche ließ er niemanden, das machte er selbst, nur Chiara, seine Frau durfte ihm helfen. Und Gianna, seine Nichte. Sie war zwar naiv, aber fleißig und immer freundlich. Während andere Gastronomen hatten aufgeben müssen, konnte Lorenzo mit der Entwicklung seines Lokals sehr zufrieden sein.
In der Abenddämmerung, die die ganze Piazza in warmes rötliches Licht tauchte, ließ er noch einmal seinen Blick über den noch freien Marktplatz schweifen. Obwohl es schon Anfang November war, herrschten noch keine winterlichen Temperaturen, die Luft roch eher herbstlich. In einigen Tagen würden die Vorbereitungen für den barocken Weihnachtsmarkt beginnen. Unter den großen leuchtenden Engelfiguren würden sich dann zahlreiche Stände mit Kunsthandwerk, Schmuck, kuschlig-warmer Kleidung und Haushaltswaren drängen. Vor allem aber mit Glühwein und anderen Getränken sowie allem Möglichen an Nahrhaftem. Die Vorstellung von fettigen Reibekuchen war Lorenzo ein Graus – wenn die Leute es mochten, sollte es ihm aber egal sein. Sein Geschäft wurde dadurch in keiner Weise beeinträchtigt. Im Gegenteil: Die vier Wochen des Weihnachtsmarktes zählten zu seinen umsatzstärksten. Die betuchten Besucher der Veranstaltung aßen nur zu gern in seinem Feinschmeckerlokal. Er rieb sich die Hände. Sein Blick fiel auf die Kirchturmuhr. Bald würden die ersten Gäste kommen. Er musste in die Küche und einiges vorbereiten. Schließlich hatte er Besonderes auf die aktuelle Karte gesetzt.
Lorenzo öffnete die schwere Holztür mit den massiven Messinggriffen und trat ein. Sofort umfing ihn der Duft von frischem Brot – pane marocco, dieses Brot aus Mais- und Weichweizenmehl gab es nur bei ihm. Es verlieh seinem Restaurant schon beim Betreten eine besondere Note und ließ den Gästen bei dem Gedanken an alle anderen Spezialitäten der Toskana das Wasser im Mund zusammenlaufen. Kritisch ließ er den Blick über die Tische gleiten. Befriedigt nahm er die strahlend weißen Tischdecken und die gestärkten Servietten zur Kenntnis. Ein nicht zu übersehender Fingerabdruck auf einer der Wasserkaraffen trieb ihm jedoch die Zornesröte ins Gesicht. Seine Halsschlagader pulsierte deutlich sichtbar, als er nach dem Glasbehälter griff und Richtung Küche stürmte. Eine solche Nachlässigkeit konnte ihn seinen Stern in diesem französischen Restaurant-Führer kosten. Che disastro! Nur zu gut erinnerte er sich noch an diesen kleinkarierten Kritiker, der sein Lokal vor vielen Jahren heimgesucht hatte. An allem und jedem hatte er etwas auszusetzen gehabt. Die angeblich parfümierte Seife auf der Damentoilette hatte ihm den Rest gegeben. Was hatte dieser birbante, dieser hinterhältige Schurke, überhaupt auf der Damentoilette zu suchen gehabt? Hatte er keinen Respekt, no rispetto? Die Wut stieg immer noch in ihm hoch, wenn er daran dachte, aber dieses Problems hatte Lorenzo sich elegant entledigt. An einer Wiederholung war ihm nicht gelegen, denn er tat alles dafür, sich den zweiten Stern zu erarbeiten. Und doch war da ein Gast, der seit einigen Wochen unregelmäßig erschien und Lorenzo irgendwie nicht geheuer war.
Einige Tage später stand Lorenzo wie jeden Abend vor dem Spiegel. Er hatte ein frisches Oberteil angezogen, weil das andere beim Kochen vollgespritzt worden war. Mit ihm hätte er nicht vor die Gäste treten können. Es war ihm wichtig, jeden Abend, sobald die meisten Hauptgerichte von ihm zubereitet und von den Kellnern serviert worden waren, seine Runde zu drehen, wie er es nannte. Mit dieser Untertreibung pflegte er sein Hochamt zu bezeichnen: Er verließ die Küche und trat an jeden der Tische, an denen – wie er wusste – eine seiner Spezialitäten genossen worden war. So schritt er von Tisch zu Tisch, wechselte einige Worte mit den Gästen, fragte sie, ob sie zufrieden seien, und erwartete – natürlich –, für seine Kochkünste gelobt zu werden. Er wurde so gut wie nie enttäuscht. Im Stillen hatte er schon überlegt, ob er diesen Auftritt mit einer besonderen Musik unterlegen sollte, die sein Kommen ankündigte. Er hatte die Idee aber wieder verworfen, sie schien ihm etwas übertrieben zu sein.
Voller Vorfreude auf die erhofften Gespräche mit den Gästen warf er sich in Positur und öffnete die Tür zum Gastraum. In Erwartung des Lobes, das ihm wie üblich zuteilwerden würde, breitete sich ein Ausdruck der Zufriedenheit auf seinem Gesicht aus. Nicht nur war das Lokal gut besucht, auch die Spezialitätenkarte hatte reichlich Zuspruch gefunden. Mit dieser Gewissheit ließ er den Blick über die Tische schweifen. Che orrore! Der Schreck ließ fast seine Fassade bröckeln. Da saß er. In der Ecke wie die Spinne im Netz. Mit Blick sowohl auf die Küche als auch auf die Tür zu den Toiletten. Er war nicht zu übersehen, so groß war er. Wie alle hochgewachsenen Menschen zog er den Kopf ein, fast als glaube er, anderenfalls mit dem Wandlämpchen zu kollidieren. Und doch hatte er sich mit dem Rücken zu der holzvertäfelten Wand positioniert, damit nichts und niemand seinen Argusaugen entging. Mit der runden Nickelbrille auf der Hakennase unter den stets hochgezogenen Brauen erinnerte er an einen Raubvogel, der seine Beute auch aus größter Entfernung erspähte. Vielleicht hoffte er auch nur, unter der Lampe besser erkennen zu können, was er in dem kleinen, in braunes Leder gebundenen Notizbuch vermerkte. Auch jetzt lag der Füllfederhalter mit aufgeschraubter Kappe daneben, jederzeit griffbereit. Bei einem seiner früheren Besuche hatte Lorenzo einen Blick auf seine Aufzeichnungen zu erhaschen versucht. Die Schrift war zwar gestochen scharf, jedoch so klein, fast ohne Ober- und Unterlängen, dass er sie nicht lesen konnte. Außerdem hatte der andere, als er seine Neugier bemerkte, das Büchlein sofort zugeklappt und die Hand daraufgelegt. Jetzt saß er wieder da, ließ seinen Adlerblick durch das Restaurant gleiten, als suche er nach einem Opfer.
Lorenzo verschwand noch einmal in der Küche, lehnte sich an die kühle Wand und bemühte sich, tief durchzuatmen.
»Zio Lorenzo«, stieß Gianna hervor, die sich gerade mit einem Tablett voller Gläser mit Panna cotta al caffè an ihm vorbei in den Gastraum drängen wollte. »Was ist mir dir? Du siehst aus, als hättest du ein Gespenst gesehen.«
»Es ist nichts«, erwiderte er mit schwacher Stimme. »Mach weiter deine Arbeit, gib Luigi die Desserts, damit er servieren kann. Die Gäste warten darauf.«
Chiara blickte von den Töpfen auf und erfasste mit einem Blick die Situation: »Er ist wieder da.« Es war mehr eine Feststellung als eine Frage.
»Sì!«, hauchte er.
Nur kurz trat sie an ihn heran, sah ihm fest in die Augen. »Du schaffst das! Wir lassen uns nicht unterkriegen!« Sie hatte leise gesprochen, wie stets, wenn sie erkannte, dass er um Fassung rang. Dann wandte sie sich wieder um und widmete sich den Töpfen und Pfannen auf dem Herd.
Lorenzo holte noch einmal tief Luft, straffte die Schultern und betrat erneut den Gastraum. Zuerst beehrte er andere Kunden mit seiner Anwesenheit, damit dieser spezielle Gast nicht den Eindruck gewann, er genieße besondere Aufmerksamkeit. Lorenzo nahm dankbar die anerkennenden Worte entgegen, ließ einige Bemerkungen über die toskanische Küche fallen und darüber, wie schwer es mitunter war, von dort genau das zu bekommen, was er benötigte. Safran aus San Gimignano etwa, der aus der Toskana eigentlich nur innerhalb Italiens in andere Provinzen exportiert wurde; nur er ließ ihn sich nach Ludwigsburg liefern.
Als er nach Smalltalk an sieben Tischen überzeugt war, dieser eine Gast werde seine Bedeutung nicht überschätzen, trat er an ihn heran. Der Name war ihm entfallen, vielleicht hatte er ihn bewusst verdrängt, obwohl es zum guten Ton der Kundenbindung zählte, deren Namen zu kennen, als gäbe es eine persönliche Beziehung zu ihnen. Bei Stammgästen wusste er auch um einige Details aus deren Privatleben, bei diesem war er blank. Nichts, gar nichts hatte er sich von den wenigen Gesprächen gemerkt. Wahrscheinlich hatte ohnehin keine der Angaben gestimmt, die ihm dieser Mensch mitgeteilt hatte. Zum Glück fiel Lorenzo noch ein, dass der andere einmal gesagt hatte, er habe in irgendeinem Fach promoviert. Was es auch gewesen sein mochte, es ließ ihn offenbar gut verdienen – der maßgeschneiderte Dreiteiler, das edle Hemd und die erlesene Krawatte ließen auf ein gutes, ein sehr gutes Einkommen schließen. Wenigstens konnte er sich mit seinem spärlichen Wissen über die Eröffnung des Gesprächs retten: »Buona sera, dottore«, begann mit dem schönsten falschen Lächeln, zu dem er fähig war. »Ich freue mich, Sie heute wieder einmal zu meinen Gästen zählen zu können. Ich hoffe, es war alles zu Ihrer Zufriedenheit.«
Als müsste er sich erst vergewissern, was er sagen könnte, schaute sein Gegenüber schnell in das Notizbuch. Gedehnt erwiderte er: »Es war recht ordentlich, Lorenzo!«
Lorenzo schluckte so heftig, dass man seinen Adamsapfel wandern sah. Er hatte gelernt, dass Schwaben glaubten, nicht zu schimpfen, sei genug gelobt. Aber der andere war kein Schwabe. Er konnte ihn zwar landsmannschaftlich nicht zuordnen, aber er sprach akzentfreies Hochdeutsch »nach der Schrift«, wie ein Schwabe es formuliert hätte. Was also hatte der Typ auszusetzen? Lorenzo öffnete den Mund, um ihn zu fragen, schloss ihn aber gleich wieder.
»Mal ganz ehrlich: Das waren doch keine Trüffel von den Hügeln von San Miniato, die mir da über die Pasta gehobelt wurden, oder?«
So ein Klugscheißer; was wusste der schon? Als könnte der den Unterschied herausschmecken. Lorenzo kochte innerlich, bemühte sich aber, äußerlich ruhig zu bleiben. »Nein, es waren Trüffel der Valtiberina. Meine Vorräte aus der Toskana sind leider aufgebraucht, ich bin untröstlich. Deshalb muss ich mich mit der Ware aus dem Tibertal behelfen.« Er bereute das Gesagte, noch während er den Satz beendete, denn schon trug der andere mit akkurater Schrift eine Bemerkung in sein Büchlein ein.
»Aber der Vin Santo del Chianti Riserva war recht trinkbar«, warf der dottore gönnerhaft ein. »Er war nur nicht richtig temperiert.«
Lorenzo hätte ihm an die Gurgel springen können. Mühsam beherrschte er sich. Zwischen den Zähnen presste er hervor: »Mi scusi! Ich hätte unser Gespräch gern noch fortgesetzt, aber ich muss nun in die Küche zurück. Bitte entschuldigen Sie mich, dottore!«
»Selbstverständlich, nur noch ein, zwei Fragen, Lorenzo: Ihr Lokal ist für seine Wildschweinspezialitäten bekannt, ich finde sie aber nicht auf der Karte …«
Schon im Gehen begriffen, drehte sich Lorenzo noch einmal um. »Oh, es hat sich also herumgesprochen. Cinghiale speciale. Sie haben recht, das ist etwas ganz Besonderes.« Normalerweise hätte er diese Schilderung durch raumgreifende Gestik unterstrichen, nicht aber bei diesem Gast; bei ihm sparte er an jeder Handbewegung. »Eine Wildschweinrasse, die nur in der Toskana beheimatet ist. Ihr Fleisch ist so zart, so aromatisch … aber es handelt sich um eine seltene Spezies, von der jedes Jahr nur wenige Exemplare gejagt werden dürfen. Vi prego di comprendere. Bitte verstehen Sie, derzeit habe ich sie nicht; ich warte noch auf die nächste Lieferung.«
»Nun gut, noch eine zweite Frage: Darf ich einmal Ihre Küche besichtigen? Ich möchte mir einen Eindruck von dem Heiligtum verschaffen, in dem Sie diese Köstlichkeiten zubereiten.«
So viel Falschheit und Verlogenheit ließen Lorenzos Halsschlagadern wieder heftig pulsieren. Er kämpfte seine Wut nieder und antwortete mit einem verkrampften Lächeln: »Das ist eine Auszeichnung, die ich nur ausgesuchten Gästen zuteilwerden lasse. Vielleicht ein anderes Mal …«
Mit dieser Andeutung ließ er den anderen sitzen und beeilte sich, in sein Refugium zurückzueilen. In der Küche griff er nach einem der Beile und bearbeitete einen Schweinerücken so heftig, dass er riskierte, die Ergebnisse dieser Arbeit nicht zubereiten und servieren zu können.
Nach diesem für ihn schrecklichen Abend hatte Lorenzo eine unruhige Nacht. Er wälzte sich im Bett hin und her, wachte immer wieder schweißgebadet auf.
Als kleiner Junge war er mit seinen Eltern nach Deutschland gekommen. Seinen Vater hatten sie als Gastarbeiter geholt, wie man das damals nannte. Er schaffte beim Daimler am Band. Nach wenigen Jahren holte er seine mammaund ihn nach. Der Bruder seines Vaters war in die USA ausgewandert. Amerika! Allein dieses Wort verhieß alles, was er als sich Jugendlicher erträumte. Erst recht, wenn er die Briefe seines Onkels las. Mit den Jahren wurden es immer weniger, schließlich verebbten die Nachrichten gänzlich. Kaum war er 16, fing auch er bei dem Autohersteller an, aber die Arbeit seines Vaters war nichts für ihn. Er schöpfte Hoffnung, als er in der Kantine den Aushang sah, dass eine Küchenhilfe gesucht werde. Drei harte Jahre schuftete er in der Großküche. Dann wurde er in Italien zum Militärdienst einberufen. Wieder hatte er Glück, überstand die Menschenschinder in der Grundausbildung und wurde in die Küche versetzt. Sein Chef merkte, dass ihm das Kochen lag, und vermittelte ihn nach dem Wehrdienst zu Marcello, der fast versteckt in der alten Stadtmauer von San Gimignano ein kleines, aber feines Restaurant betrieb. Hier lernte er alles, was er brauchte. Einige Jahre später wollte er zu seinen Eltern zurückkehren. Beide waren alt geworden, und die Rente seines Vaters reichte gerade so zum Leben. Der Kontakt zu Vaters Bruder in den USA war abgebrochen. Er erfuhr noch, dass der Onkel zu Reichtum gekommen war, erwartete aber keine Hilfe von dort. So hatte Lorenzo sich mit geliehenem Geld und vielen Rückschlägen sein Restaurant aufgebaut: das »Refugio Toscana«.
Für seinen Traum hatte er von früh bis spät geschuftet, über die Jahre seine Schulden zurückgezahlt und glaubte nun, es endlich geschafft zu haben. Nicht, dass er sich als wohlhabend bezeichnet hätte, aber es ging ihm und seiner Familie gut. Und jetzt kam so ein dahergelaufener Restaurantkritiker und hatte offenbar vor, seinen guten Ruf zu ruinieren und sein Lokal schlechtzumachen. Allein bei dem Gedanken daran, wie er an einem der Tische saß, alles beobachtend, mit spitzer Feder in dem kleinen Büchlein notierend und anschließend herablassend kommentierend, wurde Lorenzo so wütend, dass er laut aufschrie und sich im Bett aufsetzte. Chiara schreckte aus dem Schlaf hoch und brauchte eine Weile, bis sie sich zurechtfand. Dann erfasste sie die Situation, legte ihm beruhigend die Hand auf den Arm und redete leise auf ihn ein. Sie verstand ihn.
Inzwischen wurde der barocke Weihnachtsmarkt zwischen der evangelischen Stadtkirche und der katholischen Kirche Zur Heiligsten Dreieinigkeit aufgebaut. Hübsch dekorierte Stände reihten sich aneinander. Die großen Engelfiguren überragten alles. Mit einbrechender Dämmerung wurden sie beleuchtet und tauchten den gesamten Marktplatz in warmes Licht. Weihnachtliche Musik drang aus manchen Lautsprechern, nicht aufdringlich, sondern dezent und stimmungsvoll. So liebte Lorenzo die Vorweihnachtszeit. Vier Wochen dauerte der Weihnachtsmarkt. Gut gelaunte Menschen schlenderten dann immer durch die Gänge zwischen den Ständen. Viele besuchten anschließend sein Lokal. In diesem Jahr mischte sich allerdings Unsicherheit in Lorenzos Vorfreude. Wegen der vielen Buden konnte er, wenn er vor dem »Refugio Toscana« stand, nicht schon auf die Entfernung sehen, wer sich dem Restaurant näherte. Er tröstete sich damit, dass er so zwar später sah, wer zu ihm kam, aber auch kaum anders würde reagieren können als bei größerer Vorwarnzeit. Trotzdem nahm seine innere Anspannung stetig zu. Er fasste einen Plan, den er so geheim hielt, dass er ihn nicht einmal Chiara anvertraute. Stattdessen ging er häufig in die Kirche und hielt Zwiesprache mit dem Herrn. Er würde Verständnis für ihn haben, so hoffte er.
Am Vorabend des dritten Advents kam er wieder. Wie jeden Abend, bevor er in die Küche ging, stand Lorenzo am Eingang des Lokals und hielt Ausschau. Jetzt sah er den anderen, wie er sich zwischen einem Stand mit Holzschnitzereien aus dem Erzgebirge, einer dieser Langosch-Buden und einem Glühwein-Ausschank durch die Massen drängte. Die schwarzen Schuhe so blank poliert, dass man sich darin spiegeln konnte. Der lange, schwere Stoffmantel ließ an der Knopfleiste erkennen, dass es ihm schwerfiel, die Leibesfülle zu umschließen. Schal und Handschuhe waren selbstverständlich. Auffallend war der Hut, denn wer trug heute noch einen Homburger?
Auf diesen Augenblick hatte sich Lorenzo gedanklich vorbereitet, und doch traf er ihn so überraschend, dass er kurze Zeit brauchte, bis er reagieren konnte. Dann ging er dem Mann entgegen: »Buona sera, dottore! Ich habe schon gesehen, dass Sie für heute Abend Ihren üblichen Platz reserviert haben.«
»Guten Abend, Lorenzo! Ich freue mich, dass alles geklappt hat.«
Lorenzo geleitete ihn hinein, bis zu seinem Tisch, und nahm ihm Hut, Handschuhe und Mantel mit dem Versprechen ab, alles sicher aufzubewahren. »Ich bin gleich wieder bei Ihnen, dottore!«
Nachdem er die Garderobe versorgt hatte, kam er mit einem aperitivo zurück. Zwei Gläser. Eins für Lorenzo und eins für den Gast. »Heute Abend habe ich eine Überraschung für Sie, dottore! Doch zunächst«, er hob das Glas, »cin cin!«
Der andere war erstaunt, erwiderte aber »Zum Wohl!« und leerte das Glas in einem Zug. »Und welche Überraschung haben Sie für mich vorbereitet, Lorenzo?«
Der Angesprochene tat geheimnisvoll, legte einen Finger an den Mund. »Pssst! Folgen Sie mir!« Die beiden leeren Gläser ließ er in den weiten Taschen seiner Montur verschwinden. »Heute zeige ich Ihnen mein Reich, meine Küche!« Im Gehen legte er dem dottore die Hand auf die Schulter, um ihn zu lenken. Gemeinsam verschwanden sie hinter der Tür zum Allerheiligsten, ohne dass die anderen Gästen Notiz davon nahmen.
Nach über einer Stunde verließ Lorenzo die Küche wieder. Allein. Er hatte sich umgezogen; Chiara hatte ihm geholfen, die Küche von den Spuren der Umsetzung eines Plans zu reinigen. Nun sah er sich in seinem Restaurant um, Befriedigung und Erleichterung zeichneten sein Gesicht. Langsam näherte er sich den Tischen der Stammgäste. Sie zu begrüßen, war ihm immer eine Freude, heute jedoch ergänzte er den üblichen Smalltalk, indem er ihnen mit verschwörerischem Unterton zuflüsterte: »Übermorgen wird es nach langer Zeit wieder einmal cinghiale speciale geben. Ich habe soeben eine ›Lieferung‹ erhalten.« Seine Gestik versprach ein wahres Festmahl, das ihnen auf der Zunge zergehen würde.





























