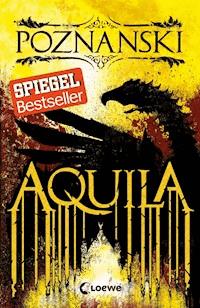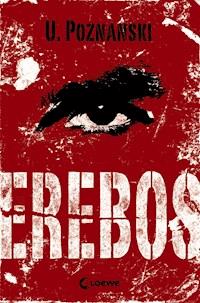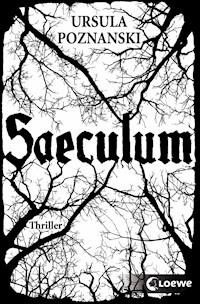9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Loewe
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Layers – die Wahrheit ist vielschichtig. Seit Dorian von zu Hause abgehauen ist, schlägt er sich auf der Straße durch – und das eigentlich ganz gut. Als er jedoch eines Morgens neben einem toten Obdachlosen aufwacht, gerät Dorian in Panik, weil er sich an nichts erinnert: Hat er selbst etwas mit dem Tod des Mannes zu tun? In dieser Situation bietet ihm ein Fremder unverhofft Hilfe an. Als Gegenleistung soll er nur ein paar geheimnisvolle Werbegeschenke verteilen. Aber als Dorian eines der Päckchen für sich behält, wird er von diesem Zeitpunkt an gnadenlos gejagt. Ein Hochspannender Tech-Thriller von Bestseller-Autorin Ursula Poznanski.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 539
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Kapitel 1
Er befand sich noch im Halbschlaf, trotzdem spürte er genau, dass der Hauch, der sein Gesicht streifte, kein Wind war. Zu warm, zu übel riechend.
Atem.
Dorian vertrieb die letzten Traumbilder, drehte sich zur Seite und öffnete die Augen. Noch bevor er erkennen konnte, wer sich da über ihn beugte, fühlte er, wie sich eine Hand in seinem Haar verkrallte.
»Rucksack her.«
Es war Emil, verdammt. Der sein Reich doch eigentlich neben den alten Telefonzellen hatte, am wärmsten Platz der ganzen U-Bahn-Unterführung. Dorian hatte diese Ecke extra gemieden und sich in die Nische zwischen Bäckerei und Rolltreppe gelegt, aber leider hatte Emil ihn trotzdem gefunden.
»In meinem Rucksack ist fast nichts drin. Nur eine Flasche Wasser und ein Pulli. Ganz sicher kein Geld.«
Emil zog den Beutel so schnell unter Dorians Kopf weg, dass dessen Kopf beinahe auf den harten Asphalt knallte. »Das sehe ich mir selbst an.« Er zerrte den Pulli heraus und warf ihn in einer achtlosen Bewegung zur Seite. Das war zu erwarten gewesen, in den würde sein Bierbauch nie im Leben hineinpassen. Kurz danach rollte die halb volle Plastikflasche über den Boden und Emil drehte den Rucksack um. Ein paar Centmünzen fielen heraus, eine Mütze und Dorians Taschenmesser.
»Na also!« Grinsend steckte Emil das Messer ein und packte Dorian mit der anderen Hand am Kragen. »Hosentaschen ausleeren.«
»Ich denke überhaupt nicht dran.« Dorian war nun endgültig wach und nicht bereit, den Verlust seines Taschenmessers hinzunehmen. Es war das einzige Werkzeug, das er besaß, und hatte einen Dosenöffner, auf den er angewiesen war. »Gib mir mein Messer zurück und ich bringe dir heute Abend etwas zu trinken mit.« Damit musste er bei Emil eigentlich offene Türen einlaufen. Den Rotwein, den der gestern in sich hineingeschüttet haben musste, konnte man immer noch riechen, bei jedem Wort, das er sprach. Rotwein, Zwiebeln und ungeputzte Zähne.
Doch Emil lachte und schüttelte den Kopf, dass seine fettigen, kinnlangen Haare flogen. »Das kannst du vergessen.« Er zog Dorian hoch, seine Hand wühlte sich in dessen linke hintere Jeanstasche und förderte einen zerknitterten Fünfeuroschein zutage.
»Aha. Kein Geld, wie?« Er versetzte Dorian einen Stoß gegen die Brust, der ihn bis zur nächsten Wand taumeln ließ.
Doch nun war er wach und die Wut über diesen fetten, stinkenden Drecksack, der ihn im Schlaf überrumpelt hatte, kochte heiß in ihm hoch. Er brauchte seine ganze Beherrschung, um sich nichts anmerken zu lassen. Ohne Emil anzusehen, packte er seine Decke und die Wasserflasche wieder in den Rucksack und hängte ihn sich über die Schultern. Dann erst baute er sich vor seinem Gegner auf. Zwei von Emils Freunden hatten sich mittlerweile zu ihnen gesellt und beobachteten das Schauspiel grinsend. Egal, dachte Dorian.
»Ich will mein Messer zurück. Und mein Geld.«
Im ersten Moment sah Emil verdutzt drein, dann schlug er sich lachend auf die Schenkel. »Hau lieber ganz schnell ab, du kleiner Scheißer, bevor ich dir deinen restlichen Kram auch noch wegnehme und dich in der Unterhose –«
Weiter kam er nicht. Dorian hatte sich mit einem Sprung auf ihn gestürzt, ihn aus dem Gleichgewicht und zu Fall gebracht. Er setzte ihm ein Knie auf die Brust und verlagerte sein ganzes Gewicht darauf.
Das tat weh, wie er aus eigener Erfahrung wusste.
»Bist du …« Emil schnappte nach Luft, bekam kein weiteres Wort heraus. Er wehrte sich nicht, als Dorian sich sein Messer und den Fünfer zurückholte. Da war noch mehr Geld in Emils Taschen, doch das rührte Dorian nicht an. Bislang war er ohne Stehlen durchgekommen. Er hatte nicht vor, heute damit anzufangen.
Im Hintergrund Lachen. Emils Freunde dachten offenbar nicht daran, ihrem Kumpel zu Hilfe zu eilen.
»Das wirst du bereuen«, ächzte Emil, kaum dass er wieder Luft bekam. »Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr du das bereuen wirst.«
Allein die Tatsache, dass er Emil angefasst hatte, ekelte Dorian plötzlich so furchtbar an, dass er sich hätte schütteln können. Er erwiderte nichts, sondern lief auf den Ausgang der U-Bahn-Station zu, begierig darauf, das fahle Licht der Neonröhren gegen das erste Grau des beginnenden Morgens zu tauschen.
Der dritte Supermarkt heute. Dorian umrundete ihn ohne Eile, die Hände tief in den Hosentaschen vergraben. Ein scharfer Wind fegte um die Ecke. Keine Frage, es wurde jetzt jeden Tag kälter, er musste unbedingt eine vernünftige Jacke auftreiben.
Da waren die Müllcontainer. Bevor er den ersten öffnete, warf er einen Blick über die Schulter. Keine Zuseher.
Leider auch kein Jagdglück. Der Geruch, der ihm aus der Tonne entgegenschlug, war widerlich. Er ließ den Deckel zufallen und wandte sich dem nächsten Container zu.
Obst. Überreife Bananen und Äpfel mit Druckstellen. Er griff nach den Stücken, die am besten aussahen, und verstaute sie in seinem Rucksack. Der, bei näherer Betrachtung, dringend wieder einmal gewaschen werden musste. Sich äußerlich sauber zu halten, hatte Dorian sich zur obersten Regel gemacht – wenn man schon auf der Straße lebte, sollte einem das niemand ansehen, fand er. Solange man ihn für einen normalen Teenager hielt, würde man ihm keine Schwierigkeiten machen.
Und man würde ihn nirgends rauswerfen.
Er schlenderte auf die gläsernen Schiebetüren des Supermarkts zu, direkt hinter einer Frau und ihrem quengelnden Kind, das vergeblich versuchte, sich von ihrer Hand loszureißen. Sein Ziel war die Feinkosttheke. Genauer gesagt, die Teller mit den Gratiskostproben.
Eine neue Art von Salami, in Röllchen, mit einem Zahnstocher aufgespießt, ebenso wie die Goudawürfel ein paar Schritte weiter. Dorian nahm nie mehr als zwei oder drei Stück, nicht auffallen war oberstes Gebot. Schon gar nicht unangenehm.
Trotzdem sprach ihn eine der Verkäuferinnen hinter der Theke an. »Schmeckt gut, nicht wahr? Darf ich dir etwas davon mitgeben?«
Er schüttelte den Kopf. »Nein danke. Aber ich werde meiner Mutter einen Tipp geben.« Gewinnendes Lächeln aufsetzen. Meiner toten Mutter.
Die Verkäuferin lächelte zurück und schnitt eine Scheibe Schinken von dem Stück ab, das gerade in der Wurstschneidemaschine lag, und reichte es ihm über die Theke.
»Probier den mal, da ist Rosmarin drin. Vielleicht auch etwas für deine Mutter.«
Dorian kostete, hob anerkennend die Augenbrauen und verabschiedete sich dann.
Die nächsten paar Wochen würde er diesen Supermarkt hier besser meiden – er legte keinen Wert darauf, irgendwo wiedererkannt zu werden. Er wollte nicht, dass man ihm Fragen stellte. Oder dass jemand begann, sich über diesen Teenager zu wundern, der immer nur durchs Geschäft streunte, ohne je etwas zu kaufen.
Für heute war er ohnehin versorgt. Obst, drei Stück altes Gebäck, eine verbeulte Dose Fertiggulasch. Das er kalt würde essen müssen, aber egal.
Es war erst kurz nach zehn Uhr. Dorian machte sich auf den Weg zum Stadtpark, dafür würde er etwa eine halbe Stunde brauchen. Eine halbe Stunde, in der er etwas zu tun hatte, immerhin. Er würde sich an seinen Lieblingsplatz am Ententeich setzen, und dann …
Dann würde der Tag lang werden. Wie jeder Tag, den er auf der Straße verbrachte. Ohne Ziel, ohne vertraute Menschen. Alle Welt beschwerte sich darüber, zu wenig Zeit zu haben, doch es war viel schlimmer, im Zeitüberschuss fast zu ertrinken. Das wusste Dorian jetzt. Zeit, mit der man nichts anfangen konnte, fühlte sich endlos an.
Leichter wäre es gewesen, wenn er ein Ziel gehabt hätte, auf das er hätte hinarbeiten können. Aber das Einzige, was er wirklich wollte, war, seinem Vater nie wieder zu begegnen. Wenn ihm das gelang, war das schon etwas. Alles andere schien ihm derzeit unerreichbar zu sein. Ein Schulabschluss, ein Dach über dem Kopf – dafür hätte er nach Hause zurückkehren müssen. Und bevor er das tat, würde er sich eher im Ententeich ersäufen.
Die Parkbank neben der alten Kastanie war frei und warm von der Sonne. Dorian setzte sich und schloss die Augen.
Der Gedanke, die nächste Nacht wieder in Emils Nähe verbringen zu müssen, war alles andere als verlockend. Allerdings boten die Ecken in den anderen U-Bahn-Stationen viel weniger Schutz. Und die Gesellschaft war noch übler: Junkies, Schläger, Jugendbanden. Dagegen war Emil ein angenehmer Zeitgenosse, er war nicht der Typ, der jemandem ein Butterfly-Messer in den Bauch rammte.
Oder war es wieder einmal Zeit für eine Übernachtung in der Notschlafstelle? Der Gedanke war verlockend: endlich duschen, statt sich nur notdürftig an den Waschbecken der öffentlichen Toiletten zu säubern. Aber mehr als fünf Mal pro Monat durfte man sich dort nicht einquartieren und Dorian fand es deutlich klüger, sich diese Gelegenheiten für Nächte voller Regen und Wind aufzusparen.
Vielleicht war es ja auch Zeit, die Stadt zu wechseln. Für eine Fahrkarte reichte sein Geld zwar nicht und betteln würde er nur im äußersten Notfall – aber per Autostopp?
Er rieb sich mit beiden Händen übers Gesicht, bis die Haut sich heiß anfühlte. Nein. Was er brauchte, war keine neue Stadt, sondern ein neues Ziel. Eine Perspektive. Er war gerade mal siebzehn und auf dem besten Weg, eine Karriere als Obdachloser einzuschlagen. Dabei hatte er vorgehabt, Anwalt zu werden. Seine Noten waren gut gewesen, verdammt noch mal, und unter normalen Umständen hätte er das Gymnasium niemals abgebrochen.
Ob es die Möglichkeit gab, eine Schule zu besuchen, ohne einen festen Wohnsitz zu haben?
Vielleicht. Aber nicht ohne Geld, und sei es nur für Bücher, Hefte, Schreibzeug. Er würde sich nach Hilfe umsehen müssen. Vom Staat oder wohltätigen Organisationen. Egal von wem, Hauptsache, es war nicht sein Vater.
Der musste kurz nach Dorians Verschwinden immerhin eine Vermisstenanzeige aufgegeben haben, denn ein Sozialarbeiter der Notschlafstelle hatte Dorian erkannt und ihm angeboten, ihn nach Hause zu bringen. Nachdem Dorian mehrfach abgelehnt hatte, war er in Ruhe gelassen worden.
Gut fünf Stunden blieb Dorian im Park. Fischte Zeitungen und Zeitschriften aus den Papierkörben und las sie von der ersten bis zur letzten Seite. Wünschte sich brennend, wieder einmal ein Buch lesen zu können, irgendeines. Aber Bücher warf niemand weg.
Erst als eine dicke Schicht hellgrauer Wolken die Sonne verdeckte und kühler Wind das Wasser des Ententeichs kräuselte, machte Dorian sich wieder auf den Weg. Falls es doch noch regnen sollte, würde er die Nacht in der Notschlafstelle verbringen, beschloss er.
Bis dahin klapperte er die Altkleidercontainer in der Umgebung ab. Die Einwurfklappen machten es unmöglich, an den Inhalt heranzukommen, aber wenn die Container überfüllt waren, stellten die meisten Leute ihr Zeug lieber daneben, als es wieder mit nach Hause zu nehmen. Und je früher Dorian an eine Winterjacke kam, desto besser.
Doch seine Suche blieb erfolglos. Nur neben einem der Sammelbehälter standen zwei zugeschnürte Müllsäcke, beide voll mit Babystramplern und rosa Kleidchen in Kindergartengrößen. Nichts, was irgendwie brauchbar gewesen wäre.
Er streunte durch die Fußgängerzone, als der Abend hereinbrach, wartete auf den Moment, wenn die Straßenbeleuchtung aufflackerte. Bald würde das Wetter herbstlicher werden, windiger, kälter. Was er tun sollte, sobald der erste Schnee fiel, konnte Dorian sich überhaupt noch nicht vorstellen. Er betrachtete seine Turnschuhe. Es war Zeit, eine Lösung zu finden.
Das Wetter blieb trocken und innerlich seufzend hakte Dorian die wohlige Vorstellung von einer Übernachtung in der Notschlafstelle ab. Vielleicht morgen. Für heute würde er sich noch einmal an die gleiche U-Bahn-Station wie letzte Nacht halten, sich aber eine andere Stelle suchen. Ein paarmal hatte er nahe des Ausgangs geschlafen, der in den Park führte – dort war es zwar zugig, aber dafür hielten sich Kerle wie Emil meist fern.
Dorian wartete, bis es fast dreiundzwanzig Uhr war – zu dem Zeitpunkt waren die Menschenströme in den Unterführungen großteils verebbt, zumindest an einem normalen Wochentag wie heute.
Nicht mehr lange, sagte er sich, während er den Boden auf Kaugummireste und Schlimmeres inspizierte. Diese Nische hier konnte man kaum als solche bezeichnen, aber er würde beim Schlafen eine Wand im Rücken und vor sich zwei Säulen als dürftigen Sichtschutz haben.
Und den Nachtwind als Gefährten. Schon jetzt fegte er trockene Blätter aus dem Park in die Unterführung. Dorian zog den zusätzlichen Pullover an und wickelte sich in seine Decke. Das Taschenmesser behielt er diesmal in der Hand, sicher war sicher.
Mit der Wasserflasche als einzigem Inhalt gab der Rucksack ein dürftiges Kopfkissen ab, aber egal. Ein paar Stunden würde Dorian schlafen können, todmüde wie er war.
Er schloss die Augen, konzentrierte sich auf die Geräusche, die die unterirdischen Gänge erfüllten. Klappernde Schritte. Schlurfende Schritte. Gelächter, bei dem weibliche und männliche Stimmen sich vermischten. Das Summen der Belüftungsanlage … und immer wieder der Wind.
Dorian hatte nicht gemerkt, dass er eingeschlafen war, doch er spürte genau, wie etwas ihn weckte. Einerseits waren es Kopfschmerzen, die sich von einer Schläfe zur anderen zogen. Andererseits war es eine Berührung an seinem Kinn.
Nein, keine Berührung. Der Boden wurde nass. Hatte es doch noch zu regnen begonnen?
Verschlafen tastete er mit der Hand nach seinem Gesicht, wollte das Wasser abwischen. Nur, dass es kein Wasser war.
Zu warm.
Zu klebrig.
Und der Geruch …
Seine Augen öffneten sich langsam, als täten sie es gegen seinen Willen. Sahen etwas Rotes im fahlen Schein der Leuchtröhren auf sich zufließen.
Dorians Körper reagierte, noch bevor er selbst wirklich begriffen hatte, dass es Blut war, das da auf ihn zulief. Er zuckte zurück, was die Kopfschmerzen verdoppelte; richtete sich mit hämmerndem Herzen auf.
Blut. Und dahinter ein Schatten, ein Körper, der verkrümmt auf dem Boden lag, kaum zwei Schritte von Dorian entfernt.
Emil? War das Emil?
Auf jeden Fall war es seine hässlich gemusterte Strickjacke und es war sein halblanges braungraues Haar, mit dem der Wind spielte.
Hektisch, fast panisch, wischte Dorian sich mit dem Ärmel übers Gesicht, dort, wo es … nass geworden war. Alles in ihm schrie danach, abzuhauen, wegzulaufen, schnell, doch kaum stand er auf, wurde ihm so schwindelig, dass er sich mit einer Hand an der nächsten Säule festhalten musste. Trotzdem, wer auch immer Emil das angetan hatte, war vielleicht noch in der Nähe. Vielleicht gleich um die Ecke, bei der Rolltreppe.
Der Boden schwankte, durch das Rauschen in Dorians Ohren drang so etwas wie eine Stimme, doch er nahm sie kaum wahr, denn er hatte etwas entdeckt, das seine ganze Aufmerksamkeit beanspruchte. Es lag da mitten in all dem flüssigen Rot und es sah schauderhaft vertraut aus.
Sein Taschenmesser, mit aufgeklappter Klinge.
Aber … das ergab überhaupt keinen Sinn! Dorian atmete gegen die immer heftiger werdende Übelkeit an. Er schaffte es nicht, sich zusammenzureimen, was passiert sein könnte. Er hatte geschlafen, ruhig und fest.
Ja, mit dem Messer in der Hand.
Langsam und ohne es wirklich zu wollen, ging er auf Emil zu, der bäuchlings vor ihm lag. Vielleicht atmete er ja noch. Dann würde Dorian Hilfe holen, so schnell er konnte.
Sobald er konnte.
Sein Kopf pulsierte schmerzhaft im Rhythmus seines rasenden Herzschlags.
Das viele Blut schien aus einer Wunde am Hals zu stammen, aber um sicher sein zu können, hätte Dorian Emil umdrehen müssen. Allein bei der Vorstellung schnürte sich ihm die Kehle zu.
Nein, er würde zur nächsten Polizeistation gehen, oder notfalls kriechen. Allerdings … sollte er vorher sein Taschenmesser aus der Blutlache holen. Und wegwerfen, irgendwo.
Nur dass er sich wie versteinert fühlte. Es nicht schaffte, sich zu bewegen, obwohl er es versuchte – wie in einem dieser Träume, in denen einem der Körper plötzlich nicht mehr gehorcht.
Und dann fiel ein langer dunkler Schatten über Emil und die Blutlache.
Endlich reagierte Dorians Körper, er schaffte es, den Kopf zu drehen, erwartete entweder den Täter oder jemanden von der Polizei. Es wäre besser, viel besser gewesen, dachte er, sie selbst zu alarmieren, als auf diese Weise ertappt zu werden …
Doch hinter ihm stand kein Polizist, sondern ein junger Mann mit dunklem Haar, der die Hände vor den Mund gelegt hatte und Emil mit großen Augen anstarrte.
Letzte Chance, dachte Dorian. Wegrennen, schnell, und hoffen, dass der Kerl dein Gesicht nicht gesehen hat. Doch wieder spielte sein Körper nicht mit. Nach zwei Schritten musste Dorian sich mit den Händen auf seinen Knien abstützen, um nicht umzukippen.
»Es war Notwehr.« Die Stimme des Mannes zitterte, aber nicht allzu sehr. »Ich habe vorhin mitbekommen, wie er dich angegriffen hat, und bin gelaufen, um Hilfe zu holen, aber da war niemand und ich habe mein Handy im Auto vergessen –« Er fuhr sich durchs Haar und ließ seinen Blick langsam von Emil zu Dorian gleiten. »Ich habe zwar nicht gesehen, wie es passiert ist, aber es war sicher Notwehr«, wiederholte er.
»Nein.« Dorian setzte zu einem Kopfschütteln an, doch schon die erste Bewegung trieb ihm vor Schmerz fast Tränen in die Augen. »Ich habe gar nichts getan. Nur geschlafen, und als ich aufgewacht bin …«
Der Fremde lächelte verständnisvoll. »Nimmst du Drogen?«
»Ich? Nein! Habe ich noch nie.«
»Aber du trinkst?«
»Auch nicht.« Was sollte das denn? Ach, natürlich: Der Mann wollte ihn in ein Gespräch verwickeln, bis doch noch die Polizei eintraf. Dorian wich drei Schritte zurück. Er würde jetzt wegrennen, auch wenn sein Kopf explodierte, doch die Art, wie der Mann die Hand hob, ließ ihn noch einmal innehalten.
»Warte«, sagte er leise. »Weißt du, möglicherweise kann ich dir helfen. Ich bin ja nicht zufällig hier, ich arbeite für eine Organisation, die jugendliche Obdachlose von der Straße holt, und …«
Vor Dorians Augen verschwamm die Welt, er fühlte, wie seine Knie nachgaben und ihn im nächsten Moment jemand unter den Achseln packte.
»Vermutlich hat er dir eins auf den Kopf gegeben, kann das sein? Ist dir übel? Dann hast du wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung.«
Das klang, als könnte es wahr sein. Aber Dorian erinnerte sich nicht an einen Kampf. Er hatte sich einfach nur in dieser Nische schlafen gelegt. Da war er sicher, vollkommen sicher.
»Sie wollen mir helfen?«, brachte er mühsam hervor. »Mich decken?« Die letzten Monate hatten Misstrauen zu einer seiner hervorstechendsten Eigenschaften werden lassen. Warum stand dieser Kerl immer noch bei ihm? Jeder andere Passant wäre längst davongestürzt, um einen Mord zu melden.
Wenn der Mann aber wirklich so etwas wie ein Sozialarbeiter war, würde er eher versuchen, Dorian dazu zu bringen, dass er sich freiwillig stellte. Ich würde es tun, wenn ich wüsste, dass ich es wirklich gewesen bin.
»Du musst mir nicht vertrauen«, sagte der Fremde mit völlig ernstem Gesicht. »Aber ich kann dir anbieten, dass wir uns um dich kümmern. In unserer Organisation wissen fast alle, wie es ist, auf der Straße leben zu müssen. Viele erinnern sich gut an Nächte, in denen sie plötzlich ein Messer oder eine scharfe Glasscherbe an den Hals gedrückt bekamen. So lange, bis sie alles herausrückten, was sie mühsam erbettelt hatten.«
Die Kopfschmerzen machten das Denken unfassbar schwer. »Ich kann doch nicht einfach so gehen«, flüsterte Dorian, »und Emil hier liegen lassen. Vielleicht …«
»Vielleicht lebt er noch, wolltest du sagen?« Der junge Mann seufzte tief. »Ich fürchte, da dürfen wir uns nichts vormachen. Sieh dir an, wie viel Blut hier geflossen ist. Ich begleite dich sehr gern zur Polizei, aber vielleicht solltest du zuerst einmal versuchen, dich wieder an das zu erinnern, was passiert ist.« Er blickte zur Seite. »Sonst hast du einfach viel schlechtere Karten. Auch vor Gericht.«
Ein Geräusch unterbrach ihr Gespräch. Bisher war die Unterführung menschenleer gewesen, nun waren in einiger Entfernung Schritte zu hören, die von den Wänden widerhallten. Und näher kamen.
Dorian traf seine Entscheidung. Er überwand seine Schmerzen und seinen Ekel, bückte sich – wobei ihm beinahe wieder schwarz vor Augen wurde – und hob mit spitzen Fingern das Taschenmesser aus der Blutlache. »Gut. Ich komme mit Ihnen. Egal ob zur Polizei oder sonst wohin. Aber sagen Sie mir vorher noch Ihren Namen?«
Diesmal lächelte der Mann so herzlich, dass sich Fältchen in seinen Augenwinkeln bildeten. »Gerne. Ich heiße Nicolas Korte, aber in Bornheims Villa nennen mich alle Nico.«
Kapitel 2
Sie steuerten auf einen teuren dunklen Lieferwagen zu, der am Rand des Parks abgestellt war. Als sie näher kamen, stieg ein groß gewachsener Mann aus und öffnete die Hecktür.
»Du steigst besser hinten ein«, sagte Nico an Dorian gewandt. »Zur Sicherheit, du verstehst?«
Natürlich verstand er. In Kürze würde es hier von Polizisten nur so wimmeln und sobald Emils Kumpel aus ihrem Rausch erwachten, würden sie sich garantiert noch an den Zwischenfall von vergangener Nacht erinnern. Als Dorian sich sein Taschenmesser zurückgeholt hatte. Wie sehr er jetzt wünschte, er hätte es nicht getan.
Die Hecktüren schlossen sich und sperrten jegliches Licht aus, ließen ihn in undurchdringlicher Dunkelheit zurück. Dann wurde der Motor gestartet.
Panik. Nur einen Augenblick lang, aber so heftig, dass Dorian keine Luft mehr bekam und sich nun beinahe wirklich übergeben musste. Er hatte sich diesem Nicolas Korte einfach ausgeliefert, ohne ihn zu kennen, ohne zu wissen, was er wirklich vorhatte. Vielleicht fuhren sie gerade zu einem abgelegenen Ort, wo man in ein paar Tagen oder Wochen Dorians Leiche finden würde …
Nur – was hätte der Kerl davon? Außer er war ein irrer Mörder, der gerne Teenager tötete.
Bilder aus den Horrorfilmen, die Dorian früher so oft gesehen hatte, tauchten in seinem Kopf auf. Er schüttelte sie ab. Nein, das war bloße Fantasie, so etwas passierte in Wirklichkeit nicht.
Außerdem hatte er nach wie vor das Taschenmesser, dessen Griff er immer noch zwischen Daumen und Zeigefinger festhielt, ohne dass es ihm richtig bewusst gewesen war.
Er unterdrückte den Impuls, es einfach fallen zu lassen, obwohl der Ekel ihn fast schüttelte. Aber so dumm, seine einzige Waffe wegzuwerfen, war er nicht.
Die Fahrt dauerte lange und bot Dorian jede Gelegenheit, sich den Kopf über das zu zerbrechen, was passiert sein mochte.
War er Schlafwandler und hatte Emil im Zuge einer Episode getötet? Oder hatte er es bewusst getan und danach verdrängt? War es möglich, dass Nicos Theorie mit dem Schlag auf den Kopf, der die Erinnerung an das Geschehene ausgelöscht hatte, stimmte?
Jeder dieser Gedanken fühlte sich falsch an. Da war es doch wahrscheinlicher, dass ihm das Messer im Schlaf gestohlen worden war …
Sie mussten nun schon mindestens eine halbe Stunde unterwegs sein. Vielleicht auch eine ganze. Dorians Arm, mit dem er das Messer so weit wie möglich von sich weghielt, begann mehr und mehr zu erlahmen.
Irgendwann ließ er es doch fallen. Weil er müde war und die Schmerzen kaum nachließen. Weil ohnehin alles verloren war. Weil nichts mehr einen Sinn ergab. Nun schlitterte das Messer bei jeder Kurve klappernd von einer Wagenseite zur anderen.
Nach geraumer Zeit wurde das Auto langsamer, die Straße holpriger, und dann hielten sie an.
Dorian blinzelte ins graue Morgenlicht, als der Fahrer die Hecktüren öffnete. Insgeheim hatte er mit weiterer Dunkelheit gerechnet, einem Wald oder einem anderen finsteren Ort. Doch sie standen in der Auffahrt eines alten Herrenhauses, umgeben von einem gepflegten Park. Sorgsam geschnittene Hecken, mächtige Laubbäume, ein von Marmorstatuen gesäumter Weg.
Vorhin hatte Nico eine Villa erwähnt. Bornheims Villa. Das war sie wohl. Nun wies er auf die Freitreppe, die zum Eingang führte. »Herzlich willkommen, Dorian. Du solltest etwas essen und du wirst duschen wollen. Antonia wartet im Haus auf dich, sie wird dich mit allem versorgen, was du brauchst.«
Das Taschenmesser lag in greifbarer Nähe, die Stöße gegen die Autowände hatten die Klinge halb wieder eingeklappt. Es widerstrebte Dorian, danach zu greifen; das Blut, das das Messer vorhin an seiner rechten Hand hinterlassen hatte, war teils abgewischt, teils eingetrocknet. Er wollte nicht noch einmal damit in Berührung kommen.
»Lass es ruhig liegen.« Nico hatte seinen Blick offenbar bemerkt. »Wir kümmern uns darum, dass niemand es zu sehen bekommt, und in nächster Zeit wirst du es nicht brauchen.«
Der Kies knirschte unter Dorians Schuhen, während er auf das Anwesen zuging. Erst als er die Treppe betrat, wurde ihm klar, was eben passiert war, und einen Moment lang überlegte er, einfach kehrtzumachen und davonzulaufen.
Nico hatte ihn mit seinem Namen angesprochen. Doch den hatte Dorian ihm gar nicht genannt.
Antonia erwies sich als sommersprossiges rothaariges Mädchen in Jeans und grünem Rollkragenpullover. Sie streckte Dorian die Hand hin und zuckte nur die Schultern, als er ihr seine nicht reichte. Er wollte nichts und niemanden mit diesen schmutzigen Fingern anfassen; da war es ihm lieber, Antonia hielt ihn für unhöflich.
»Möchtest du etwas essen?«, erkundigte sie sich, während sie durch die Eingangshalle voranging. »Wir haben ein normales, ein vegetarisches und ein Diätmenü. Bist du lactoseintolerant? Irgendwelche Allergien?«
Beinahe hätte Dorian laut herausgelacht – aus Erschöpfung, aber auch, weil er das Gefühl hatte, in einer völlig fremden Welt gelandet zu sein. Seit sechs Monaten ernährte er sich hauptsächlich von Supermarktmüll, an guten Tagen von dem, was in der Notschlafstelle gekocht wurde. Oder bei der Caritas. Und nun wurden ihm drei verschiedene Menüs angeboten.
»Zuerst würde ich mich gern waschen.« Unwillkürlich versteckte er seine rechte Hand hinter dem Rücken. »Und falls du eine Kopfschmerztablette hast …«
»Kann ich verstehen und habe ich.« Weder in Antonias Stimme noch in ihrem Blick lag Ironie. »Komm mit.«
Sie führte ihn ein Stockwerk höher, in ein luxuriöses Badezimmer mit acht Duschen und ebenso vielen Waschbecken. Heller Marmor, indirekte Beleuchtung. Aus einem Medizinschrank, für den sie den Schlüssel an einem Bund trug, holte sie Schmerztabletten und drückte eine davon aus dem Blister. »Hier hast du Seife und zwei Handtücher und hier«, sie zeigte auf einen ordentlich zusammengelegten Haufen Kleidung, »etwas zum Umziehen.« Ein knappes Lächeln, schon war sie aus der Tür.
Als Erstes schluckte Dorian die Tablette, dann zog er sich langsam aus. Alle seine Instinkte schlugen Alarm. Das alles hier war viel zu gut, um harmlos zu sein. Keine Sekunde lang glaubte er, dass irgendjemand aus reiner Menschenliebe junge Leute von der Straße holte, um sie in seiner Villa auf Fünf-Sterne-Niveau einzuquartieren. Schon gar nicht, wenn man annahm, dass sie gerade jemanden getötet hatten.
Sofort stand Dorian wieder Emil vor Augen, wie er bäuchlings auf dem dunklen Asphalt lag, in einer größer und größer werdenden Blutlache …
Er musste längst gefunden worden sein. Wahrscheinlich tot.
Für einen Moment schloss Dorian die Augen. Ich war es nicht, sagte er sich immer wieder. Ich war es nicht. Aber ich hätte versuchen müssen, ihm zu helfen.
Die Erinnerung und das schlechte Gewissen verblassten erst allmählich, als Dorian unter der Dusche stand. Es war unfassbar schön, sich endlich wieder richtig säubern zu können; zudem kam das Wasser nicht nur von oben, sondern auch aus seitlichen Düsen, es prasselte auf ihn ein, hüllte ihn in Dampf.
Es mussten fünfzehn oder zwanzig Minuten vergangen sein, ehe er die Dusche wieder verließ und sich mit einem der dicken weißen Handtücher abtrocknete.
Die Kleidung, die man für ihn vorbereitet hatte, bestand aus Unterwäsche, einer grauen Jeans und einem ebenso grauen Langarmshirt. Die Sachen passten, als hätte er sie vorher anprobiert.
Ein wenig später, an dem langen Tisch im Speisezimmer, versuchte er, Antonia behutsam auszufragen.
»Nico hat dieses Haus Bornheims Villa genannt. Weißt du, wer Bornheim ist?«
Bei der Nennung des Namens ging ein Strahlen über Antonias Gesicht. »Natürlich weiß ich das. Raoul Bornheim, der großartigste Mensch, dem ich je begegnet bin.« Sie stupste Dorian an. »Oder dem du je begegnen wirst. Er hat jeden Einzelnen hier aus einer Notsituation geholt, manche von uns säßen ohne ihn längst im Gefängnis, andere wären tot.«
Für mich gilt Ersteres, dachte Dorian bitter. »Und das tut er einfach, weil er nett ist?«
»Wenn du das so ausdrücken willst. Er tut es, weil die Menschen ihm am Herzen liegen. Er setzt sich für eine ganze Menge guter Ziele ein, hat drei eigene wohltätige Organisationen und unterstützt sieben oder acht andere.«
Dorian zog die Augenbrauen hoch, was nun immerhin schon ging, ohne dass er die Zähne zusammenbeißen musste. Die Tablette wirkte.
»Glaub nicht, du bist der Erste, der sich fragt, ob Bornheim bescheuert ist«, fuhr Antonia fort, während sie einen Teller voll herrlich duftendem Hühnercurry aus der Mikrowelle holte und vor ihm abstellte. »Alle, die hier landen, sind erst misstrauisch und bei manchen dauert es zwei oder drei Monate, bis sie kapieren, dass niemand ihnen etwas Böses will.« Sie reichte ihm eine Serviette – aus Stoff – und setzte sich neben ihn. »Es gibt trotzdem Leute, die es nicht lange hier aushalten. Weil Bornheim Wert auf Benehmen legt und darauf, dass wir den Unterricht ernst nehmen. Da ist er ziemlich strikt.«
Unterricht. Wahrscheinlich war er der Einzige im Haus, vermutete Dorian, bei dem dieses Wort Vorfreude auslöste. Während er aß, musterte er Antonia von der Seite. »Haben sie dich auch von der Straße aufgelesen?«
Sie nickte. »Gewissermaßen. Ich habe mit ein paar anderen in einem einsturzgefährdeten Haus gewohnt, das inzwischen abgerissen wurde. Damals hat Bornheim mich aufgegabelt, persönlich. War echt Glück.«
Glück ja, Zufall eher nicht. Ebenso wenig wie Nicos Auftauchen in der U-Bahn-Station, das hatte er ja sogar selbst zugegeben. War es möglich, dass er gezielt nach Dorian gesucht hatte? Immerhin …
»Nico hat mich mit meinem Namen angesprochen, aber ich hatte mich ihm gar nicht vorgestellt.« Er ließ Antonia nicht aus den Augen, wartete auf eine Reaktion. »Hat er Erkundigungen über mich eingeholt? Schon vorher?«
»Kann sein.« Sie nahm einen Schluck aus ihrem Wasserglas. »Jeden nimmt Bornheim hier auch nicht auf, weißt du.«
Das konnte Dorian gut verstehen, nur war es dann umso merkwürdiger, dass er kein Problem mit jemandem hatte, der möglicherweise eben erst einem Mann die Kehle durchgeschnitten hatte. Oder würde Nico ihm das verschweigen? Nachdem ja niemand wirklich wusste, wer Emil auf dem Gewissen hatte …
Trotz der grausamen Bilder in seinem Kopf hatte Dorian den Teller schon fast leer gegessen, wie er eben erst bemerkte. Antonia deutete mit dem Finger darauf.
»Möchtest du noch eine Portion?«
»Nein. Aber wenn du mir den nächsten Computer mit Internetanschluss zeigen könntest?« Mittlerweile gab es bestimmt schon eine Meldung auf einer der Nachrichtenplattformen. Obdachloser ermordet aufgefunden, vom Täter keine Spur. Oder so ähnlich.
»Es gibt kein Internet im Haus«, unterbrach Antonia seine Gedanken. »Auch kein Fernsehen, tut mir leid.«
»Ernsthaft?« Dorian ließ die Gabel wieder sinken, mit der er gerade den letzten Bissen zum Mund hatte führen wollen. »Wieso denn das?«
»Bornheim will, dass sich alle aufs Wesentliche konzentrieren, und damit meint er ihre Ausbildung und Zukunft.« Sie lächelte. »Zukunft ist ein Wort, das du hier sehr oft hören wirst.«
Insgeheim hatte Dorian darauf gebrannt, nach gut einem halben Jahr wieder einmal vor einem Computer sitzen zu können. Natürlich vor allem, um zu verfolgen, was rund um Emils Tod in den Medien berichtet wurde. Aber auch, um zu sehen, wer ihm während dieser langen Zeit Mails geschickt hatte, ob es Facebook-Messages gab, alle diese Dinge.
War Nico sich eigentlich sicher, dass niemand gesehen hatte, wie Dorian in den Lieferwagen gestiegen war? Er selbst war viel zu verstört und mit seinen Kopfschmerzen beschäftigt gewesen, um darauf zu achten. Was, wenn gleich die Polizei an die Tür hämmerte?
»Beunruhigt dich etwas?« Antonia hatte seinen Teller genommen und war schon auf dem Weg zur Tür.
Er zögerte einen Moment, wusste nicht, ob er sich ihr anvertrauen konnte. »Ich habe mich nur gefragt, ob noch jemand wissen könnte, dass ich hier bin. Jemand von außerhalb.«
Sie lachte. »Bisher ist noch keiner von denen, die sich hier versteckt haben, gefunden worden. Da wärst du wirklich der Erste.«
Sein Zimmer befand sich im Westtrakt, wie Antonia ihm erklärte, während sie vorausging. Ihrer beider Schritte wurden von dicken Läufern gedämpft, die sich über den gesamten Gang und die Treppen hinauf zogen. Im zweiten Stock blieb Antonia vor einer der vielen Türen stehen, die vom Flur abgingen, und steckte einen langen Messingschlüssel ins Schloss.
»Hier wohnst du. Am besten, du schläfst noch ein bisschen. Soweit ich informiert bin, hattest du eine unruhige Nacht …« Sie öffnete die Tür und drückte ihm den Schlüssel in die Hand. »Bis später.«
Das Zimmer war geräumig und es war gemütlich. Roter Teppich auf hellem Holzboden, ein Kleiderschrank, ein breites Bett, eine Couch und ein Schreibtisch. Außerdem ein hohes, bogenförmiges Fenster, das Ausblick auf eine Wiese und den dahinterliegenden Wald bot. Leichter Wind bewegte das Gras.
Dorian legte die Stirn gegen die Scheibe und blickte nach draußen. Erst jetzt erlaubte er den Bildern in seinem Kopf, ihre scharfen Umrisse zu zeigen.
Emil. Sein Blut, das auf Dorian zufloss. Das Taschenmesser, das er beim Einschlafen in der Hand gehalten hatte, beim Aufwachen aber nicht mehr.
Was, wenn ich es wirklich war?
Eine naheliegendere Erklärung gab es nicht. Immerhin hatte Nico ihn mit Emil kämpfen sehen – aber beim Ende dieses Kampfes war er nicht dabei gewesen. Vielleicht hatte sich noch ein Dritter eingemischt? Hatte Dorian niedergeschlagen und Emil getötet?
Oder Dorians Unterbewusstsein hatte einen Selbstverteidigungsmechanismus entwickelt, einen gewalttätigen Teil seines Ichs, der außerhalb seiner Kontrolle lag.
Vielleicht hatte sich aber auch nur der Hass, den er auf seinen Vater hatte, gegen den Falschen gerichtet.
Dorians Kehle verengte sich. Er verabscheute Gewalt, sie hatte ihn jahrelang täglich begleitet. Vaters Schläge, Tritte, Stöße. Sein Gebrüll. Die Vorstellung, dass er, Dorian, sich möglicherweise zu etwas noch viel Schlimmerem hatte hinreißen lassen, schnürte ihm die Luft ab.
Er legte sich aufs Bett und bohrte sein Gesicht tief ins Kissen. Wartete, bis Tränen kamen, und ließ sie fließen. Lautlos, so wie früher.
Er musste eingeschlafen sein, denn er erwachte plötzlich und mit hämmerndem Herzen. Jemand klopfte an die Tür.
»Dorian? Es gibt jetzt Kaffee, wenn du möchtest. Danach kannst du dich für deine Kurse einteilen lassen.«
»Ja. Danke. Ich komme gleich.«
Er richtete sich langsam auf. Das Licht, das durch das Fenster hereinfiel, hatte sich verändert und über dem Wald lag der rötliche Schimmer eines späten Oktobernachmittags.
Kaffee. Das Wort hatte etwas Tröstliches. Es klang nach Normalität, nach gemütlichem Beisammensein, nach gemeinsamem Lachen. Er hatte ewig keinen Kaffee mehr getrunken. Als er nun aus seinem Zimmer trat, konnte er ihn bereits riechen.
Das Haus war jetzt belebter als zuvor. Auf der Treppe begegnete er zwei Mädchen, etwa in seinem Alter. Eines davon mit deutlichem Übergewicht und unzähligen Tätowierungen auf den Armen, das andere mit tiefschwarz geschminkten Augen und streichholzkurz geschorenem Haar.
Er nickte grüßend, sie nickten zurück, ohne dabei ihre Unterhaltung zu unterbrechen. Den Weg zum Speisezimmer fand Dorian auf Anhieb und auch dort war inzwischen etwas mehr los. Am Tisch saßen drei Jugendliche: zwei Jungen und ein Mädchen.
»Frederick, Melvin und Stella«, erklärte Antonia, die gleichzeitig mit ihm den Raum betrat, ein Tablett mit Kaffeetassen und einem Teller voller Kekse in den Händen. »Du kannst dir jeden Stuhl nehmen, den du willst, es gibt keine feste Sitzordnung.«
Am liebsten hätte Dorian sich möglichst weit von den anderen weggesetzt, er fühlte sich nicht zu Gesprächen aufgelegt. Andererseits wollte er nicht vom ersten Tag an als ungesellig gelten. Er setzte sich neben den groß gewachsenen Kerl, von dem er vermutete, dass es Frederick war. »Hi. Ich heiße Dorian.«
Die drei wirkten unbeeindruckt. Niemand musterte ihn forschend oder ängstlich – das bedeutete wohl, es hatte sich noch nicht herumgesprochen, dass Nico ihn neben der blutüberströmten Leiche eines Obdachlosen gefunden hatte.
Stella fischte sich einen der Kekse vom Teller, ohne Dorian dabei aus den Augen zu lassen. Dunkle Augen unter ebensolchen Augenbrauen. Ihr Haar dagegen hatte die Farbe von Karamell und kräuselte sich in wilden Locken bis weit über die Schultern.
»Do-ri-an«, stellte sie zufrieden fest. »Cooler Name. Wie alt bist du?«
»Siebzehn.«
»Hey. Ich auch, in drei Wochen.« Sie steckte den Keks in den Mund und legte den Kopf schief, kauend. »Wirst du einer von den Schwierigen sein?«
Von den Schwierigen? Er begriff nicht, was sie meinte, zuckte die Schultern.
»Na ja. Einer von denen, die aggressiv werden oder jede Nacht im Schlaf schreien oder plötzlich abhauen und sich nie wieder blicken lassen.« Stella stützte ihr Kinn auf die Hände. »Seltsam sind wir hier alle, zumindest ein bisschen. Melvin zum Beispiel klaut und er ist wahnsinnig geschickt dabei.« Sie rempelte den Jungen neben ihr freundschaftlich mit dem Ellenbogen an. »Nicht wahr, Melvin? Netterweise gibst du einem die wichtigsten Dinge anschließend wieder zurück.« Sie grinste Dorian an. »Das muss er, sonst wirft Bornheim ihn nämlich raus. Wir sind hier lauter Engel, gezwungenermaßen. Keine Zigaretten, kein Alkohol und Drogen sowieso nicht. Junkies bringt Bornheim grundsätzlich nicht her.«
Dorian nickte Melvin zu, war aber nicht sicher, ob der das mitbekam. Ihm hing das dunkle Haar so tief in die Stirn, dass es die Augen praktisch verdeckte. »Wie lange wohnst du schon hier?«, fragte er Stella.
»Sieben Monate. Und ja, am Anfang war ich auch skeptisch und habe mich ständig gefragt, ob man mich in eine Falle gelockt hat. Aber es geht wirklich alles mit rechten Dingen zu.« Sie lehnte sich in ihrem Stuhl zurück. »Überraschenderweise.«
Trotz ihres offenen Blicks wusste Dorian nicht, ob es klug war, Stella zu vertrauen. Es war schließlich möglich, dass Antonia ihn zu den dreien gesetzt hatte, damit die ihm erzählten, was er glauben sollte. »Hat jemand von euch Kontakt zu seiner Familie? Oder zu Freunden von früher?«
Diesmal war es Frederick, der antwortete, in schleppendem, mürrischem Ton. »Wenn wir brauchbare Familien oder Freunde hätten, wären wir nicht auf der Straße gelandet, oder?« Er stand auf und trug sein Geschirr in Richtung Küche; Melvin folgte seinem Beispiel. An der Tür drehte Frederick sich noch einmal um. »Ach, und wenn du dir später Kurse aussuchen sollst: Literatur ist ganz witzig. Englisch auch. Von Russisch würde ich die Finger lassen.«
Stella, die keine Anstalten machte, den Tisch ebenfalls zu verlassen, lachte auf. »Das sagt er vor allem, weil er Pjotr nicht leiden kann.« Sie wartete, bis die beiden anderen endgültig draußen waren, dann lehnte sie sich über den Tisch. »Es ist so: Wir unterrichten uns hier praktisch gegenseitig. Es gibt nur zwei richtige Lehrer, den Rest erledigen wir entweder in Gruppenarbeit oder einer von uns übernimmt den Job, wenn er etwas richtig gut kann. Pjotr ist Russe, also …« Sie breitete die Arme aus.
Diese Art von Unterricht hatte Dorian nicht erwartet. »Und … das funktioniert?«
»Aber hallo. Du kannst dir nicht vorstellen, wie gut. Ich stehe zum Beispiel total auf Geschichte und Bornheim war damit einverstanden, dass ich das Fach übernehme, obwohl ich erst sechzehn bin. Ich strenge mich echt an, damit jeder, der meinen Kurs besucht, klüger rausgeht, als er reingekommen ist. Und die Schüler sind auch ehrgeizig, weil keiner vor den anderen dumm dastehen will. Spitzensystem, kannst du mir glauben.« Sie nahm einen Schluck aus ihrer Kaffeetasse.
Unwillkürlich fragte Dorian sich, ob es ein Fach gab, in dem er gut genug war, um es lehren zu können. Physik vielleicht.
Ja, und Selbstverteidigung mit Taschenmessern. Der Gedanke hatte sich ungebeten in seinen Kopf geschlichen und bevor Dorian es verhindern konnte, hatte er wieder Emil vor Augen. Er schluckte.
»Alles in Ordnung?« Über Stellas Nase hatte sich eine Längsfalte gebildet.
»Ja, sicher.« Von draußen waren gedämpfte Motorengeräusche zu hören und er wandte den Kopf in Richtung Fenster, dankbar für die Ablenkung. »Denkst du, das ist der nächste Neuzugang?«
Es war hübsch anzusehen, wie Stellas Locken mitschwangen, wenn sie den Kopf schüttelte. »Das sind die anderen. Die, die heute gearbeitet haben.«
Ah, okay. Es gab also doch eine Art Gegenleistung, die man erbringen musste für das Privileg, hier wohnen zu dürfen. Das war beinahe eine Erleichterung.
»Welche Arbeit ist das denn?«, erkundigte er sich.
Draußen schlug eine Wagentür zu.
»Unterschiedlich«, erklärte ihm Stella. »Aber es sind immer völlig einfache Dinge. Kleine Erledigungen für die Villa oder für Bornheim persönlich. Oder Flugblätter verteilen. Das vor allem.«
»Flugblätter? Du meinst Werbezettel, ja?«
»So ähnlich. Meistens sind es Infoblätter von den wohltätigen Organisationen, die Bornheim unterstützt. Inklusive Zahlscheinen. Wir sollen freundlich lächeln und auch dann nicht sauer reagieren, wenn jemand uns beschimpft.« Sie warf ihr Haar hinter die Schulter zurück. »Das ist es, was mir dabei am schwersten fällt.«
Das konnte Dorian sich gut vorstellen. Ihm selbst wurde kalt bei dem Gedanken, draußen auf der Straße stehen zu müssen, sichtbar für alle, in dem Wissen, dass jederzeit die Polizei um die Ecke biegen konnte. Würde man das von ihm verlangen? Obwohl zumindest Nico wusste, welche Folgen das vielleicht haben würde?
Er murmelte eine Entschuldigung und stand auf, wollte in sein Zimmer zurück, um nachzudenken. Doch Stella fing ihn noch vor der Tür ab und hakte sich bei ihm ein. Ihre plötzliche Nähe verschlug ihm für einen Moment die Sprache. Es war lange her, dass jemand ihn auf diese Weise berührt hatte. Freundschaftlich. Ohne eine Bedrohung zu sein.
»Ich stelle dir noch ein paar Leute vor und dann begleite ich dich zu Paula, mit der du deinen Stundenplan zusammenstellen solltest.« Sie zwinkerte ihm zu. »Ausreden lasse ich nicht gelten, ich weiß, dass du nichts Besseres zu tun hast.«
Die nächste halbe Stunde lang schüttelte er Hände von anderen Bewohnern der Villa. Manche von ihnen freuten sich sichtlich über seine Anwesenheit, andere würdigten ihn kaum eines Blickes. Die ganze Zeit über war Stella neben ihm, und sosehr er ihre Nähe genoss, so nervös machte sie ihn auch.
Was daran liegen konnte, dass Stella auf eine Art und Weise duftete, die ihm noch nie begegnet war. Zweimal ertappte er sich dabei, wie er an ihrem Haar schnupperte, und rief sich selbst zur Ordnung. Sie wollte nichts von ihm, sondern war nur nett, das war alles. Und er war Nettigkeit nicht mehr gewohnt, kein Wunder also, dass sie gleich so heftige Reaktionen bei ihm hervorrief.
Dafür war Paula alles andere als freundlich. Dorian schätzte sie auf etwa neunzehn und konnte kaum den Blick von dem Tattoo wenden, das sich von ihrer rechten Schläfe bis über den Backenknochen wand. Dunkelblaue, ineinander verschlungene Dornenranken, die den Charakter ihrer Trägerin bestens widerspiegelten.
Sie musterte Dorian von oben bis unten, bevor sie einen zerknitterten Zettel aus ihrer Schreibtischschublade zog, den sie vor ihn hinlegte. »Da. Das ist das Angebot, mehr gibt’s nicht. Wochentage und Uhrzeiten stehen überall dabei. Such dir aus, was du möchtest – das ist dann aber auch verpflichtend. Du musst hingehen, außer du hast Dienst, aber das hat dir Stella sicher schon gesagt.«
Dorian suchte Paulas Blick, erfolglos. »Nein. Hat sie noch nicht.«
»Ehrlich? Die kriegt doch den Mund nicht zu, wenn sie einmal zu quatschen angefangen hat. Und diesmal war gar nichts Nützliches dabei?«
Stella lächelte weiter, sogar noch etwas herzlicher als zuvor. »Ich wollte dir nicht ins Handwerk pfuschen.«
Genervt verdrehte Paula die Augen. »Also: Du kannst so viele Kurse belegen, wie du willst. Fünf müssen es mindestens sein, verpflichtend sind Ethik und Deutsch.« Sie atmete lautstark aus, als hätte sie eben etwas sehr Anstrengendes hinter sich gebracht.
Dorian zog den Zettel näher zu sich heran. Sport gab es am Dienstag und am Freitag. Deutsch am Montag, Mittwoch und Freitag. Ethik jeden Tag außer Montag. Ganz unten auf der Liste fand er Geschichte und daneben Stellas Namen. Donnerstag.
Mit dem Stift, den Paula ihm widerwillig entgegenhielt, kreiste Dorian die Kurse ein, die er sich ausgesucht hatte, und ließ den Freitag frei.
»Okay.« Paula warf einen kurzen, verächtlichen Blick auf seine Auswahl, legte das Blatt in den Kopierer und drückte den Knopf. »Die Kurse beginnen pünktlich und es ist egal, ob dein Lehrer älter oder jünger ist als du – du musst ihn höflich behandeln. Oder sie. Klar? Bornheim wird sonst richtig sauer.«
»Klar.« Dorian nahm die Kopie seines Plans entgegen und steckte sie zusammengefaltet in die Hosentasche. Wobei ihm erstmals bewusst wurde, dass sie alle das gleiche Hosenmodell trugen und im Prinzip auch die gleichen Shirts, nur in unterschiedlichen Farben. Paulas war blau, das von Stella grün.
»Haben die Farben eine Bedeutung?«, erkundigte er sich, als sie wieder draußen auf dem Gang waren.
Stella grinste. »Das frage ich mich auch seit Monaten. Irgendeine bestimmt, aber so richtig hat das bisher niemand durchschaut. Mit dem Alter hat es jedenfalls nichts zu tun und mit den Arbeitseinsätzen auch nicht. Wir machen praktisch alle das Gleiche.« Sie zupfte demonstrativ an ihrem Ärmel. »Zu Beginn hatte ich blaue Sachen, erst seit ungefähr zwei Monaten bekomme ich grüne. Ist mir lieber. Steht mir besser.«
Dorian blickte an sich hinunter. »Außer mir habe ich bisher aber noch niemanden mit einem grauen Shirt gesehen.«
»Weil du der Frischling hier bist.« Sie nahm seinen Arm. »Sobald Bornheim sich mit dir unterhalten hat, bekommst du neue Sachen in irgendeiner anderen Farbe.« Bevor sie wieder nach unten gingen, blieb Stella am Treppenabsatz stehen und betrachtete Dorian nachdenklich. »Ich hoffe nur, es ist nicht Schwarz.«
Kapitel 3
Dorian kam nicht mehr dazu, sie zu fragen, was sie damit meinte, weil sich im nächsten Moment ein sehr dünnes, kurzhaariges Mädchen auf Stella stürzte, sie umarmte und mit sich zog. Den restlichen Abend über bekam er sie nicht mehr zu Gesicht, obwohl er beharrlich nach ihr Ausschau hielt. Es waren gut vierzig Jugendliche in dem Raum, den man laut Antonia Salon nannte, aber Stella war nicht unter ihnen.
Dafür gesellte Melvin sich irgendwann zu ihm, schob die dunklen Strähnen so weit aus der Stirn, dass Dorian seine Augen sehen konnte, und versetzte ihm einen leichten Stoß gegen den Arm. »Okay. Und was ist deine Geschichte?«
Das war eine ungewöhnliche Art, ein Gespräch zu beginnen. Dorian hob zögernd die Schultern. »Was meinst du?«
»Warum du auf der Straße warst. Wie du hier gelandet bist.«
In den letzten Monaten hatte Dorian nur selten Unterhaltungen geführt, die über mehr als ein paar schnelle Sätze hinausgegangen waren. Kurze Wortwechsel mit Feinkostverkäuferinnen, das Abnicken freundlicher Tipps von Sozialarbeitern, das Beschwichtigen betrunkener Kerle wie Emil. Es fiel ihm schwer, jetzt aus dem Nichts seine Geschichte zu erzählen, ganz abgesehen davon, dass er gar nicht wusste, ob er es wollte.
Melvin schien das zu merken. »Also, ich bin mit vierzehn zu Hause abgehauen, wobei zu Hause die Sache irgendwie nicht trifft. Ich bin aus der Wohnung verschwunden, in die meine betrunkene Mutter jeden zweiten Abend einen anderen Kerl geschleppt hat. Genau weiß ich nicht, wann sie bemerkt hat, dass ich fort bin, aber drei Tage wird es schon gedauert haben. Ich war dann eine Zeit lang im Heim, das war fast genauso beschissen, also habe ich beschlossen, nach Spanien zu trampen.« Er pustete die wieder nach unten gerutschten Haare aus seiner Stirn. »Spanien war geil. Vier Monate am Strand schlafen, ein bisschen kellnern, Trinkgeld von deutschen Touristen abstauben. Aber dann hatte ich eine Fischvergiftung und wäre fast krepiert. Danach war ich zu schwach zum Arbeiten und dachte, ich müsste auf Knien zu meiner Mutter zurückkriechen. Mein letztes Geld habe ich für ein Zugticket nach Hause ausgegeben, was mir schon Stunden vor der Ankunft leidgetan hat. Ich konnte einfach nicht mehr bei meiner Mutter leben, nur leider ist mir das ein bisschen spät eingefallen. In meiner vierten Nacht am Bahnhof hat Bornheim mich aufgegabelt.« Melvin nahm Dorian am Arm und zog ihn zu einem der Ledersofas, das gerade frei geworden war. »Ich dachte erst, er will weiß Gott was. War aber ein Irrtum. Falls du dir Sorgen machen solltest: Er rührt niemanden an. Keinen von uns, weder Mädchen noch Jungs.«
Die Frage war Dorian tatsächlich durch den Kopf gegangen. »Das ist gut zu wissen.«
»Ja, nicht wahr? Und jetzt du.«
»Na ja.« Es war praktisch unmöglich, auf Melvins Offenheit mit Zurückhaltung zu reagieren. Dorian nahm innerlich Anlauf. »Ich bin vor meinem Vater davongelaufen. Er hat mich regelmäßig grün und blau geschlagen, irgendwann war es mir zu viel.«
»Oh.« Melvin runzelte die Stirn. »Säufer?«
»Nein. Arschloch. Klingt vielleicht blöd, aber wenn er ein Säufer wäre, könnte ich ihm den ganzen Mist leichter verzeihen.«
»Was ist mit deiner Mutter?«
»Tot.« Ein Schatten der alten Trauer legte sich wieder über die Welt, grau und schwer. »Sie ist an Krebs gestorben, da war ich dreizehn.«
»Scheiße.« Melvin sagte es mit so viel Inbrunst, dass Dorian unwillkürlich lächeln musste.
»Ja. Genau. Scheiße.«
Einen Moment lang schwiegen sie, während rundherum die Gespräche weiterplätscherten.
Dorian betrachtete Melvins Shirt. »Wieso bist du rot angezogen und Stella grün? Irgendeine Bedeutung hat das, oder?«
Melvin strich über den Stoff, als wolle er ihn glätten. »Weiß nicht. Ich bin ja der Meinung, sie haben mir Rot gegeben, weil ich damit einfach super aussehe.«
Womit er recht hatte. Eine bessere Farbe hätte er sich zu seinem dunklen Haar nicht aussuchen können.
»Manche von uns tragen auch Schwarz, stimmt das?«, hakte Dorian nach. »Ich habe es nämlich noch an niemandem gesehen.«
»Wirst du auch nicht.« Melvin zog die Knie an und wechselte in den Schneidersitz. »Offiziell gibt es die in Schwarz nicht, aber irgendwie hält sich das Gerücht. Keine Ahnung, woher es kommt. Meine Theorie ist ja, dass das die schweren Fälle sind. Die, die drogenabhängig waren oder richtige Gewalttäter, die werden nämlich manchmal aufgelesen, tauchen kurz hier auf und verschwinden sofort wieder.« Er senkte seine Stimme und blinzelte verschwörerisch. »Irgendjemand hat den Schwarzen den Spitznamen Mambas gegeben. Weil sie angeblich lautlos und gefährlich wie Giftschlangen sind. Allerdings kannst du hier fragen, wen du möchtest, begegnet ist ihnen noch niemand.« Er verschränkte die Arme hinter dem Kopf. »Weil sie nicht existieren. Bornheim will uns ja schließlich zu wertvollen Mitgliedern der Gesellschaft machen, nicht zu einer Kampf-Spezialeinheit.«
Dorian fühlte, wie sein Herz sank. Er hoffte sehr, dass Melvin recht hatte, denn wenn es die Mambas doch gab, konnte er sich leicht ausrechnen, welche Farbe man ihm zuteilen würde. Bornheim würde ihn zu den Junkies und Schlägern stecken. Zu den Gefährlichen. Weit weg von Stella.
In diesem Fall war es ein Wunder, dass er überhaupt Kontakt zu den anderen hatte haben dürfen.
Da war es wieder, das Bild von Emils totem Körper und dem Taschenmesser, das in Blut schwamm. Dorian wollte nicht darüber nachdenken, wo es sich nun befand – Nico hatte versprochen, sich darum zu kümmern. Es verschwinden zu lassen. Aber wer weiß, vielleicht bewahrte er es auch auf, um etwas gegen Dorian in der Hand zu haben, um ihn unter Druck setzen zu können, wenn es nötig war.
»Hallo? Bist du noch da?« Melvin bewegte die flache Hand vor Dorians Augen hin und her.
»Ja. Sorry, ich bin kurz abgedriftet. Sag mal, auch wenn es kein Internet und kein Fernsehen im Haus gibt – Zeitungen schon, oder?«
Es war Melvin am Gesicht abzulesen, dass er sich darüber noch nie Gedanken gemacht hatte. »Ehrlich gesagt … ich glaube nicht. Aber ich habe darauf noch nie geachtet, ich komme gut ohne Nachrichten aus.«
Bis vor Kurzem war es Dorian ebenso gegangen, aber jetzt hätte er viel dafür gegeben zu erfahren, was über den Mord an Emil geschrieben wurde. Ob es Verdächtige oder Zeugen gab. Ob nach jemandem gesucht wurde, auf den seine Beschreibung zutraf.
Er erklärte Melvin, dass er müde war und früh schlafen gehen würde, dann drehte er eine Runde durchs Haus, auf der Suche nach einer Zeitung von heute. Und nach Stella. Doch beides blieb erfolglos.
Sie liefen durch den kühlen Nieselregen, immer um den Sportplatz herum. Dorian hatte die weitläufigen Parkanlagen der Villa von seinem Fenster aus bewundert, aber nicht damit gerechnet, dass sich hinter der Baumgruppe zu seiner Rechten ein Leichtathletikplatz finden würde. Roter Sand, Laufbahnen. Die Sportschuhe, die man ihm zur Verfügung gestellt hatte, passten wie angegossen und Dorian genoss die Bewegung, den selbstverständlichen, gleichmäßigen Rhythmus, in den er nach der zweiten Runde gefallen war.
Zwei Stunden Sport. Der Lehrer war keiner von den Gleichaltrigen, sondern ein groß gewachsener, breitschultriger Mann von geschätzt Mitte vierzig. Sein Haar war leicht angegraut an den Schläfen und er trug allen Ernstes eine Trillerpfeife um den Hals.
Boris hieß er, hatte Melvin erklärt. Und sein ganzer Ehrgeiz sei es, ihnen allen beizubringen, was Kondition war.
Bis jetzt hielt Dorian sich ziemlich gut. Drei der Schüler hatten schon aufgegeben, sie standen vornübergebeugt am Rand und rangen nach Luft. Einer hatte sich sogar hingesetzt. Aber Dorian hatte das Gefühl, heute ewig laufen zu können. Als mache jeder Schritt seinen Kopf ein wenig freier und bringe ihn weiter von dieser furchtbaren Nacht fort.
Dann riss die Trillerpfeife ihn aus seiner Selbstvergessenheit.
»He, Neuer!« Boris winkte ihn zu sich. »Nicht schlecht bisher, wenigstens was das Laufen angeht. Ich möchte dich gleich noch ein paar andere Sachen probieren lassen, damit ich dich besser einschätzen kann. Sprint, Weitsprung, Werfen – okay?«
Dorian nickte und folgte dem Trainer, absolvierte sämtliche von ihm verlangte Übungen und erntete jeweils einen anerkennenden Blick.
»Nicht schlecht. Du machst regelmäßig Sport, nicht wahr?«
So hätte Dorian es nicht genannt. In den vergangenen Monaten war er manchmal wie ein Verrückter durch Parks gelaufen, um sich aufzuwärmen oder einfach nur, um seinen Kopf frei zu bekommen. Nicht mehr an seinen Vater denken zu müssen. Er war immer wieder über Zäune und Mauern geklettert oder über Hindernisse gesprungen, um ruhige Plätzchen zum Schlafen zu finden, aber Sport …
»Früher«, sagte er. »Früher habe ich Volleyball gespielt und war in einem Ruderklub.«
»Das merkt man.« Boris musterte ihn von oben bis unten. »Okay. Dann kannst du jetzt wieder zu den anderen zurück.«
Am Ende der Trainingseinheit war Dorian ausgepowert wie seit Jahren nicht mehr. Auf eine gute, befriedigende Art und Weise. Von den Nudeln, die es zum Mittagessen gab, holte er sich zwei Portionen, die er so schnell wie möglich hinunterschlang, um pünktlich bei seiner Englischstunde einzutreffen.
Im Klassenraum saß bereits Stella, gähnte und wickelte eine ihrer Locken um einen Bleistift. Ihr Blick hellte sich auf, als sie Dorian sah. »Hey! Wie geht’s dir? Hast du die erste Nacht gut überstanden?«
Der Platz neben ihr war noch frei und Dorian ergriff die Gelegenheit. »Ja, alles bestens«, sagte er und rückte sich den Stuhl zurecht. »Die Sportstunde vorhin war toll. Ich wünschte, die würde jeden Tag stattfinden.«
»Englisch ist auch nicht schlecht.« Sie klopfte auf das Buch, das vor ihr auf dem Tisch lag. The Catcher in the Rye. »Das lesen wir gerade. Klassischer Schulstoff, aber echt besser, als ich dachte.«
Dorian erwiderte ihr Lächeln und verbiss sich die Frage, die ihm mehr als alles andere auf der Zunge brannte. Was ihr zugestoßen war, welche Umstände sie hier hatten landen lassen. War es möglich, dass sie auch auf der Straße gelebt hatte? Wenn ja, war es ihr nicht anzusehen. Allen anderen, denen er bisher in der Villa begegnet war, war diese gewisse Wachsamkeit gemeinsam, die man sich fast von selbst aneignete, da draußen. Sogar Melvin, so offen er sich auch gegeben hatte, war gleichzeitig auf der Hut gewesen, hatte Dorian während ihres Gesprächs kaum aus den Augen gelassen.
Bei Stella war das anders. Sie wirkte … unbeschwert. Ja, genau, das war der Begriff, nach dem er gesucht hatte. Dem Rest der Bewohner merkte man an, dass sie in ihrem Leben durch üble Phasen gegangen waren. Ihr nicht.
»Was ziehst du denn für ein Gesicht?« Spielerisch stupste sie mit ihrem Knie gegen seines. »Kann ich dir beim Grübeln helfen?«
»Ich grüble gar nicht«, log er. »Ich kenne bloß dieses Buch schon. Aber das macht nichts, es ist ja wirklich gut.«
Das Mädchen, das sie unterrichtete, betrat kurz darauf den Raum. Sie hieß Tamara, war klein und wirkte schreckhaft, aber ihr Englisch war eindrucksvoll. Innerhalb kurzer Zeit entwickelte sich eine lebhafte Diskussion zwischen den Schülern und Dorian versuchte sich zu beteiligen, so gut es ging. Doch seine Gedanken drifteten immer wieder zu Stella ab. Von Minute zu Minute wurde die Vorstellung, er könnte zu den Schwarzgekleideten gesteckt und von ihr getrennt werden, unerträglicher. Sie war seit ewigen Zeiten das erste wirklich Gute, was ihm in seinem Leben begegnete.
Verliebt? War er das? So schnell? Oder sehnte er sich nur nach diesem Alles-ist-in-Ordnung-Gefühl, das ihn in ihrer Nähe durchströmte?
Die Frage beschäftigte ihn den ganzen restlichen Tag über, während er darauf achtete, Stella nicht aus den Augen zu verlieren.
Beim Abendessen setzte sie sich wie selbstverständlich neben ihn, was Dorian für einen Moment so glücklich machte, dass er fast laut herausgelacht hätte.
Okay, es war wirklich Zeit, einen Schritt zurückzutreten und sich zusammenzunehmen. Er hatte keine Ahnung, was in Stella vorging – dass sie hier saß, war wohl einfach Zufall. Wenn Dorian nicht aufpasste, würde er sich in seinen eigenen Hirngespinsten verfangen, sich Dinge einreden, die mit der Realität nicht das Geringste zu tun hatten.
Er atmete tief durch und wandte sich seinem Sitznachbarn zur Rechten zu, einem müde dreinblickenden Kerl namens Fabian, der auf sämtliche Fragen nur mit Ja, Nein oder Schulterzucken antwortete. Die ganze Zeit über war Dorian sich Stellas Anwesenheit überdeutlich bewusst, er würde nur seine Hand ein Stück weiterschieben müssen, um ihre zu berühren.
So etwas hatte er noch nie empfunden. Und dabei wusste er nicht das Geringste über sie. Vielleicht hatte sie ja einen Freund, hier in der Villa. Oder auch außerhalb.
Allein die Vorstellung tat auf eine so unsinnige Weise weh, dass Dorian über sich selbst den Kopf schüttelte.
Nein. Was sich da in ihm abspielte, war unvernünftig und viel zu viel. Hatte bestimmt mit der Extremsituation zu tun, in der er sich befand.
Hastig aß er seinen Teller leer, dann stand er vom Tisch auf. »Ich gehe heute früh schlafen.«
War das Enttäuschung in Stellas Augen? Er widerstand der Versuchung, sich wieder hinzusetzen. »Bis morgen.«
»Ja, bis dann«, sagte sie lächelnd.
Den restlichen Abend zwang Dorian sich dazu, auf seinem Bett zu liegen und The Catcher in the Rye zu lesen, aber er schaffte es nicht, sich auf die Geschichte zu konzentrieren. Alles, was er wollte, war, doch noch nach unten zu gehen und in Stellas Nähe zu sein.
Er verbrachte eine unruhige Nacht und verfluchte sich am nächsten Morgen dafür, seinem eigenen Wunsch nicht gefolgt zu sein, denn Stella war nicht beim Frühstück. Sie arbeitete heute und würde den ganzen Tag in der Stadt verbringen.
Vor Dorian lag ein Vormittag mit Deutschunterricht und einer Stunde Psychologie. Er hatte sich voll Vorfreude dafür angemeldet; jetzt wünschte er sich, einfach zurück ins Bett gehen und sich die Decke über den Kopf ziehen zu können.
Die Deutschlehrerin war etwa dreißig, hübsch und fröhlich, doch auch das hellte seine Stimmung nicht auf. Er hörte nur mit halbem Ohr zu, als sie begann, über Schillers Balladen zu sprechen, und dann einen der Schüler bat, Der Handschuh vorzulesen.
Stella war jetzt da draußen, in der Stadt. Der gleichen Stadt, durch die er monatelang gestreift war, ziellos. Warum hatte er sie nie zu Gesicht bekommen? Oder hatte er das und sie war ihm nicht aufgefallen? Es gab so viele Zettelverteiler in den Fußgängerzonen, meistens hatte er sie gemieden.
Sie hatten gerade zum nächsten Gedicht gewechselt, zu Der Taucher, als sich die Tür zum Unterrichtsraum öffnete.
Ein blasser Junge mit glattem blondem Haar spähte herein. »Dorian? Hier müsste ein Dorian sein.«
»Das bin ich.«
»Gut. Komm bitte mit.«
Polizei war das Erste, was ihm durch den Kopf schoss. Sie würden in der Halle warten, zu dritt oder zu viert, ihm Handschellen anlegen und ihn in ihr Auto zerren. Man würde ihm den Mord an Emil nachweisen und er würde Stella nie wiedersehen …
Doch der Junge führte ihn nicht in die Halle, sondern in einen anderen Trakt des Herrenhauses; einen, den Dorian noch nie betreten hatte. Hier waren die Teppiche dicker und die Gemälde an den Wänden sichtlich teuer und alt.
Vor einer hohen, doppelflügeligen Holztür hielten sie an. Dorians Begleiter klopfte und wartete auf das »Ja?« von innen.
»Du kannst reingehen.« Er setzte sich auf einen mit rotem Samt bezogenen Stuhl neben dem gegenüberliegenden Fenster. »Ich warte hier.«
Kapitel 4
Noch bevor er den Raum betrat, war Dorian klar, was jetzt auf ihn zukam. Er würde Bornheim kennenlernen, den Mann, dem die Villa gehörte, der obdachlosen Jugendlichen ein Zuhause gab.
Ihm gleich von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen, nachdem er bisher schon so viel von ihm gehört hatte, machte Dorian nervös und weckte in ihm den Wunsch, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Denn danach würde er irgendeine Farbe zugeteilt bekommen. Und falls es Schwarz war, dann …
Er öffnete langsam die Tür und fand sich in einem Büro von der Größe eines Ballsaals wieder. Es waren gut zwanzig Meter von dort, wo er stand, bis zu dem enormen Schreibtisch an der Fensterfront. Der Mann dahinter war gegen das Licht nur als Schatten zu erkennen. Groß, schlank, sehr gerade Schultern.
Er stand auf und winkte Dorian näher. Schüttelte ihm die Hand und wies dann auf den Lederstuhl auf der ihm gegenüberliegenden Seite des Schreibtischs. »Willkommen. Ich bin Raoul Bornheim und ich freue mich sehr, dass du jetzt zu uns gehörst. Setz dich doch bitte.«
Dorian kam der Aufforderung schweigend nach, wobei er Bornheims Gesicht musterte, so unauffällig wie möglich. Er schätzte den Mann auf Mitte fünfzig. Freundliche Augen. Hellgraues Haar. Hellgrauer Bart, der Oberlippe und Kinn bedeckte.
Ich freue mich sehr, dass du jetzt zu uns gehörst. Die Worte hallten in Dorian nach. Sie klangen, als wäre er einem Klub beigetreten. War das ein gutes Zeichen? Hieß es, dass Bornheim ihn in der Villa bleiben lassen würde? Trotz Emil? Trotz allem?