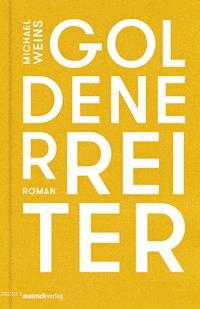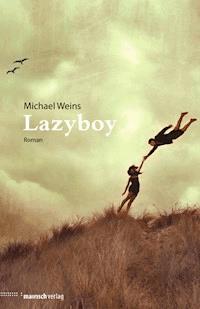
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mairisch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Heiner Boie, genannt "Lazyboy", geht durch Türen. Doch im Gegensatz zu anderen Leuten bringen sie ihn manchmal nicht in den angrenzenden Raum, sondern ganz woanders hin: Mal an ihm wohlbekannte Orte, mal an Plätze, die er nie zuvor gesehen hat. Zwar kann er das Ganze nicht kontrollieren und fühlt sich eher als Anti-Superheld, findet aber Gefallen an seinen Fähigkeiten. Bis er bei einem Türensprung die 13-jährige Daphne kennenlernt, die das alles gar nicht beeindruckt: Sie hat in ihrem Keller selbst so eine Tür, die nicht das macht, was sie soll. Lazyboy geht hindurch - aber diesmal kommt er an einen Ort, wo er noch nie war. Und dort geht die Geschichte erst los. Michael Weins erzählt in "Lazyboy" mit melancholischem Witz von einem, der erst spät bei sich ankommt - und der dazu eines Wunders bedarf, an das er selbst nicht glauben kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Intro
Erste Tür
Zweite Tür
Dritte Tür
Michael Weins
Impressum
»Was hast du denn auf einmal?«, fragt der Schatten.
»Wie war ich denn früher? Ich selbst – wer ist das?«, sage ich.
Haruki Murakami,
Erste Tür
1
Die Sprechstundenhilfe öffnet die Tür und singt meinen Namen: »Herr Lazyboy, bitte.«
Alle Augen wenden sich mir zu. Den Namen habe ich noch aus meiner Zeit als Rapper und als ich aufgelegt habe. Das habe ich sogar relativ lange noch gemacht, eigentlich fast bis gestern, wenn ich ehrlich bin. Und dann habe ich den Namen beibehalten, weil ich es cool fand, wenn unter meinen Plattenkritiken bei brünett Lazyboy steht. Lässig klingt das, finde ich. Sogar noch heute. Leider viel lässiger als der Typ, der da dahintersteht. 35 Jahre. 1 Meter 82, halblange, etwas schüttere blonde Haare im gerade angesagten Schnitt, Berufsjugendlichenkleidung. Ich habe es sogar in meinen Pass schreiben lassen, hat mich vierzig Euro gekostet, als Künstlername, Lazyboy. Und ich stelle mich tatsächlich so vor, auf Ämtern und bei Vorstellungsgesprächen, Eigenkonfrontationstherapie, um mich auf Kurs zu halten. Bloß nie weg vom Rand der Klippe, das ist mein Lebensmotto. Einmal passt du nicht auf und schon bist du Ernst Dieter Müller, sitzt auf dem Rasenmähertraktor, tuckerst über Vorortrasen, und durch die angelehnte Terrassentür hörst du den Säugling schreien. Und auch um mich vorzuführen und weil es einfach zu gut passt: Der faule Junge. Und außerdem sehe ich gerne zu, wie die Leute reagieren.
»Ist das Ihr echter Name, Lazyboy?«
Und ich sage: »Klar, Vorname Lazy, Nachname Boy, steht sogar in meinem Pass.«
»Haben Ihre Eltern sich das einfallen lassen?«
»Jaja, das sind so Althippies mit ganz verrückten Ideen, Egomanen der Selbstverwirklichung, haben ihren Spieltrieb an mir ausgelassen, und ich bin ja auch in Bangladesch in der Kommune geboren, müssen Sie wissen, und von der Gruppe aufgezogen worden, eine ambivalente Erfahrung für ein Kind.«
Oder: »Ja, Sie kennen doch den gleichnamigen Sessel? Mein Vater war der Fabrikant, erst der Sessel und dann ich, leider ist er verstorben.«
In Wirklichkeit heiße ich Heiner Boie, aber ich wurde schon in der Schule Boy genannt, und das Lazy hat sich später zwangsläufig ergeben.
Seit einiger Zeit gibt es eine Band in Schweden, die sich so nennt. Es ärgert mich maßlos, aber ich war früher.
Im Behandlungszimmer umfängt mich blaues Licht, das kommt von der Auslegeware. Auf dem Schreibtisch steht ein HSV-Kaffeebecher neben dem Porträtfoto vom Sohn, sieben Jahre. Ein Bild der Gattin steht da nicht.
Der Arzt öffnet die Tür, zieht den Kopf ein, als er den Raum betritt. Er sieht aus wie die Geier im Dschungelbuch, lang und hager, große Nase, Beatles-Frisur. Eigentlich mag ich es gar nicht, zu Leuten aufschauen zu müssen. Ich habe ihn mir aus dem Telefonbuch ausgesucht, Allgemeinmediziner, weil mir sein Name gefiel. Dr. Brose. Ich stelle mir eine einzelne Brausetablette vor, die in einer Brotdose aufbewahrt wird. Außerdem liegt seine Praxis in der Nähe meiner Wohnung. Normalerweise gehe ich nicht zum Arzt, ich werde einfach nicht krank, da halte ich nichts von.
»Tja«, sagt er, als er mir die Hand gibt.
Beide nehmen wir Platz. Er schaut in seine Kartei. »Herr – äh, Lazyboy. Was kann ich denn für Sie tun? Helfen Sie mir auf die Sprünge ... Wir kennen uns noch nicht, oder?«
Ich schaue auf seinen Pony, seine Prinz-Eisenherz-Frisur. Das ist entweder ganz weit vorn oder sehr, sehr weit zurück. Vermutlich ist es Zweiteres, wenn ich mir den Rest so anschaue. Er hat eine große Nase.
»Ich bin zum ersten Mal da«, sage ich.
»Aha«, sagt er und notiert sich etwas. Dann schaut er mich erwartungsfroh an. Er faltet seine Hände. Ich rutsche auf meinem Stuhl hin und her. Ich hasse es, aus dem Po zu schwitzen, aber es passiert mir immer öfter, gerade bei den angesagten Jeans kommt es besonders oft vor, die sind nichts für den reiferen Männerkörper. »Womit kann ich dienen?«, fragt er. »Wo drückt der Schuh?«
Das habe ich auch lange nicht gehört. Ich schaue auf meine Füße, die in ultrabequemen Sneakern Ferien machen, möchte ich fast sagen. Von Schuh drücken kann nun wirklich keine Rede sein. Ich grinse ihn breit an. Er lächelt irritiert zurück.
»Nun?«, fragt er.
»Ja«, sage ich. »Ich leide unter Blackouts.«
Diese Formulierung habe ich mir zurechtgelegt, weil sie am ehesten zu passen scheint. Und auch sie kleidet nur notdürftig in Worte, was ich erlebe. Ich sage: »Gerade befinde ich mich noch an einem Ort, irgendeinem Ort, und schwupp, schon komme ich plötzlich an einem völlig anderen zu mir, ohne dass ich Erinnerungen hätte, den Weg dorthin zurückgelegt zu haben.«
»Reale Orte«, sage ich, als ich seinen Blick sehe. »Und ich habe nichts dabei getrunken, falls Sie das jetzt denken. Ich stehe perplex da und wundere mich, wie ich hierhergekommen bin. Gestern zum Beispiel wollte ich ein Restaurant am Schulterblatt betreten, und plötzlich stand ich im Gewächshaus des Botanischen Gartens in Klein Flottbek, wie ich nach einer Weile feststellte. Erst dachte ich noch, oh, schick hier, so viele Pflanzen können die doch unmöglich in ein Restaurant stellen.«
»Habe ich Sie richtig verstanden?«, fragt Dr. Brose. »Sie kommen plötzlich irgendwo zu sich und wundern sich, was Sie dort machen?«
»Genau«, sage ich.
»Sie leiden an Erinnerungslücken?«
»Vermutlich«, sage ich. »Sie sind der Fachmann.«
»Haben Sie in letzter Zeit mit besonderem Stress physischer oder psychischer Art zu tun? Leiden Sie unter besonderen Anspannungen oder Belastungen?«
»Eigentlich nicht.«
»Nehmen Sie Drogen?«
»Was genau sind für Sie Drogen?«
»Bewusstseinsverändernde Suchtmittel wie Kokain, Heroin etc., aber auch Alkohol ...«
»Unterliegen Sie eigentlich der ärztlichen Schweigepflicht?«
»Sicherlich.«
»Fällt Cannabis auch unter die Drogen?«
»Selbstverständlich.«
»Dann Alkohol und gelegentlich den guten alten Bruder Joint. Sonst eigentlich nichts mehr, mit Ausnahmen.«
»Was heißt das?«
»Die wilden Jahre sind vorüber.«
»Können Sie das bitte konkreter fassen? Was haben Sie konsumiert? Wie lange liegt der letzte Konsum zurück?«
»Spielt das wirklich eine Rolle?«
»Vermutlich.«
»Ach, ich weiß nicht, Pillen, Koks, Amphetamine, LSD. Und einen Kaktus habe ich mal gegessen, aber das liegt schon eine ganze Weile zurück.«
Ja, Mann, denke ich, der Kaktus. Da könnte ich glatt ins Schwärmen geraten. Obwohl ich damals buchstäblich die Hosen voll hatte. Ende der 90er-Jahre bin ich sommers mit einem Menschen, der sich selbst Birdie nannte, ich nannte ihn Drogen-Bert, und seinem Freund, der aussah wie ein gemästeter Indianerjunge, riesig groß und breit, lange dunkle Haare, markante Nase, im Nordosten Hamburgs am späten Nachmittag in den Wald gefahren, um einen Kaktus zu essen. Wir suchten uns eine nette Lichtung, auf der wir eine Decke ausbreiteten.
Drogen-Bert wohnte damals auf dem Kiez. Heute wohnt er mit Frau und Kind in einem schönen Eigenheim im Speckgürtel der Stadt und ist Chirurg oder etwas ähnlich Schneidiges. Vormittags hatten wir in seiner WG-Küche im fünften Stock eines St.-Pauli-Altbaus gesessen und den meskalinhaltigen San-Pedro-Kaktus, den er per Mailorder bestellt hatte, in einen psychoaktiven Pflanzenmatsch verwandelt. Diesen Kaktus verehren einige Indianervölker als heilige Pflanze, die zu rituellen Zwecken genutzt wird. Wir hatten ihn mit dem Kartoffelschäler von seinen Stacheln befreit und anschließend wie eine Gurke in Stücke geschnitten und durch die Moulinette gedrückt. Die so entstandene Pflanzenpampe wurde gesalzen und gepfeffert und in eine leere Tri-Top-Flasche abgefüllt.
Auf der Lichtung schminkten wir uns gegenseitig mit Karnevalsfarben, wir waren jung, wir wussten es nicht besser, dann zwangen wir uns den bitteren Kaktustrunk hinein. Bald saßen wir mit weit nach innen hallenden Gehirnen da und ließen uns von der weichen Hand des Windes streicheln. Weißbewimperte Gräser wiegten sich im Nachmittagslicht. Anschließend liefen wir ein paar Stunden schwankend durch den Wald, nachdem wir vorher ausführlich gekotzt hatten, sahen Lichter und Farben, zogen uns nackig aus, weil uns plötzlich rasend intensiv danach war, und begegneten in der Dämmerung einem Spaziergänger mit seinem Hund. Heute würde ich viel Geld dafür geben, dessen Wahrnehmungsfilm vor- und zurückspulen zu können. Er geht ahnungslos mit seinem Hund durch den Wald, wie jeden Abend, und trifft plötzlich auf drei groß gewachsene, nackte Spinner mit baumelnden Penissen und grotesk bemalten Gesichtern, die mit tiefschwarzen Pupillen durch den dämmrigen Wald auf ihn zugewankt kommen. Peinlich, würde ich heute sagen, aber damals war es mir egal, ich war ein Lichtschwimmer, ich schwamm durch die warme Abendluft, und alleine schon zu atmen war ein großes Fest. Wir waren die Urhorde auf der Jagd, wir dachten synchrone Gedanken, ich höre mich noch denken, Erdberührer, als ich meine Schuhe auszog und mit nackten Sohlen verzückt über den Waldboden tapste, Erdberührer, es sind keine Füße, es sind Erdberührer, mit ihnen halten wir den Kontakt, durch sie werden wir mit allen wesentlichen Energien versorgt, ich konnte es richtig strömen spüren. Und richtig schlimm wurde es erst, als es finsterste Nacht war im Wald und um uns herum sonderbare Lichter, die wir alle drei sahen, Lichter nicht von dieser Welt, durch den Wald zu spuken begannen.
»Hm«, sage ich. Der Doktor hat mich eine ganze Weile fragend angeschaut.
Mit Drogen-Bert und seinem Freund sehe ich mich auch im Spätsommer gebückt über eine Kuhwiese schleichen, auf der Suche nach diesen speziellen kleinen Pilzen mit dem spitzen Hut, und man muss sich leer und empfangsbereit machen und dem Universum dankbar sein, demütig usw., damit man sie findet, man muss sie innerlich zu sich rufen, aber nicht zu sehr, sagt Bert, und der Bauer auf dem Traktor wundert sich schon gar nicht mehr, weil er das schon kennt, dass irgendwelche spätpubertierenden Spinner aus der Stadt über seine Wiese kreiseln.
Aber das ist lange her, und das kann eigentlich nichts mehr mit dem jetzigen Phänomen zu tun haben, hoffe ich.
»Gekokst habe ich noch mal irgendwann«, sage ich, »und eine Pille genommen vielleicht, eine halbe oder so, Ecstasy, aber das ist schon ewig her, sechs Wochen oder so. Länger.«
»So, so«, sagt Dr. Brose mit gerunzelter Stirn und notiert sich etwas auf einem gelben Karteibogen.
»Eigentlich nehme ich nichts mehr«, sage ich, seufzend, »das ist vorbei, man muss ja auch ein wenig achtgeben auf sich und langsam mal erwachsen werden, nicht wahr?«
Vom Doc habe ich offensichtlich kein Verständnis zu erwarten. Er blickt mit gerunzelter Stirn auf seinen Karteibogen.
»Na ja, ich trinke noch ganz gern, muss ich sagen. Irgendeinen kleinen Rausch braucht ja jeder, oder?«
»Wie viel trinken Sie? Und wie oft?«
Dieser Mensch will es aber wirklich ganz genau wissen. Also erzähle ich ihm detailliert, welche alkoholischen Getränke ich gerne zu mir nehme, wie viel ich davon trinke und wie oft, wo ich sie trinke, mit wem und wozu.
»Hm«, macht der Doktor und wirkt anschließend etwas ratlos. Er kritzelt auf seinem Karteibogen herum, und ich denke nicht, dass es bloß Strichmännchen sind.
»Können Sie mir Ihre aktuellen Erlebnisse bitte noch einmal ganz genau schildern«, sagt er, »so genau, wie es irgend geht, damit ich mir ein stimmiges Bild machen kann?«
Ich nicke und kratze mich am Kopf.
2
Das erste Mal passierte es in meiner Wohnung.
Das ist wie mit den Unfällen, schätze ich, bei denen sich die meisten und die schlimmsten und die dämlichsten sowieso im eigenen Wohnraum ereignen. Sogenannte Haushaltsunfälle. Man will nur die Glühbirne auswechseln und macht den einen unachtsamen Schritt vom Hocker zur Seite direkt in den Rollstuhl.
Ich hatte mir mein Frühstück gemacht, zwei Toastbrote lagen auf dem kleinen Holzbrett, eines mit Schmelzkäse und Himbeermarmelade, eines mit Gemüse-Puten-Wurst. Ich wollte sie zum Verzehr aus der Küche mit ins große Zimmer hinübernehmen, stand aber plötzlich mit dem Frühstücksbrett vor einem mit Birnenornamenten verzierten Spiegel, einem bleigefassten, ganzkörpergroßen Jugendstilspiegel, den ich selbst aus Geschmacksgründen niemals erworben hätte. Ich stand in einem Möbelhaus, wie ein Blick auf die Umgebung, Neonröhren und Furnier, ergab. Hinter mir ein großes Ehebett mit Nachttischen, gebeizte Esche, 399 Euro, las ich, dahinter ähnliche Schlafzimmer, Betten, Tischchen, Schränke, Gänge und einige wenige vormittägliche Möbelhausbesucher, die mich unverhohlen anglotzten, da mir die Hose fehlte. Ich trug nur Boxershorts und mein grau-verwaschenes Iron-Maiden-Schlaf-T-Shirt am Körper. Die Haare verstrubbelt, mein Frühstücksbrett in der Hand, Badelatschen an den Füßen. Die Neonröhren knackten leise wie Frühstücksspeck in einer Pfanne.
Solche Dinge kann man nicht wirklich objektiv einschätzen, fürchte ich, alles, was einen selbst betrifft, blinder Fleck und so weiter, das heißt, ich fragte mich schon, welches Motiv ich haben könnte, halbnackt mit meinem Frühstück in ein Möbelhaus gefahren zu sein, ob ich über Nacht irgendeine Perversion ausgebildet hätte, halbnacktes Frühstücken in der Öffentlichkeit, man weiß ja nie. Und was passiert sein musste, damit ich mich an die Hintergründe nicht erinnerte. Ich war auch ein wenig erschrocken. Und die Toastbrote auf meinem Brett waren noch warm. Aber ich glaube, dass dies einer meiner wenigen Vorzüge als Angehöriger der Spezies Mensch ist, dass ich mich immer relativ schnell mit sich ergebenden Situationen anfreunden kann und bestrebt bin, das Komische daran zu sehen.
Das ist schon seit meiner Kindheit so. Als Sechsjähriger habe ich einmal beim Versteckspielen im Gebüsch in Menschenscheiße gegriffen. Ich wusste sofort, dass es Menschenscheiße, keine Hundescheiße war, ich habe es am Geruch und an der Farbe erkannt, ein ultraintensiv leuchtendes Orangebraun. Erst habe ich geweint, die Hand voll Menschenscheiße, aber dann musste ich lachen, weil es so doof war. Menschenscheiße! Das hat sicherlich etwas mit meiner Geschichte zu tun, mit meinem Herkommen, meiner Familie, meinen Eltern usw. Vieles kommt einem witzig vor, wenn man durch die sauber gekachelte Hölle gegangen ist. Im besten Fall hilft es dabei, eine halbwegs anständige Zeit zu erleben. Man hat eventuell mehr Spaß als die anderen, zumindest rennt man öfter mit einem Grinsen im Gesicht herum. Andererseits führt sie im Negativen auch dazu, diese meine Fähigkeit, dass ich im Leben oftmals nicht besonders wählerisch und ambitioniert bin. Ich lasse die Dinge auf mich zukommen. Ich nehme, was und wie es kommt.
Ich saß mit übereinandergeschlagenen Beinen auf der Kante eines Möbelhausbettes für 399 Euro, auf dem Schoß mein Brettchen. Ich ließ es mir schmecken. Ich lächelte.
Das zweite Mal verließ ich gerade den Supermarkt mit einer Einkaufstüte in der Hand und lächelte dem Verkäufer der Obdachlosenzeitschrift zu. Ich hatte die ganze Hosentasche voller Kleingeld und ließ es aufdringlich klimpern. Ich gebe ihm niemals auch nur einen Cent. Ich grüße ihn immer betont freundlich, immer, denn er steht immer da mit seinen Zeitschriften, und er grüßt mich immer zurück mit seinem zahnlosen Gesicht, ein devotes Nicken, bei dem er mir nicht in die Augen, sondern auf den Boden blickt. Aber Geld bekommt er keins von mir, nie. Und seine doofe Zeitschrift will ich auch nicht, nicht mal geschenkt.
Ich mache also den Schritt durch die Supermarkttür hinaus in die Welt, und im nächsten Moment stehe ich zu Hause im Flur mit der Einkaufstüte in der Hand und fühle mich, als hätte ich mich nachmittags eine Stunde hingelegt und würde nach einem unangenehm tiefen Schlaf erwachen und müsste mich erst wieder in der Welt zurechtfinden.
Ich stellte die Tüte mit den Einkäufen neben mich auf die Holzdielen und schloss die Wohnungstür. Dann wunderte ich mich. Wo war der Weg gewesen? Ich ging im Kopf die Strecke vom Supermarkt zu meiner Wohnung nach. Es fiel mir nicht schwer, den Weg virtuell um alle Sinneseindrücke zu ergänzen, die normalerweise dazugehören, die gurrenden Tauben, der kühle Wind, der Geruch nach Hundekot in meinem Viertel, ab und zu das Tuten eines Schiffshorns, das vom Hafen rüberweht. Ich muss mehr schlafen, sagte ich mir. Es kann doch nicht sein, dass ich nur die Hälfte meines Lebens mitbekomme. In der Schlussbilanz fehlen mir hinterher ganze Jahre. Aber irgendwie wunderte ich mich noch immer nicht über die Maßen. Am Abend zuvor hatte ich getrunken. Und von Zeit zu Zeit überkommen mich seit jeher Anfälle zügelloser Zerstreutheit.
Das nächste Mal empfand ich es schon als beunruhigender. Da ging mir das erste kleine Licht auf. Monika und ich waren im Edelweiß gewesen, einem Laden für wesentlich jüngere Leute als mich. Monika ist vier Jahre jünger als ich. Es war am Wochenende, am Samstag, und Monika war mit ihrer Freundin Laura unterwegs. Sonst ging Monika eigentlich kaum noch weg, in der Woche, ohne Laura, seit sie den Job im Institut angefangen hatte. Ganz im Gegensatz zu mir. Ich hasse das Wochenendpublikum, ich mag das Gefühl in der Woche, wenn nur Menschen ohne feste Ordnung im Leben unterwegs sind, nicht der ganz große Partymob aus den Vorstädten. Ich stand am Rand der Tanzfläche und schaute den beiden zu, wie sie ihre gut trainierten Arme in die Luft hielten. Wie das Scheinwerferlicht auf der Haut glänzte. Ich kam mir vor wie der Großvater der Partybewegung, kommt her, Schulmädchen, und tanzt wild für Opa Lazyboy!, vom Gefühl her hätte ich den halben Laden adoptieren können, ich kam mir fehl am Platze vor, und ich hatte das Gefühl, die kleinen blonden Party-Schulmädchen guckten mitleidig an mir hoch, während ich gierig an ihnen hinunterblickte. Ich hatte ein schwarzes Sweatshirt unter dem Jackett an, auf dem ein Skifahrer in Abfahrtshaltung abgebildet ist, eine Spur zu jugendlich vielleicht. Es lief irgendein Party-House-Unsinn, ich mache mir nicht mehr die Mühe, den Mist auseinanderzuhalten, das Privileg und die Ignoranz des Alters. Ich nuckelte mein aktuelles Lieblingsbier zur Neige, dann kämpfte ich mich durch zuckende Fleischmassen zu meinen beiden tanzenden Grazien vor. Laura kann ich eh nicht leiden, sie ist die größte Spießerzicke auf Erden, von ihrem bebrillten Spasti-Freund Eduardo ganz zu schweigen. Sie mag mich aber auch nicht, und immer, wenn wir uns sehen, lächeln wir einander breit und süß ins Gesicht. Ich drängelte eine Teeniehorde beiseite, damit ich einen besseren Stand hatte, ich brüllte: »Ich geh mal raus, ich muss mal raus hier, frische Luft, bin gleich wieder da!« Ich lächelte und nickte. Ich hatte keine Ahnung, ob sie mich verstanden hatten. Beide tanzten mit geschlossenen Augen, ich meinte bei Monika ein leichtes Nicken wahrzunehmen. Gut sahen sie aus, verrückt und schön, sexy und hingegeben. Ich seufzte im Abdrehen.
Im Vorraum zog ich das Jackett aus, legte es mir über den Unterarm. Dabei schaute ich beiläufig auf meine Armbanduhr.
Dann gab es einen Moment, und im Nachhinein würde ich sagen, es fühlte sich an, als ginge ich durch Gelee, aber das ist eine Rekonstruktion. Als wäre ich kurz, einen schönen, gedehnten Moment lang, zu Gast im transparenten Götterspeisehaus einer Nacktschnecke, in dem die Zeit langsamer tickt, zäh und schwer tropft sie wie dickflüssiger Sirup verhallend ins Nichts. Ich bin von einer Nacktschnecke zum Gelatinetee geladen, wir sitzen auf ihrem unförmigen Wabbelsofa und blicken durch Quallensubstanz hinaus in das triefende, tropfende Leben. Wir seufzen gemeinsam.
Dann stand ich in der Alsterschwimmhalle am Beckenrand.
Ich habe es nicht gleich erkannt. Ich stand am Rand eines nächtlichen 50-Meter-Schwimmbeckens, schwankte leicht hin und her, die Bilder von einem nächtlichen Schwimmbad vor Augen. Schwimmbad, nächtlich, etikettierte mein Gehirn, und wieder fühlte es sich an wie ein Erwachen, alles an mir gähnte herzhaft, und es kam mir absurd vor, dass ich gerade aus einem Club gestiefelt sein sollte, das fühlte sich unendlich weit weg an. Die Oberfläche des Wassers kräuselte sich leicht, reflektierte das Licht der Straßenlaternen von draußen. Mein Blick ging zum 10-Meter-Sprungturm hinüber, wanderte sanft an der hohen, kubistisch anmutenden Deckenkonstruktion entlang, und ich hörte mich denken: Alsterschwimmhalle, im Volksmund: Schwimmoper. Ich war seit Jahren nicht hier gewesen. Ich stand ganz dicht am Beckenrand, das Jackett über dem Arm, schwankte leicht und hatte plötzlich Angst, ins Wasser zu fallen. Ich schaute hinüber zum gegenüberliegenden Beckenrand, Liegen, Kacheln, Holztäfelung, Uhr.
Erst dachte ich wirklich, ich träume, ich liege schon im Bett und träume vor mich hin. Eigentlich hätte ich auf der nächtlichen Straße vor dem Edelweiß stehen sollen, eine Zigarette schnorren, ins gelbe Licht der Tankstelle gegenüber blinzeln, aber jetzt ging ich hier in die Hocke, steckte die rechte Hand ins Wasser und fühlte ganz deutlich das kühle Nass, roch das Chlor. Ich lauschte dem Plätschern, als ich mir etwas Wasser ins Gesicht rieb.
Verrückt, dachte ich. Früher ist man für so was über den Freibadzaun geklettert.
Ich stand einige Minuten einfach nur da und hielt den Atem an. Außer dem Plätschern und dem fernen Summen einer Lüftung konnte ich keine Geräusche hören. Große, nächtliche Schwimmbadstille. Ich blickte mich um, konnte aber nichts Verdächtiges erkennen. Wenn ich schon mal da bin, dachte ich. Ich zog mich aus und legte meine Kleidung auf eine Plastikliege. Dann ließ ich mich ins Wasser gleiten und begann mit leisen, gleichmäßigen Bewegungen zu schwimmen.
Auf dem Heimweg, dem langen Fußweg zurück durch die verlassene Stadt, nachdem ich irgendwann die Notausgangstür geöffnet und damit den Alarm ausgelöst hatte, kam mir das Bild von den beiden Uhren in den Sinn. Meine Armbanduhr im Edelweiß, einen Schritt vor dem Verlassen, 2 Uhr 24. Und die große, runde Schwimmbaduhr in der Alsterschwimmhalle auf der anderen Seite des Beckens, als ich mich umgeblickt hatte. 2 Uhr 26. Zwei Minuten. Und geschätzte sieben Kilometer Luftlinie zwischen beiden Orten. Kein Taxi der Welt schafft mich in zwei Minuten von dort nach hier bis an den Beckenrand.
3
Monika habe ich später erzählt, ich sei plötzlich sehr, sehr müde gewesen, was ja auch der Wahrheit entsprach. Und ich entschuldigte mich mehrfach. Ich sei so müde gewesen, dass der Gedanke, eine SMS zu schreiben, mir unerträgliche Qualen bereitet habe, ich hätte sie im Gewimmel nicht mehr finden können und mich bleischwer nach Hause geschleppt. Es täte mir leid. Von der Alsterschwimmhalle erzählte ich nichts. Erst hatte sie noch ein wenig beleidigt geguckt, aber im Grunde kennt sie es nicht anders von mir. Sie hätten mich noch eine Weile im und um das Edelweiß herum gesucht, sagte sie, aber dann habe sie sich grimmig ihren Teil gedacht.
Ich fragte mich, wie sie reagieren würde, wenn ich erzählte, ich sei nachts noch ein paar Bahnen in der Schwimmoper geschwommen.
Monika. Ich muss kurz innehalten, um ein paar nette Worte über sie zu sagen, damit man nicht denkt, ich wäre zwar mit ihr zusammen, aber ich würde sie nicht mögen. Damit sie nicht schlecht wegkommt in dieser Geschichte. Man könnte den Eindruck erhalten, ich denke lieblos über sie. Und das ist nicht der Fall.
Oder ich sage vielleicht besser erst einmal ein paar Worte zu mir, über mich. Ein paar Worte zu meiner Arbeit. Ich bin Journalist. Das heißt, ich schreibe frei für sogenannte Szenemagazine wie brünett und revolver, dort bin ich sogar Redaktionsmitglied, aber es kommt mir selbst langsam etwas lächerlich vor, es wird immer schwieriger, als 35-Jähriger für Anfang 20-Jährige einen auf hip zu schreiben.
Es gab natürlich Angebote, einen verantwortungsvolleren Job zu übernehmen, Textchef, stellvertretender Chefredakteur, denn schlecht bin ich nicht, wenn ich das in aller Bescheidenheit sagen darf, ich habe eine heiße Feder. Aber das wollte ich nicht, ich habe alles abgelehnt, auch und trotz oder wegen der Bezahlung. Was ich will, ist dauerhaft möglichst wenig Verantwortung im Leben.
Ich bin ganz zufrieden mit dem Status Quo, und dabei meine ich nicht die Rockband, die ich nebenbei bemerkt richtig beschissen finde. Normalerweise stehe ich auf die Art von Musik, AC/DC, Iron Maiden, aber eben nicht Status Quo, dieses Band gewordene Anbiedern an den amerikanischen Massengeschmack.
Ich betrachte mich als altmodisch, ich definiere mich so, es hat etwas mit Identität zu tun, ja, und ich bin stolz darauf, und altmodisch bin ich in der Tat, unbezweifelbar, ohne mich groß anstrengen zu müssen, obwohl ich gewisse Konzessionen an den aktuellen Geschmack mache, taktisch, um mich besser durchzumogeln.
Aber ich stehe zum Beispiel auf Vinyl, ich lehne CDs grundsätzlich und kompromisslos ab, von MP3s ganz zu schweigen, und ich hasse das Internet und meide es weitgehend, ich habe lediglich berufsbedingt damit zu tun. Als DJ habe ich ein paar Jahre im Kanal aufgelegt, in meiner Techno-Phase, aber auch hier: ausschließlich Platten. Pillen und Platten.
Ich bin ein Arschloch, in echt, das muss ich zugeben. Wohlmeinende Menschen, oder Menschen, die etwas von mir brauchen beziehungsweise wollen, sagen: ein charmantes Arschloch. Monika hat mir einmal ein T-Shirt geschenkt, auf dem Charmantes Monster steht. Eine Weile habe ich mit jeder Frau geschlafen, die ich traf, sofern es sich realisieren ließ. Es war ein Konzept, es hatte etwas mit Kunst und Langeweile und mit Gier zu tun. Aber das ist eine Weile her. Und die Beziehung zu Monika hat überlebt. Heute will ich nur noch mit jeder schlafen, ich unternehme keinerlei Anstrengungen mehr. Und ich habe tatsächlich ein Problem damit, zu bleiben, mich auf etwas, auf jemanden dauerhaft einzulassen. Für fünf Minuten: kein Problem, gib mir die passende Droge. Das gebe ich offen zu. Ich bin der Lazyboy. Ich lebe auf Abruf. Aber ich glaube fest daran, dass es nicht meine Schuld ist. Nichts, niemals, nirgendwo. Dazu bin ich viel zu nett und zu naiv. Es ist alles eigentlich nur eben nicht mein Problem. Ich bin da vielleicht etwas ignorant. Ich glaube fest an das Gute in mir. Bis zur Selbstverlogenheit.
Seit acht Jahren bin ich mit Monika zusammen.
Monika hat dicke, dunkle Locken und ist Arzttochter. Sie möchte mehr Verbindlichkeit, möchte mich am liebsten morgen heiraten. Wir wohnen in zwei getrennten Wohnungen, weil ich behaupte, meine Freiheit zu brauchen, in Wirklichkeit habe ich Angst.
Monika ist wahnsinnig hübsch. Sie hat braungrüne Augen. Sie ist enorm ehrgeizig. Im Beruf und auch sonst. Monika ist Meteorologin. Sie arbeitet für das Max-Planck-Institut. Privat schneidet sie gerne Artikel aus der Zeitung aus, wenn sie glaubt, sie könnten mich interessieren. Dann legt sie die Artikel vor mich auf ihren oder meinen Küchentisch, und ich muss sie mir durchlesen, Artikel über die Melancholie von Ameisen zum Beispiel aus dem Wissenschaftsteil, ich weiß nicht, wie sie darauf kommt, so etwas könnte mich interessieren. Sie schneidet sowieso gerne Dinge aus der Zeitung aus, Bilder, Fotos, Artikel. Sie klebt sie in ein Album und notiert mit dem Bleistift in ihrer unleserlichen Vogelschrift ein paar Worte dazu, ihre Art, Tagebuch zu führen. Monika trägt selbst gestrickte Ringelsocken. Monika und ich essen leidenschaftlich gerne, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Wenn ich an Monika und mich denke, sehe ich uns vor ihrem Kühlschrank sitzen und Käsestücke und Schokolade, die sie aus unerfindlichen Gründen im Kühlschrank aufbewahrt, in Serie in uns hineinschieben.
Ich sehe uns nur sehr unscharf miteinander alt werden, dafür umso plastischer miteinander dick werden. Monika ist großzügig, finanziell und Menschen gegenüber. Manchmal ist sie allerdings auch sehr streng, vor allem, was mich anbelangt, das bezieht sich auf meine Art, mich zu kleiden und auf meine Lebensgewohnheiten, aber ich glaube, im Grunde will sie mich gar nicht anders haben, im Grunde will sie, dass ich mich empöre, dass ich mich wehre, wenn ich sie als übergriffig empfinde, wenn sie mich mit ihren schnippischen Meinungen konfrontiert, dass ich sage: so nicht und ein beleidigtes Gesicht mache und trotzdem mit meinen sogenannten Freunden trinken gehe.
Manchmal, abends, wenn ich bei ihr bin, sitze ich einfach nur da und sehe zu ihr hinüber, während sie Fernsehen guckt auf dem Sofa und ich auf dem 50er-Jahre-Cocktailsessel vorgebe, etwas zu lesen, irgendein stupides Magazin. Ich schaue sie an, und das reicht mir manchmal schon als perfekte Abendgestaltung.
In den folgenden Tagen passierte es mehrere Male. Einmal kam ich in einem Parkhaus am Stadtrand zu mir, in dem ich noch nie in meinem Leben gewesen bin. Ich öffnete eine Tür und stand in einem Paradies aus grauem Beton, von einer sehr gelben Neonleuchte belichtet, gelbe Fahrbahnmarkierungen auf dem Boden, schwarze Reifenspuren.
Ich versuchte, schnell zurück durch den Spalt zu schlüpfen, aber hinter der Tür befand sich nur noch Treppenhaus. Ich kam viel zu spät in die Redaktion, aber das kennen die da schon.
Das andere Mal stand ich plötzlich, ich hatte auf dem Weg zur Arbeit rasch Wurst einkaufen wollen, in der Schmetterlingsfarm in Aumühle, das fand ich schön, poetisch-zauberisch und ohne Eintritt zu bezahlen. Eben noch beim Bedienen der Ladentür der satte Geruch von Blut und Gewürzen, und plötzlich Sandwege mit Pflanzenwuchs an den Seiten unter einem Glasdach, Holzbrücken über pittoresk angelegte künstliche Wasserwege, und überall in der Luft kleine, große, dicke, dünne, bunte und schwarz-weiße, zart flatternde Falter. Ich schwenkte mein Einkaufsnetz wie einen Schmetterlingskescher.
»Was ist mit dir los?«, fragte mich mein Chefredakteur, als ich endlich im Büro angekommen war. »Du siehst durch den Wind aus. Ich kenne das im Grunde ja von dir, dass du in einem gewissen Rahmen unzuverlässig bist. Aber jetzt treibst du es zu weit. Man kann sich ja gar nicht mehr auf dich verlassen.«
»Ich bin müde«, sagte ich. »Ich bin urlaubsreif. Ich fühle mich nicht gut.«
»Dann geh zum Arzt«, sagte er und ließ mich stehen, direkt vor der Scheibe zum Großraumbüro, wo die anderen gafften.
4
»Ich weiß nicht, ob es Ihnen schon aufgefallen ist«, sagt Dr. Brose und reibt dabei einen gelb-orangefarbenen Bleistift an seiner Ohrmuschel auf und ab, was mich ablenkt und irritiert. Er hat wirklich dumbohaft große Ohren.
»Ihr eigenartiger Gedächtnissprung oder wie auch immer wir es nennen wollen, scheint immer dann einzutreten, wenn Sie im Begriff sind, den Raum zu wechseln. Ist Ihnen das so weit schon aufgefallen?«
»Nein«, sage ich verblüfft. Es ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Wie gut, dass es Mediziner gibt.
»Wenn Sie einen Raum verlassen«, sagt er, »erleben Sie anscheinend manchmal und wiederholt eine Art Bewusstseinstrübung. Vielleicht fallen Sie beim Verlassen in eine Art Trance, von der wir noch nicht wissen, was sie auslöst. Aber das ist nur eine Arbeitshypothese.«
»Jetzt, wo Sie es sagen«, sage ich.
Tatsächlich ist es mir bislang überhaupt nicht aufgefallen. Aber jetzt erscheint es mir augenfällig, dass meine sonderbaren Transfers von Ort zu Ort immer dann eintreten, wenn ich den Raum wechsele, wenn ich eine Tür durchschreite.
Wie ferngesteuert sage ich: »Wenn ich mich an diese Ortswechsel erinnere, dann waren sie stets mit dem Durchschreiten einer Tür verbunden. Ich trete durch eine Tür, allerdings komme ich nicht wie gewünscht im Nebenraum an, sondern ganz woanders. Ich scheine ein Problem mit Türen zu haben. Es sind die Türen. Was denken Sie darüber? Sie sind mein Arzt. Ich denke, Sie sollten darüber Bescheid wissen. Was sagen Sie?«
Dr. Brose sieht etwas eingeschüchtert aus.
»Türen«, sagt er. »Ach so. Nun. Ich fürchte, dass ich auf diesem Gebiet kein Fachmann bin. Vermutlich muss ich Sie zu einem Spezialisten überweisen.«
»Was für ein Spezialist?«, frage ich.
»Verstehen Sie mich nicht falsch«, er guckt mich entschuldigend aus runden Augen an, »ich bin Experte für das Körperliche – und hier scheint es sich doch mehr um ein geistig-seelisches Phänomen zu handeln, wenn Sie verstehen, was ich meine.«
»Nicht direkt«, sage ich.
Dr. Brose schaut auf seine Unterlagen hinab, vermeidet den direkten Blickkontakt.
»Ich denke, ich sollte Sie zu einem Neurologen oder Psychiater überweisen. Oder einem Psychologen.« Er wirft mir einen raschen Blick zu, schreibt dann weiter auf seinem Block herum.
»Natürlich müsste man von vorneherein ausschließen, dass es nicht doch einen körperlichen Befund gibt, das ist sicherlich der nächste Schritt. Verstehen Sie mich nicht falsch«, sagt er, »ich finde Ihren Fall absolut faszinierend.«
Ich sage nichts, ich schrumpfe still, ich schweige.
»Wir machen als Nächstes eine CT, wir schieben Sie in die Röhre, dann sehen wir sicherlich klarer. Bitte lassen Sie sich vorne einen neuen Termin geben, ja?«
»Sie sind der Boss«, sage ich mit Piepsstimme und erhebe mich in Zwergengröße.
Auf dem Weg durch den Flur zum Empfang überdenke ich das Gesagte: Türen. Am Empfangstresen vereinbare ich bei der serbokroatischen Praxishilfe mit dem harten Akzent, den ich automatisch imitiere, das ist so eine Macke von mir, die einige Menschen als unhöflich empfinden, einen Folgetermin. Ich frage mich, ob es bei jeder Tür aufgetreten ist. Ob ich ein generelles Türenproblem habe. Der Doktor hat mich an eine Röntgenpraxis überwiesen und mir ein angstlösendes Medikament verschrieben, wobei ich vorher nicht den Eindruck hatte, dass Angst mein Hauptproblem darstellte, vorher nicht, jetzt ja. Ich bin gespannt, ob es knallt, das Medikament. Außerdem werde ich mich in einer fremden Praxis einer Computertomografie unterziehen müssen, damit er weiß, ob mit meinem Gehirn alles okay ist. Mir fallen, wenn ich überlege, genug Türen ein, die ich problemlos benutzt habe. Überhaupt Wahnsinn, wenn man sich klarmacht, durch wie viele Türen man jeden Tag so geht. Zum Beispiel diese hier. Ich öffne die Tür des Gebäudes, in dem sich die Arztpraxis befindet. Draußen scheint die Sonne. Durch das Türglas sehe ich einen Linienbus auf der vierspurigen Straße vorbeifahren.
5
Erst weiß ich nicht, wo ich mich befinde. Das ist ärgerlich, denn Monika wartet in ihrer Wohnung darauf, dass ich ihr vom Arztbesuch berichte. Ich habe ihr gesagt, dass ich zum Arzt ginge, weil ich mich in letzter Zeit besonders zerstreut fühlte, ich hätte manchmal regelrechte Blackouts, Gedächtnislücken, ob es ihr aufgefallen sei?
Wir haben abgemacht, dass ich anschließend direkt zu ihr fahre. Jetzt aber stehe ich am Ufer eines Flusses, ein großer Fluss, graugrünes Wasser. Genauer gesagt stehe ich am Fuß einer reich verzierten Fußgängerbrücke, Barock, grauer, alter Stein, Statuetten auf den Balustraden. Am gegenüberliegenden Ufer hoch droben thront eine stattliche Burg auf einem Hügel. Auf der Flanke des Hügels stehen Weinstöcke Spalier. Es sieht irgendwie süddeutsch aus. Ich drehe mich um und stelle fest, dass sich zwei Schritte hinter mir die Tür eines Andenkenladens befindet, wie praktisch.
Ich klaube mein Handy aus der Tasche. »Monika«, sage ich, »ich fürchte, ich schaffe es doch nicht. Ich habe gerade noch von Marcel einen ganz eiligen Auftrag bekommen. Ja, doof, tut mir wirklich leid. Hast du heute Abend schon etwas vor? Ich koche etwas für dich, okay? Hm. Hm. Ach so, ja, der konnte auch noch nicht so richtig sagen, was mit mir los ist. Ich muss noch ein paar Untersuchungen machen lassen usw. Erzähl ich dir alles heute Abend in Ruhe, okay?«
Dann rufe ich in der Redaktion an und sage, dass ich heute nicht komme, weil der Arzt mich krankgeschrieben habe.
Die Sonne scheint, die Burg auf dem Hügel sieht sehr einladend aus.
Am anderen Ende der Brücke ist ein Restaurant mit einer schönen Holzterrasse oberhalb eines alten Wehrs. Ich suche mir einen Platz in der Sonne. Ich werde von einer mittelalterlichen Frau mit weißer Schürze und einem faltigen, grauen Rock über äußerst stramm aussehenden, abgekämpften, harten Waden und Birkenstocks an den tennisbesockten Füßen bedient. Würde man diese Waden verspeisen wollen, bräuchte man sicherlich gutes Besteck und einwandfreie Zähne, so zäh sind sie vom jahrelangen Herumlaufen mit schweren Tabletts geworden.
»Entschuldigen Sie«, sage ich. »Wo sind wir?«
»Wie meinen Sie das?«, fragt sie ohne Gesichtsausdruck.
»Die Stadt«, sage ich, »in der wir uns befinden, wie heißt das alles hier?«
Sie guckt mich an, nichts regt sich in ihrem Gesicht. »Würzburg«, sagt sie.
Ein Lächeln geht auf meinem Gesicht auf wie Urlaubssonne, ich kann es warm und deutlich spüren. Ich meine mich zu erinnern, dass Würzburg an einer ICE-Strecke liegt. Ich kann mir also ordentlich Zeit lassen, alles angucken.
»Toll«, sage ich. »War ich noch nie, in Würzburg. Was isst man denn hier so? Gibt es eine Spezialität?«
»Blaue Zipfel«, sagt die abgezehrte Frau ohne Begeisterung.
»Toll«, sage ich, »nehme ich. Wenn ich schon mal da bin.«
Beiläufig muss ich an Schlumpfhausen denken. Ich schaue der Frau nach, ihre Waden zucken beim Gehen links und rechts, als würden sie mir zuwinken.
Etwas später stellt sie die Blauen Zipfel in einem Teller Brühe vor mich hin. Diese stellen sich als in Essig gekochte Würste heraus. Na ja.
Trotzdem sitze ich mit dem zufriedensten Lächeln der Welt auf der Terrasse oberhalb des Flusses, der jetzt im Sonnenlicht tiefbraun und goldgesprenkelt vor sich hin funkelt. Ich äuge zur Burg hoch. Das Sonnenlicht gleißt auf den alten Schindeln. Still für mich formuliere ich einen erhabenen Gedanken. Innerlich fülle ich mich mit dem goldenen Licht der Zufriedenheit, als ich meinen schönen, gehaltvollen Gedanken denke. Ich denke: Es intensiviert den Aufenthalt an einem Ort, wenn man sich klarmacht, in jedem Augenblick auch woanders sein zu können, durch irgendeine Tür jäh aus dieser Gegenwart in die nächste gerissen zu werden, dass jegliche Anwesenheit schlagartig beendet sein kann.
Für zwei gekochte Blaue Zipfel muss ich 14 Euro bezahlen, das dämpft mein Gefühl von Erhabenheit empfindlich.
Als ich später den Prachtbau der berühmten Würzburger Residenz aus dem 18. Jahrhundert betrete, ein weltbekanntes Fresko von Tintoretto oder so befindet sich darin, halte ich vor der ersten Tür sehr bewusst inne, halte mich am Türrahmen fest und schaue mich noch einmal um. Ich mustere den Parkplatzwächter mit einer nicht gekannten Intensität, er steht keine zwanzig Schritte entfernt, und mir fällt auf, dass sein eines Auge ein künstliches sein muss, es bewegt sich nicht synchron mit dem anderen. Der Himmel trägt eine zerzauste Frisur, dunkelgraue Strähnen hängen wild von einer Seite über die andere gekämmt. Ein kleiner Hund mit rostbraunem Fell macht eine seitliche Bewegung, die aussieht, als habe er sie aus einem Yogalehrbuch für Hunde abgeschaut.
»Nehmen wir einmal an«, sage ich abends zu Monika, wir sitzen an ihrem Küchentisch, ich schäle eine Karotte mit langsamen, tief schürfenden Schnitten, die kaum noch Karotte übrig lassen, »ich würde dir erzählen, dass ich zuletzt sonderbare Erfahrungen mit Türen gemacht hätte, dergestalt, dass mich so manche Tür nicht dort ausspuckt und dorthin befördert, wo es mich eigentlich hinzog, in den Nebenraum, sondern an ganz andere Orte, Plätze. Dass mich Türen unvermittelt und auf wunderbare Weise durch die Gegend teleportieren, beamen quasi.«
»Ja?«, fragt Monika und liest weiter in ihrem Kochbuch, in dem das Rezept dessen steht, was ich eigentlich zubereiten wollte, das wir nun gemeinsam kochen werden, wie immer, wobei sie den Löwinnenanteil der Arbeit erledigen wird und ich nur die Zugehtätigkeiten, wie bei den echten Löwen.
»Nehmen wir also mal an, ich erzählte dir so etwas, würdest du mir Glauben schenken?«
»Nö«, sagt Monika lesend.
»Und was würdest du darüber denken, wenn ich so etwas erzählte?«
»Dass du eine Ausrede für irgendeines deiner Versäumnisse und üblichen Schlamassel gesucht und gefunden hättest, charmant, aber völlig überzogen und unglaubwürdig. Typisch du eben. Niedlich auf eine Art. Aber ich wäre genervt, weil du mir nicht zutrautest, mit der Wahrheit umzugehen.«
»Oh«, sage ich und schnitze, aber da ist keine Karotte mehr zwischen meinen Fingern, ich schnitze an meiner Handfläche herum, was wehtut.
»Was willst du mir denn jetzt eigentlich beichten?«, fragt sie.
»Nichts«, beeile ich mich zu sagen und fische mir eine weitere Karotte aus dem Netz.
»Irgendwie mag ich dich ja schon«, sagt Monika ziemlich unvermittelt, für unsere Verhältnisse eine gewichtige Liebeserklärung.
»Hm«, sage ich und lächele, was sie nicht sehen kann, da ich mich zu den Kacheln gedreht habe, alte Kacheln, auf denen immer ein holländischer Junge ein holländisches Mädchen mit Haube an der Hand hält. Ich weiß, dass ich etwas anderes sagen könnte, es würde sogar stimmen. Ich wende mich Monika zu und beobachte sie, wie sie einfach weitermacht und sich so gar nicht über meine Antwort wundert oder ärgert. Monika ist toll. Ich muss daran denken, wie sie mit ihren Freundinnen telefoniert, manchmal belausche ich sie dabei. Sie hat dann eine fast schon irrwitzig weiche Stimme, stundenlang hört sie zu, so ausdauernd, wie ich es niemals fertigbringen würde. Ich bin dann immer ganz eifersüchtig, weil die so viel Zuneigung und Aufmerksamkeit von ihr erfahren. Ich glaube, Monika ist eine der besten Freundinnen, die man überhaupt haben kann, ich sollte mal Glückwunschkarten verschicken. Sie ist mutmaßlich der liebevollste, treuste Mensch, den ich kenne. Ich denke, dass es ein Glück ist, mit Monika befreundet zu sein, und dass ich ja auch an diesem Glück Anteil habe, denn irgendwie sind wir ja auch befreundet. Ich hoffe nur, dass sie das ähnlich sieht.
6
Mein Telefon klingelt, mein Handy. Ich bin auf dem Weg zum Arzt, Untersuchungsergebnisse abholen. Ich gehe neuerdings zu Fuß, das dauert zwar länger, ist aber auch gesünder, und vor allem meide ich so ein paar Türen, die mich an unvorhergesehene Plätze führen können. Ich vermeide die Autotür oder die Tür des Busses und der U-Bahn. Mein neues Motto: Risiken minimieren, Türen vermeiden. Das ist ohnehin nicht einfach, alleine im Haushalt ist man dem Schrecken ungezählter Türen ausgesetzt. Dort achte ich zumindest darauf, dass ich keine Tür mehr schließe. Man müsste mal einen Horrorfilm drehen, in dem mutierte Horrortüren die Hauptrolle spielen. Das Flügeltürenmassaker, Teil 1-4.
»Hallo?«, sage ich.
»Hallo fauler Junge, hier ist Mirko. Wo steckst du?«
»Ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Wo steckst du denn?«
»Ich bin in Portland«, sagt Mirko.
»Aha, was machst du in Portland?«
»Ich nehme ein paar Stücke auf mit Dwarren Zee, kennst du vielleicht.«
»Nee, nicht wirklich.«
»Der hat damals bei den Fugees mit am Pult gestanden, ganz interessanter Mann, könnte sich lohnen.«
»Wow«, sage ich.
Mirko ist Musikproduzent. Seit Kurzem läuft es sogar ganz gut bei ihm, wobei gut ein relativer Begriff ist. Finanziell läuft es nicht schlecht, meine ich, seit er den letzten Hit von DJ Petzi produziert hat. Geschmacklich lässt sich darüber streiten. Du bist mein Edelweiß. Er ist selbst nicht gerade stolz darauf. Aber er hat auch schon das neue Album von Robert König abgemischt und eine Weile Geld damit verdient, dass er altbekannte Schlager mit Discobeats unterlegte. Gruselig, aber irgendwie auch mutig. Und er ist noch nicht mal zynisch dabei geworden. Er hat sich so eine sportliche Grundhaltung bewahrt, die ich aufrichtig bewundere. Ich reiche hier die Kübel mit Scheiße durch und quirle selber ordentlich darin herum, dafür darf ich dann aber auch die eine Perle behalten, die in jedem zehnten Eimer vorbeischwimmt.
Für mich wäre das nichts. Aber auf meine Art mache ich vermutlich genau das Gleiche. Ständig ist er jetzt in der Welt unterwegs, nimmt hier etwas auf und trifft sich dort mit ein paar Leuten zum Meeting und wieder woanders mit anderen Freaks, um ein paar Lieder zu schreiben. London, Brüssel, Stockholm, Bahamas. Früher haben wir gemeinsam Musik in einer Band gemacht, ich Bass, er Schlagzeug, aber das ist lange her. Und zusammen in der Schule waren wir auch, vor endlanger Zeit, wie wir Berufsjugendlichen sagen.
»Ich wollte dich fragen«, sagt er, »ob wir am Wochenende Joggen wollen. Um die Alster. Ich bin am Samstag in der Stadt.«
»Gute Idee«, sage ich, »ja, klar, wird mir guttun. Melde dich doch noch mal, wenn du zurück bist, dann verabreden wir uns spontan. Ich halte mir Samstag auf jeden Fall frei.«
»Ja, klar«, sagt er. »Mach ich.«
Es klappt sowieso nicht, das wissen wir beide. Wir waren mal um die Alster joggen, aber das ist Jahre her. Wir reden nach wie vor gerne darüber. Und es für die nächsten Tage zu planen, fühlt sich fast schon an wie Sport.
Ich frage mich, wie er es fertigbekommt, eine Beziehung zu führen, so viel, wie er unterwegs ist.
Umständlich zwänge ich das Handy zurück in meine Hosentasche. Ich bin nicht nur Fußgänger geworden, ich trage auch beide Arme in Schlingen, damit es aussieht, als hätte ich eine gravierende Armverletzung. Seit einer Weile versuche ich, Türensprünge zu verhindern, indem ich geschlossene Türen meide. Indem ich die Türen nicht mehr öffne. Ich hatte das Gefühl, dass die Gefahr für mich vor allem dann besteht, wenn ich selbst die Tür geöffnet habe, dass bereits geöffnete Türen risikoärmer sind. Ein Aberglaube vielleicht, aber bislang fahre ich ganz gut damit. Die Leute gucken allerdings pikiert, wenn ich an eine Tür geklopft habe und, nachdem sie Herein! gerufen haben, meinerseits rufe: Hallo? Entschuldigung? Würde es Ihnen vielleicht etwas ausmachen, diese Tür für mich zu öffnen?
Sie öffnen die Tür, und dann steht statt eines Behinderten ein völlig unversehrter Mensch da. Aus diesem Grund also die Arme in Schlaufen.
Es gibt einfach zu viele Türen in der Welt. Glastüren, Schiebetüren, Fahrstuhltüren, Drehtüren. Ich mag gar nicht an die Leute denken, die mich durch eine Glastür auf sich zukommen sehen, und plötzlich bin ich verschwunden. Ich habe schon überlegt, ob ich eine Weile ins Zelt ziehe.
Das Zelt würde ich auf einer Verkehrsinsel aufbauen. Wenn schon, denn schon. Ich wohnte inmitten einer sechsspurigen Kreuzung, wo sich zwei riesige Ausfallstraßen träfen, in der Mitte, auf einer gar nicht mal so kleinen Fläche Gras, von einigen Birken bewacht. Ich lebte in der stummen Gesellschaft etlicher Kaninchen, die sich in der Dämmerung aus dem Schutz der Büsche wagten. Ein kleines Idyll, ein Naturparadies, das sich in der Abenddämmerung aus dem Nebel des Smog hebt.
Morgens würde ich über die Druckknopfampel zur Shell-Tankstelle hinüberschlurfen, um mich dort unter der Duldung meines minderbemittelten Tankstellenangestelltenfreundes Bernd zu waschen, mir die Zähne zu putzen und Wasser für meinen Espresso zu holen. Den Espresso bereitete ich auf dem Gaskocher vor meinem Zelteingang hockend zu. Ich würde zufrieden lächelnd dem Berufsverkehr zusehen, wie er sich an mir vorbeischiebt, die ganzen angespannten Gesichter hinter den Lenkrädern, es dämmerte blaugrau, die roten Bremsleuchten leuchteten romantisch, während ich an meinem Shell-Tankstellen-Brötchen knabberte.
»Was hat denn der Arzt gesagt?«, fragt Monika.
Wir sitzen gemeinsam auf ihrem blauen Samtsofa und sehen uns eine Folge der Gilmore Girls an, ihre Lieblingsserie. Ich schalte auf Durchzug, und sie leuchtet dabei irgendwie von innen.
»Der Doktor hat gesagt, er könne nichts feststellen, körperlich fehle mir nichts.«
Monika guckt mich kurz auffordernd an, ihre prachtvollen Locken wippen, sie nickt. Aber ich bin nicht willens, mehr preiszugeben.
Der Doktor hat sich nämlich die Untersuchungsergebnisse nur flüchtig angesehen und dann gesagt, dass ich selbstverständlich gerne den Rat anderer Ärzte, Spezialisten, einholen dürfe, wenn ich dies wünsche. Er empfehle mir allerdings eindringlich, jetzt von einer anderen Seite an das Problem heranzugehen.
Er wolle mir konkret vorschlagen, eine Psychologin zu konsultieren. Er denke dabei an eine junge Psychotherapeutin, sehr gut auf ihrem Gebiet, er habe nur das Beste von ihr gehört, an die er mich gerne überweisen würde.
Ich hatte ihn eine Weile schweigend angesehen und dann einmal kurz genickt. So findet man sich in sein Schicksal. Gucken. Nicken. Er denkt, ich hab sie nicht mehr alle. Dass ich plemplem bin. Na gut.
Ich denke, gut, es ist Monika, meine Partnerin, der Mensch, dem ich die größte Nähe zubillige. Ich sollte sie schon ins Vertrauen ziehen, ein paar Dinge sollte sie schon wissen.
Ich sage: »Er will mich zum Psychologen schicken.«
»Echt?«, fragt sie.
»Ja«, sage ich.
Sie nickt mit grimmigem Gesichtsausdruck. Gut. Das passt anscheinend. Prima.
»Findest du wirklich, dass das angebracht ist? Hast du den Eindruck, ich muss zum Psychologen?«
»Ohne dich verletzen zu wollen«, sie lächelt jetzt sanft, »unbedingt. Du hast echt einen Knall, aber dafür mag ich dich ja so.«
Sie lehnt sich zu mir hinüber und haucht mir einen Kuss auf die Nasenspitze.
»Hm«, brumme ich.
7
Den folgenden Tag verbringe ich vor dem Rechner. Ich recherchiere. Das kann man auch von zu Hause aus tun. Seit das Internet erfunden wurde, braucht man als Journalist im Grunde das Haus nicht mehr zu verlassen, das ist immerhin ein nützlicher Effekt dieser lästigen Erfindung. Zuerst gebe ich im Netz den Suchbegriff Türen ein. Danach Wurmloch, Teleportation, Parawissenschaften und Esoterik. Schwarze Magie. Das aber führt mich ganz woanders hin.
Was in Wikipedia über Türen zu erfahren ist, habe ich durchaus schon vorher gewusst, auch wenn ich nicht in der Lage gewesen wäre, es mit eigenen Worten so präzise auszudrücken, und es interessiert mich nur bedingt: Eine Tür ist eine Einrichtung zum Schließen einer Öffnung in einer Wand. Die Tür erlaubt das Abschließen von Räumen gegen andere Räume oder den Außenbereich bei gleichzeitiger Durchgangsmöglichkeit. Eine Tür besteht aus einem beweglichen Flügel, dem Türblatt, das entweder an zwei oder mehr Scharnieren, den Türbändern, am Türrahmen, der Zarge, auch Türfutter genannt, befestigt ist, oder, bei einer Schiebetür, durch eine Laufschiene oben oder unten in der Führung gehalten wird.
Zu sonderbaren Türentransfers durch den gekrümmten Raum finde ich keine Einträge.
Ich wähle die Telefonnummer von Portax, dem Türenspezialisten. Einfach nur so, vielleicht um Spaß zu haben. Ich weiß, dass es Quatsch ist. Aber es tut bestimmt gut, mit einem Spezialisten zu reden.
Auf der Website habe ich gelesen, dass es für mein Türenproblem ganz sicher eine Portax-Lösung gebe. Und dass sich ganz in meiner Nähe einer von 550 Portax-Fachbetrieben befinde. Irgendwie beruhigend.
Am Telefon meldet sich eine weibliche Stimme. Ich sage ihr, dass ich ein Türenproblem hätte und gerne mit einem Spezialisten darüber spräche. Worum es denn genau gehe, will sie wissen, woraufhin ich ihr bescheide, das lieber gleich mit einem Fachmann spezifizieren zu wollen. Etwas beleidigt bittet sie mich, am Apparat zu bleiben. Es knackt und knarzt, als sie mich verbindet, dann ist eine Weile ein Tonband zu hören, The Doors, Break on through to the other Side.
Ein Herr Wischnewski fragt mich unwirsch, was er für mich tun könne. Ich teile auch ihm mit, dass ich unter einem Türenproblem leide.
»Welche Tür?«, fragt er.
»Viele Türen«, sage ich.
»Tür ist nicht gleich Tür«, lässt er mich wissen, und das ist ja schon einmal eine interessante Information. Ich weiß allerdings nicht, ob sie mir im Alltag von Nutzen sein wird.
»Hm«, sage ich, »schwierig zu sagen. Beispielsweise meine Küchentür, da ist es vorgekommen.«
»Alte Tür?«, fragt er.
Und ich bejahe dies, denn ich gehe davon aus, dass es sich bei der Tür meiner Altbauwohnungsküche um eine solche handeln muss. Außerdem fühle ich mich auf eine seltsame Art und Weise von der Bezeichnung gemeint und angesprochen. Irgendwie bin ja auch ich so eine in die Jahre und etwas aus der Mode gekommene, bedauernswerte Alte Tür, die wacker versucht, weiterhin gewissenhaft ihren Dienst zu tun, auf und zu, klippklapp.
Er erzählt mir, dass sich hinter dem unansehnlichen Äußeren alter Türen in der Regel ein vollkommen intakter Kern verberge. Bei diesen Worten entwickelt seine Stimme eine gewisse Wärme, und ich sehe ihn vor mir in seinem Blaumann mit einem Bleistift in der Brusttasche, Brille auf der Nasenspitze, graue, etwas in Unordnung geratene Haare, wache, graugrüne Augen, die Zungenspitze zwischen die Lippen geklemmt, wenn er in eine etwas frickelige Arbeit versunken ist, voller Anteilnahme und Wärme den Türen gegenüber, etwas unwirsch gegenüber dem Türenbenutzer Mensch, der diesem Gebrauchsmöbel allzu oft nicht den nötigen Respekt im Alltag entgegenbringt und die Tür beispielsweise zuschmeißt, anstatt das Türblatt liebevoll in den Rahmen zu drücken.
»Er besteht entweder aus Massivholz«, sagt er, »typisch für alte Türen, die vom Schreiner auf Maß angefertigt wurden, oder aus Wabenkonstruktionen, wenn es sich um alte Normtüren handelt. Auf jeden Fall lohnt es sich, den intakten Kern zu erhalten.«
»Das höre ich gerne«, sage ich. Ein warmes, segensreiches Gefühl breitet sich im alten Kern meiner Brust aus.