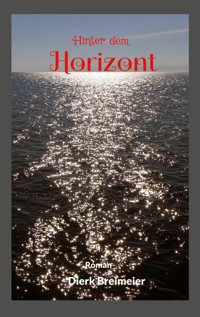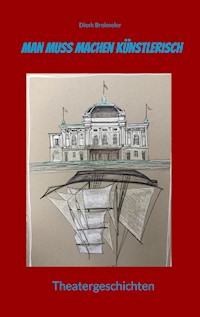Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von den Wogen des Meeres in die Tiefen der Liebe – ein Roman über die Liebe und das wahre Leben. Stephen Tremaine, ein Seefahrer aus Cornwall, entkommt knapp einem tödlichen Sturm und flüchtet vor einer enttäuschten Liebe zurück aufs Meer. In Trinidad begegnet er in einem schillernden Etablissement der käuflichen Liebe einer Frau, die sein Leben für immer verändern wird. Doch bald erkennt er, dass er einem unerreichbaren Traum nachjagt. Unverhofft wird Stephen in ein neues Leben geworfen, das ihn bis in die Slums von Port of Spain führt. Ein Buch über Illusionen und die Liebe und nicht zuletzt über das Ankommen, in welch vielerlei Sinn auch immer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ferntrost
Dir reißt das Herz
Und du reist dahin
Weg von deinem Schmerz
Zu suchfinden neuen Sinn.
Wo mag der liegen
Wo mag der sein?
Tauch achtsam ein
Und du wirst es spüren –
Dein neu … Daheim.
Carolin Kretzinger
Inhalt:
Erstes Buch: Stephen
Der Hurricane
Stephen Tremaine
Trinidad
Die Liebe der Matrosen
Der Ausflug zur Maracas Bay
Ein kurzer Besuch in Mevagissey
„Carnival“ in Port of Spain
Ein neues Zuhause
Am Ölberg
Familienleben
In den Slums
Ein schwerer Gang
Das Ende der Talsohle
Besuch an Bord
Ein neuer Lebensabschnitt
Abschied
Zweites Buch: Maria
Die Überfahrt
England
Ein denkwürdiges Aufeinandertreffen
Mevagissey
Ein Umzug
In Portsmouth
Wieder allein
Die Seemannsbraut
Das Geburtstagsgeschenk
Epilog
Erstes Buch
Stephen
Der Hurricane
Stephen Tremaine stand am Ruder, während sich die „Glenfalloch“ gegen einen steifen Wind aus West-Süd-West durch die aufgebrachte See des Südatlantik kämpfte. Gerade eben rollte wieder eine bedrohlich wirkende Welle von wenigstens acht Metern Höhe auf sie zu. In dem Augenblick, da sie schräg von Steuerbord auf den Steven traf, brach sie sich in einer gewaltigen Schaumkrone und schlug mit all ihrer Kraft über das Vorderschiff hinweg. Die Gischt spritzte hoch bis an die Brücke. Unwillig wich das Schiff mit seinem Steven dem Schlag der Welle ein Stück nach Backbord aus, streckte ihren Bug aber unmittelbar darauf kampfeslustig wieder in den Wind. Das gesamte Vorschiff wurde von einer weiteren der heranrollenden Wellen meterweit in die Höhe gehoben, um gleich darauf mit voller Wucht erneut in das darauffolgende Wellental zu fallen.
„Stütz Ruder!“, kommandierte der Zweite Offizier, der rechts nahe am Brückenfenster stand.
„Aye, aye, Sir“, gab Stephen zurück und blickte grinsend zu seinem Zweiten hinüber.
Dieser grinste zurück.
Stephen hatte natürlich längst reagiert und beide wussten es. Es war ein Ritual, das sie hier zelebrierten. Stephen spürte die See in seinem großen Steuerrad und nahm sie gefühlsmäßig in sich auf. Niemand sonst von den Matrosen an Bord war derartig mit der See verwachsen wie Stephen Tremaine und niemand wusste dies besser als Matthew Longfellow, der Zweite Offizier. Stephen Tremaine war ein Kind der See. Seit seinem sechsten Lebensjahr war er auf dem Kutter seines Vaters mit hinausgefahren. Branok Tremaine galt als der kühnste Fischer in Mevagissey.
Branok Tremaine fischte in der Biskaya. Keiner fuhr so weit hinaus wie er.
„Ein hübsches Lüftchen, Steve“, wandte sich Longfellow jetzt an jenen.
Dieser grunzte nur und starrte weiter konzentriert auf den Steven des Schiffes. Die „Glenfalloch“ war Stephens erstes Kommando, nachdem er etwa sechs Monate zuvor, zusammen mit vier weiteren Besatzungsmitgliedern, von philippinischen Fischern von einem kieloben im Pazifik treibenden Rettungsboot gezogen worden war. Sie waren die einzigen Überlebenden der „Ajax“ gewesen, nachdem diese in einem Hurricane vor Manila gesunken war.
***
Es geschah auf Stephens fünfter Ostasienfahrt, auf der „Ajax“.
Sie war ein schönes stolzes Schiff, mit ihrem hohen runden Schornstein, rot und mit einem schwarzen Streifen am oberen Rand. Diesen Schiffen der „E&O Line“ begegnete man seinerzeit sehr häufig in den indischen und ostasiatischen Seegebieten. Die „Ajax“ war, von Colombo kommend, auf dem Weg nach Manila auf den Philippinen.
Dieses Mal aber sollte alles anders kommen.
Zwei Tagesreisen vor Manila geriet das Schiff in einen ungewöhnlich heftigen Hurricane. Natürlich waren sie wie üblich über Funk gewarnt worden und der Kapitän hatte daraufhin den Kurs geändert, volle Kraft voraus gegeben, um dem Wirbelsturm, wenn auch nicht ganz zu entkommen, so doch wenigstens nur noch die Ausläufer zu streifen.
Allerdings gab es einen Haken an der Sache, den niemand hatte voraussehen können: Der Hurricane hatte seinen Kurs ebenfalls geändert und die „Ajax“ war nun direkt in ihn hineingefahren. Er hatte bereits tüchtig an Fahrt aufgenommen, aber das raubte den Menschen, die sich auf der Brücke befanden, noch nicht die Zuversicht. „Die „Ajax“ war ein wind- und wettererprobtes Schiff, sie hatte schon so manchen schweren Sturm abgeritten und so würde sie es wohl auch dieses Mal schaffen.
Allerdings, dieses Mal unterlief dem Kapitän ein fataler Fehler.
Zu spät erkannte er, dass sein Plan nicht aufgehen würde. In dem Augenblick, als er realisierte, dass er sich unerwartet mitten im Hurricane befand, hätte er spätestens jetzt sein Schiff in den Wind drehen müssen. Wie stets bei besonders schwerer See hatte der Dritte Offizier Stephen auf die Brücke gerufen, obgleich dieser eigentlich gerade wachfrei hatte. Die beiden kannten sich seit ewig langer Zeit und mit ihm am Ruder glaubte er, sogar die Hölle durchreiten zu können.
Matthew Longfellow war zu dieser Zeit Dritter Offizier auf der „Ajax“.
Neben dem Kapitän, Longfellow und Stephen befanden sich noch der Erste und ein Matrose auf der Brücke.
Stephen, den so leicht nichts aus dem Gleichgewicht brachte, zeigte jedoch Zeichen von Unruhe.
‚Warum dreht der Captain nicht endlich in den Wind?‘, dachte er.
Er war von allen Anwesenden der Einzige, der zu diesem Zeitpunkt bereits ahnte, dass es noch viel ärger kommen würde, sehr viel ärger.
Seine Erfahrung durch lange Jahre am Ruder sagte ihm, dass die Elemente durchaus nicht so völlig zügellos daherkamen, wie es manchmal schien.
„Alles hat ein System!“, pflegte er zu sagen.
Nach Stephens Beobachtungen war jede siebte heranrollende Welle eine besonders hohe und nach sieben weiteren Wellen-Perioden war die neunundvierzigste Welle in aller Regel eine ganz besonders gewaltige. Bei einem außerordentlich schweren Sturm, einem Taifun oder einem „Hurricane“, wie die Amerikaner diese Art eines alles zerstörenden Wirbelsturmes nannten, konnte diese besonders hohe Welle sogar zu einer sogenannten, von allen Seeleuten gefürchteten Monsterwelle auflaufen.
Überlebende solcher Monsterwellen berichteten von welchen die fünfundzwanzig, ja, sogar über dreißig Meter Höhe erreichen konnten.
In der Regel hatte ein Wirbelsturm allerdings, nachdem er sich ausgetobt und sein „Opfer gefordert“ hatte, mit seiner Monsterwelle den Zenit erreicht und ebbte anschließend ab.
Dieser Hurricane aber, und das wusste Stephen ganz bestimmt, hatte seinen Zenit noch längst nicht erreicht, und mit jedem Zaudern, das Schiff in den Wind zu drehen, würde dieses Manöver gefährlicher oder aber sogar am Ende unmöglich werden. So entschloss sich Stephen nach einigem Zögern, seinen Kapitän diesbezüglich anzusprechen, gleichwohl er wusste, dass dieser so etwas absolut nicht schätzte.
Er räusperte sich einige Male: „Nichts für ungut, Captain, aber ich würde es für ratsam halten, jetzt in den Wind zu drehen.“
Der Kapitän erstarrte prompt, drehte sich zu Stephen und blickte diesen wie ein lästiges Insekt an.
„Ach ja?“, entgegnete er mit beißendem Sarkasmus. „Würden Sie das?“ Mit erhobener Stimme und schneidendem Tonfall fügte er hinzu: „Matrose Tremaine, hätten Sie vielleicht die Güte, die Führung des Schiffes mir zu überlassen?“
„Aye, Captain“, erwiderte Stephen ungerührt und fuhr fort, die Brecher zu zählen.
Jetzt jedoch hielt es Matthew Longfellow, der Dritte, für angebracht, seinem Rudergänger beizuspringen.
„Entschuldigung, Captain“, sagte er, „gestatten Sie mir, darauf hinzuweisen, dass Tremaine vielleicht doch recht haben könnte, mit seinem Rat. Er ist einer der erfahrensten Seeleute, die ich jemals kennengelernt habe.“
Der Kapitän lief rot an. „Es reicht! Mister Longfellow, Sir. Noch führe ich hier das Kommando!“
Es war allerdings nicht mehr zu leugnen, der Wind hatte noch einmal deutlich zugenommen und pfiff mit um die zweihundert Stundenkilometern um das Brückenhaus.
Die „Ajax“ ächzte unter dem Druck des Sturms, der jetzt mit entsprechender Heftigkeit das Achterschiff traf.
Der Steven tauchte mit jedem Brecher immer wieder tief und noch tiefer in die kochende See und jedes Mal ragte am Heck wild schäumend die Schraube aus dem Wasser, sodass das Schiff von einem heftigen Zittern ergriffen wurde.
Stephen hatte nicht abgelassen vom Zählen der Wellen und so, wie es seiner Erfahrung entsprach, verhielt sich auch dieser Sturm. Jede siebente Welle war heftiger als die vorhergehenden. Er zählte jetzt die siebenundvierzigste Welle der Periode. Ihm, der mit dem Kutter seines Vaters die heftigsten Stürme abgeritten hatte, trat der kalte Schweiß auf die Stirn.
‚Guter Gott im Himmel, beschütze uns‘, betete er im Stillen.
Und ausgerechnet in diesem Moment wandte sich der Kapitän an seinen Ersten:
„Ich denke, wir sollten jetzt doch langsam in den Wind gehen.“
‚Das wird das Schiff nicht überleben‘, befürchtete Stephen, einen schlimmeren Zeitpunkt hätte sich der Kerl nicht ausdenken können.
Während der Erste nun den Hörer des Telefons abhob, um dem Ersten Ingenieur, der sich im Maschinenraum befand, das Manöver anzukündigen, wandte sich Stephen zu seinem Dritten hinüber und gestikulierte verzweifelt.
Der aber zuckte nur hilflos mit den Schultern.
„Klar zur Wende!“, kommandierte jetzt auch schon der Kapitän.
„Um Himmels willen, nein!“ Stephen konnte nun nicht mehr an sich halten. „Nicht jetzt! Um Gottes willen, nicht jetzt!“
„Führen Sie gefälligst meine Befehle aus, Matrose Tremaine!“, brüllte der Kapitän und dann an den Dritten Offizier gewandt: „Volle Fahrt voraus!“, und: „Ruder hart Backbord!“, an Stephen.
„Heilige Mutter Maria, steh uns bei“, betete dieser leise, obwohl er eigentlich Anglikaner war. „Das schaffen wir niemals.“
Die „Ajax“ hatte da schon begonnen, sich schwerfällig in die tosende See zu drehen.
Der nun vor ihr turmhoch aufsteigende Brecher traf das Schiff mit seiner gesamten Wucht von der Seite und ging fast über es hinweg. Es hatte sich weit auf die Steuerbordseite gelegt und nur unendlich langsam und mit allergrößter Mühe versuchte es sich wieder aufzurichten. Der folgende Brecher geriet ein wenig milder, sodass es schien, als könnte das Schiff es schaffen, aber das, was jenem auf dem Fuß folgte, ließ den auf der Brücke Versammelten das Herz stillstehen. Was da jetzt himmelhoch aufragte, war kein Brecher, sondern eine Wand, mindestens fünfundzwanzig Meter hoch, und sie kam mit rasender Schnelligkeit auf sie zu.
Die „Ajax“, erst zur Hälfte wieder aufgerichtet, fiel in ein abgrundtiefes Wellental, und die Monsterwelle, die nur wenige Sekunden darauf mit aller Wucht über das Schiff hinwegging, fegte gnadenlos alles nieder, was ihrer gewaltigen Wut nicht standzuhalten vermochte.
Es war der Todesstoß für das Schiff.
Die „Ajax“ richtete sich nicht wieder auf. Sie blieb mit nahezu achtzig Grad Schlagseite in der tosenden See liegen, ein Spielball für den tobenden Ozean.
Sie kämpfte nicht mehr. Sie hatte sich aufgegeben.
Ihr hoher, roter Schornstein war weg, abgerissen und hinfortgespült von der Wucht der entfesselten Gewalten. Dort, wo er einst so stolz in den Himmel geragt hatte, klaffte nun ein Loch, in das das Wasser ungehemmt hineinströmte.
Der Großmast war abgeknickt, als bestünde er aus dünnem Blech statt aus starkem Eisenrohr, und der Schwergutbaum, an seiner oberen Befestigung abgerissen, hing wie am seidenen Faden und zerschlug bei seinem wilden Hin- und Herpendeln die Abdeckung von Luke Zwei, bevor er schließlich gänzlich abriss und über Bord ging.
Auch der Flaggenmast auf dem Peildeck samt all seiner Antennen war fort.
Die Monsterwelle hatte beide Türen des Brückenhauses durchschlagen, als wären sie aus Papier, war einfach durch das Brückenhaus gerauscht und hatte den Kapitän mit seinem Ersten Offizier mit sich fortgenommen.
Stephen erinnerte sich später, wie er instinktiv die Arme durch die Speichen des Steuerrades gesteckt und ineinander verschränkt hatte. Jetzt hing er plötzlich, festgeklammert an den Speichen seines Steuerruders, frei im Brückenraum. Der Boden, auf dem das Ruder gestanden hatte, war zu einer Seitenwand und die Öffnung zur Steuerbordnock zu einer Luke oben an der Decke geworden.
***
Unter allergrößten Mühen war es Stephen, Longfellow und dem Matrosen der Wache gerade noch gelungen, dem Ruderhaus zu entkommen. Eine Zeitlang waren sie, an einen Rettungsring geklammert, in der tosenden See umhergetrieben, bis sie unverhofft auf ein kieloben treibendes Rettungsboot gestoßen waren, auf dem sich bereits rittlings zwei Matrosen befanden, die sich ebenfalls hatten retten können.
Zwei Tage waren sie auf dem Ozean getrieben, als sie, völlig entkräftet, von einem zufällig vorbei kommenden philippinischen Fischerboot aufgenommen wurden. Die fünf waren die einzigen Überlebenden der „Ajax“.
Einige Monate waren seither vergangen und nun standen Stephen Tremaine und Matthew Longfellow, gemeinsam auf der Brücke der „Glenfalloch“. Longfellow war inzwischen zum Zweiten Offizier befördert worden, er hatte bei seiner Reederei darauf bestanden, dass Stephen ebenfalls auf sein neues Schiff kommandiert werden würde.
Und kaum, dass sie wieder zusammen auf See waren, erwischte sie dieser heftige Atlantiksturm. Sie stimmten jedoch in ihrer Einschätzung überein, dass dieser Sturm, dessen „Tosen“ sie halbwegs gelangweilt von der Brücke aus zusahen, ein lindes Lüftchen war, im Vergleich zu ihrem schrecklichen Schiffbruch vor gerade einmal sechs Monaten.
Die „Glenfalloch“ bediente, anders als die auf so tragische Weise geendete „Ajax“, den Linienverkehr der Häfen Westindiens: Jamaika, Antigua und Trinidad sowie weitere.
Je nachdem, für welchen der unzähligen Häfen dieses Seegebietes sie gerade Ladung hatte. Sie ähnelte im Aussehen der „Ajax“, war etwas kleiner, aber hatte einen ebenso hohen, runden Schornstein, der nun allerdings blau statt rot war. Die „Glenfalloch“ war ein Schiff der „P&C Company“, die wiederum zur „E&O Line“ gehörte.
„Warst du schon einmal auf Trinidad, Steve?“, fragte Matthew, sie nannten sich seit dem furchtbaren Unglück ganz selbstverständlich beim Vornamen.
Stephen schüttelte den Kopf.
„No, Sir!“, sagte dieser scherzhaft ins Dienstliche fallend.
„Auf jeden Fall anders als Ostasien“, meinte Matthew.
„Genauso heiß, aber nicht so aufregend.“
Jedoch der letzte Teil dieser Aussage sollte sich für Stephen als ein großer Irrtum herausstellen.
Stephen Tremaine
Pünktlich um 20 Uhr erschien die Wachablösung auf der Brücke der „Glenfalloch“.
„N’Abend, Matthew“, grüßte der Erste Offizier, der jetzt die Wache von Matthew Longfellow übernahm.
„N’Abend, Mr. Tremaine“, wandte der Erste sich nun auch an Stephen.
Dem anderen Matrosen, der auf seinem Posten Ausguck stand, nickte er lediglich wortlos zu.
„N’Abend, Mr. Bush, Sir“, erwiderte Stephen.
Zusammen mit dem Ersten waren die zwei Matrosen der nächsten Wache erschienen.
„Irgendetwas Besonderes?“, fragte Mr. Bush den Zweiten Offizier.
Dieser schüttelte den Kopf.
„No, Sir“, sagte er, „Mr. Tremaine ist der Ansicht, dass der Wind eher noch auffrischen wird.
„So, ist er das?“, entgegnete der Erste und blickte zu Tremaine hinüber, der inzwischen das Ruder seiner Ablösung übergeben hatte. „Dann wird es wohl auch so sein“, setzte er daraufhin hinzu.
Die Mannschaft der „Glenfalloch“ war offiziell nicht über den Schiffbruch Longfellows und Tremaines informiert worden, aber auf welchem Wege es auch immer geschehen sein mochte, die gesamte Besatzung wusste alles über deren tragisches Schicksal und welche Rolle Stephen dabei gespielt hatte.
Nicht einmal der Erste hegte die geringsten Zweifel am Seeverstand Tremaines.
Als sich die Männer der Zweiten Wache nun anschickten, die Brücke zu verlassen, rief ihnen der Erste Offizier noch hinterher:
„Kann sein, dass ich Sie noch brauchen werde, Mr. Tremaine!“
„Aye, Sir“, erwiderte dieser, schon halb durch die Tür zur Brücke.
Tremaine suchte nun als Erstes die Mannschaftsmesse auf, um zu Abend zu essen. Alle anderen hatten das natürlich schon lange hinter sich, aber ein Großteil der Decks-Hands hielt sich noch dort auf.
Tremaine begrüßte sie alle und dann kam auch schon der Steward geeilt, um ihm sein Abendessen zu servieren, das dieser für ihn warmgehalten hatte.Stephen blickte sich in der Messe um.
„Wo steckt denn Jimmy?“, wollte er wissen.
Jimmy war der Schiffsjunge der „Glenfalloch“. Es war erst seine zweite Reise.
„Der ist seit zwei Stunden auf der Toilette“, grinste Hugh, ein Matrose aus Kingston auf Jamaika.
‚Der Arme!‘, dachte Stephen.
Er selber war noch niemals seekrank gewesen, aber er konnte es gut nachempfinden. Seit er hier an Bord war, hatte er sich des Knaben angenommen. Er wusste ja nur zu gut, wie die Schiffsjungen gemeinhin behandelt wurden, und hatte seinen Kollegen daher gleich klargemacht, dass dieser unter seinem Schutz stand. Einige hatten gemurrt, es passte ihnen nicht. Schließlich war es ihnen selber ja auch nicht besser ergangen und schließlich sollte ja einmal ein „richtiger Mann“ aus ihm werden. Aber niemand wagte es, Tremaine zu widersprechen. Von dem Moment an, als er an Bord gekommen war, Stephen als eine Autorität anerkannt worden. Selbst der Kabel-Ede, der ja in der Hierarchie noch über ihm stand, hätte es sich zweimal überlegt, Stephen in allem, was Seemannschaft betraf, zu widersprechen.
Stephen galt an Bord als der Held von Manila und so nannten sie ihn auch, allerdings nur, wenn er nicht dabei war. Er selber hätte sich das nämlich verbeten. Denn er war von Grund auf eine unaufdringliche, bescheidene Person. Er war anders als die meisten anderen. Wohl trank auch er gern einmal eine Flasche Ale oder auch zwei mit seinen Kumpels, aber die üblichen Saufereien machte er nicht mit. Auch mochte er ganz und gar nicht die Grobheiten, die gemeinhin unter der Besatzung üblich waren. Da er sich aber vom ersten Tage an als ausgesprochen kameradschaftlich erwies, lernten ihn seine Kollegen sehr schnell schätzen. Neben dem heldenhaften Ruf, der ihm ungewollt vorausgeeilt war, war es aber noch etwas, was den Leuten gebührenden Respekt vor Stephen einflößte. Er gehörte optisch dem Typus Mensch an, der in Cornwall zwar recht häufig anzutreffen, aber im Übrigen Königreich eher selten wahrzunehmen war. Stephen hatte eine auffallend helle, schier weiße Haut, die nicht einmal in den Tropen dunkler wurde, dazu aber pechschwarze Haare und unter seinen ebenfalls pechschwarzen Augenbrauen leuchteten zwei Augen, blau wie das Mittelmeer an einem wolkenlosen Sommertag.
Groß geworden war er in dem damals noch recht kleinen Fischerdorf Mevagissey, gelegen an oder vielleicht besser gesagt in der wild zerklüfteten Küste der Grafschaft Cornwall. Sein Großvater war noch einer jener berüchtigten Schmuggler dort gewesen. Angeblich war er niemals erwischt worden.
Es war ein harter Menschenschlag, der dort seit jeher lebte. Die Fischer waren auf ihren kleinen, aber äußerst seetüchtigen Booten, die damals noch unter Segel fuhren, bei jedem Wetter hinaus auf Fang gefahren. Und wenn das Wetter ganz besonders scheußlich war – hohe See, dichter Nebel oder eine mondlose Nacht – war es für sie Zeit, auf Schmuggel zu fahren. Sie hatten es verstanden, trotz heftigsten Seegangs jede noch so kleine Einfahrt in dem Felsengewirr der cornischen Küste zu finden und hindurchzuschlüpfen, ohne dabei auf die Felsen geworfen zu werden. Und am Ende waren sie zielgenau in der Bucht gelandet, in deren Höhlen sie das Schmuggelgut zu verstecken pflegten.
Man sagte, dass Branok Tremaine, Stephens Vater, selber noch in seinen jungen Jahren Schmuggler gewesen sei.
Stephen war sechs Jahre alt gewesen, als der Vater begann, ihn und den älteren Bruder mit aufs Meer hinauszunehmen. Natürlich besuchte der Junge wie alle anderen Gleichaltrigen die Schule, aber nicht selten fehlte er einfach einmal für einige Tage.
Branok war der Meinung, dass das, was ein Mann zum Leben brauche, nicht auf der Schule zu erlernen sei, sondern ausschließlich auf See.
Niemand fragte danach, was die Mütter dieser Kinder jedes Mal für Todesängste ausstanden, wenn ihre Knaben wieder und wieder mit hinausfuhren.
Aber so war es nun einmal, es war das Meer, das den Menschen hier an der Küste das Leben gab – und manchmal auch nahm. Das Meer ernährte sie alle und je mehr die Menschen sich mit diesem verbanden, desto mehr wurde es ihnen zum Freund.
***
Sowenna wohnte nur zwei Häuser von den Tremaines entfernt. Sie war ein auffallend hübsches Mädchen mit blonden halblangen Haaren und Augen, so türkisfarben wie das Wasser in einer tropischen Lagune. Stephen hatte es sich seit einiger Zeit angewöhnt, auch wenn er gar nicht in diese Richtung wollte, immer wie zufällig an ihrem Haus vorüberzugehen. Wenn er auf sie traf, grüßte er sie stets sehr freundlich und weil er ein schmucker Kerl war, wurden aus diesen Grüßen nach und nach kleine Gespräche.
Auf diese Weise wurden die beiden jungen Menschen im Laufe der Zeit immer vertrauter und es dauerte auch gar nicht lange, dass sie unzertrennliche Freunde geworden waren.
Die anderen Jungen hänselten ihn gerne ein wenig deswegen, aber das war ihm egal. Wenn sie es zu arg trieben, drohte er ihnen Prügel an, und dann ließen sie ihn in Ruhe. Er gehörte nicht zu denen, für die die üblichen Raufereien unter Jungen an der Tagesordnung waren, aber diejenigen, die es genau wissen wollten und ihn bedrohten, taten das nur einmal und dann nie wieder. Er schlug so schnell und so hart zu, dass ihnen fortan die Lust auf eine Rauferei mit ihm verging.
Als sie älter wurden, konnte man immer öfter hören, was für ein schönes Paar Sowenna und Stephen doch wären. Und so galt es auch bald als fest ausgemacht, dass, sobald sie das Erwachsenenalter erreicht hätten, für sie die Hochzeitsglocken läuten würden.
Aber zunächst einmal kam alles ganz anders. Als der Vater es für an der Zeit hielt, sein Erbe an seine Kinder zu übergeben, bekam Stephens älterer Bruder das Fischerboot.
Stephen liebte seinen Bruder, aber unter seinem Kommando fahren wollte er nicht. Also musste er sich etwas Anderes für seine Zukunft suchen.
Und so kam es, dass er sich eines schönen Tages auf den Weg nach Southampton machte, um dort auf einem Schiff der „E&O Line“ anzumustern.
Sowenna weinte bittere Tränen bei seinem Abschied, aber er tröstete sie und versprach, so oft er nur konnte, zu schreiben, was er dann auch tat.
Und immer, wenn er einmal nach Hause kam und sie beide lange Spaziergänge miteinander machten, schmiedeten sie Pläne für ihre Hochzeit. Nur eine Reise noch wollte er machen, und sobald er wieder zurück wäre, abmustern und einige Wochen nach seiner Hochzeit mit Sowenna auf einem anderen Schiff anmustern.
Aber dann geschah es, dass Stephen nicht zu dem verabredeten Termin nach Hause kam. Sein Schiff sollte in die Werft und auf der zur gleichen Zeit im Hafen liegenden „Ajax“ wurde händeringend ein Matrose gesucht. Er galt bereits als außerordentlich erfahren, und weil im Chinesischen Meer die Zeit der Wirbelstürme begann, bekniete ihn der Personalchef im Heuerbüro seiner Reederei inständig, seine Hochzeit um drei Monate zu verschieben.
Nur diese eine Reise noch. Man bot ihm sogar ein zusätzliches Monatsgehalt an.
Stephen war kein Mensch, der sich verweigerte, wenn er gebraucht wurde, und er sagte also zu. Er konnte, kaum dass er auf seinem neuen Schiff angekommen war, gerade noch einen Brief an seine gewiss todunglückliche Sowenna schreiben. Aber er schaffte es nicht mehr, ihn auch noch zur Post zu bringen. Er
tröstete sich aber damit, den Brief in Port Said in die Schiffspost geben zu können.
Die „Ajax“ sollte drei Wochen später und zwei Tage vor ihrem Einlaufen in den Hafen von Manila in einen dieser gefürchteten Wirbelstürme geraten und sinken.
Die Nachricht von ihrem Untergang schlug zu Hause in England ein wie eine Bombe. Es hieß, dass niemand von der Besatzung dieses Unglück überlebt habe. Niemand in der Heimat erhielt Kenntnis darüber, dass es fünf Überlebende gegeben hatte, die auf fast wundersame Weise von einem philippinischen Fischerboot entdeckt und an Bord genommen worden waren. Durch den Wirbelsturm war die „Ajax“ so weit in das Chinesische Meer abgetrieben, dass die fünf halbverdursteten Schiffbrüchigen nach ihrer Rettung auf einer dieser winzig kleinen Inseln dort gelandet waren. Es stellte sich später heraus, dass es sich vermutlich um Amianan Island hatte handeln müssen, die zwar noch den Philippinen zugeordnet war, aber näher an Formosa als an Manila lag. Auf ihr gab es nichts außer fünf oder sechs mit Palmblättern gedeckte Fischerhütten und zwei mit einem schrägen dreieckigen Segel betriebene Fischerboote. Der Hafen von Manila lag, unerreichbar für jene, viele, viele Tagesreisen entfernt und natürlich gab es hier auch keinen Funk.
Die fünf Seeleute waren von den Eingeborenen freundlich aufgenommen worden und diese hatten alles das, was sie selber zum Leben erwirtschafteten, mit ihnen geteilt.
Jedes Mal, wenn eines der Boote hinaus auf Fischfang fuhr, nahmen sie einen der ehemaligen Besatzungsmitglieder der „Ajax“ mit an Bord. Es hätte ja sein können, dass sie irgendwo da draußen auf ein vorüberfahrendes Schiff trafen.
Und doch dauerte es fast volle zwei Monate, bis es den Überlebenden endlich gelang, sich einem fern am Horizont vorüberfahrenden Schiff bemerkbar zu machen.
In Southampton wurde die Nachricht von den Geretteten wie die Erfüllung all der verzweifelten Gebete der Angehörigen aufgenommen, wenngleich es auch nur fünf von den insgesamt neununddreißig der Besatzung waren.
Als diese endlich, nach so langer Zeit wieder zurück in die Heimat kamen, gab es von der Reederei fünf Wochen Sonderurlaub.
Dankbar gegenüber dem Schicksal und den Mächten, die ihn und vier seiner Kameraden das Unglück hatten überleben lassen, machte sich Stephen schließlich glücklich und voller froher Erwartungen auf den Weg nach Hause zu seiner Liebe.
Aber als er dann nach nunmehr über einem Jahr endlich in Mevagissey war, fand er dort seine Sowenna inzwischen mit einem anderen verheiratet vor.
Ohne noch ein weiteres Wort zu sagen, verließ Stephen seinen Heimatort wieder, um sich in Liverpool ein neues Schiff zu suchen.
Sein Freund, das Meer, hatte ihn zwar am Leben gelassen, aber es hatte Stephen seine Liebe genommen.
Zumindest dachte er so.
Für Stephen war seine Welt zusammengestürzt und nun musste er lernen, wie es wohl gehen sollte, trotz eines gebrochenen Herzens weiterzuleben.
Als er wenige Tage später das Heuerbüro der „P&C Line“ betrat, stieß er fast mit einem anderen Manne zusammen, der gerade auf dem Weg hinaus war.
Es war Matthew Longfellow, sein ehemaliger Dritter Offizier.
Und so war er auf die „Glenfalloch“ gekommen.
***
Stephen saß nun in der Mannschaftsmesse eben dieses Schiffes. Gerade hatte er seine Mahlzeit beendet und gedachte, vielleicht noch eine Weile hierzubleiben und den Abend zusammen mit seinen neuen Kollegen bei einer guten Flasche Ale zu beschließen.
Über all die Monate und Jahre hinweg, die er nun schon zur See fuhr, hatte er sich in der Regel von dieser Art Unterhaltungen ferngehalten, denn fast ausnahmslos drehte es sich bei den Gesprächen der Matrosen um Frauen. Wenn ihr Schiff nach Wochen auf See wieder in einem der zahlreichen Häfen festmachte, zogen sie zusammen los, in die Hafenkneipen aller Welt, wo stets willige Mädchen auf sie warteten. Stephen war das alles durchaus nicht fremd und manchmal war er sogar mit ihnen mitgegangen. Aber bei allem, was mit bezahlter Liebe zu tun hatte, war er stets enthaltsam geblieben.
Er hatte ja seine Sowenna gehabt. Nur das allein hatte für ihn gezählt.
Als die anderen nun hörten, dass dies Stephens erste Fahrt nach Westindien sei, begann alsbald eine wilde Schwärmerei von den Vorzügen der lateinamerikanischen Frauen. Von all den der Weiblichkeit Lateinamerikas zugeschriebenen, herrlichsten Attributen schwirrte Stephen bald der Kopf.
„In Port Limón gibt es die schönsten Frauen!“, rief Brian.
„Komm du mal erst nach Puerto Barrios!“, rief da Lars, der Schwede. „Da wirst du aber staunen.“
„Nein, die schönsten und treuesten Mädchen gibt es im ‚Moulin Rouge Club‘, in Port of Spain“, warf Hugh ein.
Und er, der selber aus Jamaika stammte, hielt nun eine flammende Rede über die Mentalität seiner weiblichen Landsleute.
„Es macht diese gewisse Mischung“, sagte er. „Die Ureinwohner, die Indios, die sich mit den Nachfahren der spanischen Eroberer vermischt haben, die Kreolen, die Afrikaner, und in Port of Spain kommen dazu noch die Menschen indischer Herkunft. Das alles ergibt ein buntes Völkergemisch. Ich bin ja selber einer von ihnen“, lachte er.
Er geriet regelrecht in Entzücken bei diesen Schilderungen der Vorzüge seiner weiblichen …: „Sagt man Landsmänninnen?“, fragte er und alle lachten.
Stephen machte sich bei all diesen Lobpreisungen durchaus keine Illusionen. Um welchen Typ Frauen es sich bei all der Schwärmerei handelte, war ihm sehr wohl bewusst, er war schließlich lange genug Seemann. Natürlich ging es dabei um die Huren in den Hafenkneipen. Dieses war nun mal die Welt der Seeleute: die Schiffe, die Hafenstädte und die Huren.
Das alles gehörte zusammen und von nun an war es auch seine Welt.
„Leute!“, sagte er schließlich. „Auch wenn ich vielleicht zum ersten Mal nach Westindien komme, so bin ich doch recht viel in der Welt herumgekommen. Und ich kann euch versichern, auch in anderen Teilen der Erde findet man prächtige Frauen, in Manila zum Beispiel.“
„Das ist wahr!“, mischte sich Michael ein. „In Manila ist es auch so, oder sagen wir mal, zumindest so ähnlich. Ich war auch ein paar Mal in Manila.“
Naja jetzt ergriff Lars, der Schwede, wieder das Wort. „Kann alles sein, aber hört nun, was ich einmal in Formosa erlebt habe.“
Und er begann zu erzählen:
„Es war in Kaohsiung, da war ich mit einem Mädchen einig geworden. Wir setzten uns in ein Taxi und fuhren zu ihr nach Hause.
Nach einer etwa zehnminütigen Fahrt kamen wir in immer trostloser wirkende Stadtviertel. Schließlich hielt das Taxi vor einem relativ großen, flachen Holzschuppen. Nachdem wir ausgestiegen waren, führte mich das Mädchen zur Tür dieser Bruchbude. Mir kam das alles nicht geheuer vor. Es soll ja schon vorgekommen sein, dass Seeleute in die heruntergekommenen Vororte gelockt und dort ausgeraubt wurden. Ich wurde misstrauisch, blickte mich hilfesuchend zum Taxifahrer um, aber der war bereits davongefahren. Das Mädchen nahm mich bei der Hand und zog mich förmlich hinter sich in diesen Schuppen hinein. Das machte mich noch misstrauischer. Ich fand mich wieder in einem großen ungeteilten Raum und zu meiner allzu großen Verblüffung fand ich dort eine ganze Familie versammelt – Eltern, Geschwister, Großeltern und was weiß ich noch alles, Onkel, Tanten, Nichten, Neffen. Sie alle blickten mich freundlich an, ja, sie hießen mich sogar mit höflichen Verbeugungen willkommen. ‚Hier?‘, fragte ich leicht entsetzt das Mädchen. Das nickte eifrig, fasste mich mit beiden Händen und zog mich zu einem Verschlag, nein, eigentlich war es nur ein Vorhang, der uns vor dem Rest der Familie notdürftig abschirmen sollte. Dahinter befand sich ein Bett.
Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie ich da meine Beine in die Hand genommen habe! Ich lief zu Fuß bis in die Innenstadt zurück.“
Alle lachten und wieder übernahm Brian das Wort.
„Das ist gar nicht so ungewöhnlich,“ sagte er. Er wandte sich an Lars, den Schweden:
„Wie viele Personen waren dort versammelt? Sechs, sieben oder acht Leute? Einer davon, vermutlich der Familienvater, hatte vielleicht, wenn überhaupt, eine noch dazu sehr schlecht bezahlte Arbeit. So blieb nur die Tochter, um Geld ins Haus zu bringen. Ich habe es oft erlebt, dass es nur allein die Tochter war, die eine ganze Familie ernährte. Moral allein rettet einen nicht vor Hunger und Elend.“
„Ja, da ist wohl etwas dran“, räumte Lars ein, „hinterher hat sie mir recht leidgetan. Sie war ein liebes Mädel.“
So verging der Abend und Stephen machte sich sehr bald auf den Weg in seine Koje.
Als er wegen des Seeganges mühsam den Mittelgang entlangtorkelte, hatte er das Gefühl, dass das Schiff stärker arbeitete als noch vor zwei Stunden.
Er war gerade eingeschlafen, da wurde er auf die Brücke gerufen.
Trinidad
Stephen kleidete sich hastig an. Im Grunde hatte er schon so halbwegs damit gerechnet, dass man ihn brauchen würde. Aber er war müde und hatte keine Lust.
„Das ist wohl der Preis einer zweifelhaften Berühmtheit“, seufzte er für sich, „ich könnte gern darauf verzichten.“
Er hatte Mühe, den Niedergang zur Brücke hinaufzukommen, so sehr arbeitete das Schiff in der rauen See. Als er die Brücke betrat, seine Augen mussten sich erst an die hier herrschende Dunkelheit gewöhnen, fand er die gesamte Schiffsführung versammelt. Eigentlich hätte jetzt der Dritte die Wache, aber der Erste Offizier wollte ihn bei diesem Wetter wohl nicht alleinlassen und in der Zwischenzeit war auch der Kapitän erschienen.
„Verzeihen Sie, Mr. Tremaine“, sprach dieser ihn nun an, „wir hätten Sie gerne Ihrem sicherlich verdienten Schlaf überlassen, aber mir scheinen die Umstände so, dass ich es für ratsam hielt, Sie auf die Brücke zu bitten.“
Stephen grinste etwas schief.
„Ist schon okay, Captain“
Er torkelte zum Rudergänger hinüber und wäre dabei fast auf die Nase gefallen.
„Hoppla!“, rief er unwillkürlich aus. „Das scheint ein recht ungemütliches Lüftchen zu sein.“
Der Rudergänger grinste und überließ ihm bereitwillig das Ruder.
„Kurs null-sechs-fünf.“
„Danke, null-sechs-fünf“, wiederholte Stephen.
Er brauchte einige Minuten, bevor er die Eigenarten dieses Seeganges in sich aufgenommen hatte, aber jeder der hier Anwesenden konnte sehr bald spüren, dass das Schiff sich kurze Zeit später deutlich stabilisierte. Es schlingerte allerdings immer noch stark.
Die einzige Beleuchtung auf der Brücke war der Widerschein des abgedunkelten Kompasses. Stephen hätte ihn am liebsten ganz dunkel gesehen – er störte seine Konzentration, aber das war natürlich nicht denkbar. Er sollte ja, wenn möglich, nebenbei auch den Kurs halten.
Auf der Brücke herrschte absolute Stille. Alle schauten angestrengt hinaus in die dunkle Nacht.
„Ich würde gern zwei, drei Grad stärker in den Wind gehen“, meinte er nach einer Weile.
„Tun Sie das!“, stimmte ihm der Kapitän zu.
Dieses unbedingte Vertrauen machte Stephen fast ein wenig verlegen.
„Neuer Kurs: null-sechs-acht“, gab er daraufhin an.
Nach einer Weile ergriff der Kapitän wieder das Wort:
„Was halten Sie von diesem Wind?“
„Kann ich noch nicht genau sagen“, sagte Stephen,
„geben Sie mir eine halbe Stunde, um die Lage einzuschätzen.“
Nach einer scheinbar endlosen Zeit des Schweigens, in der allen Anwesenden das Heulen des Sturmes nur umso mehr bewusst wurde, setzte Stephen an:
„Es wird nicht weiter auffrischen. Schätze, der Wind wird bald etwas mehr nach Steuerbord drehen und vermutlich gegen morgen abflauen.“
Der Kapitän blickte ihn eine ganze Weile zweifelnd an.
‚Das kann der Kerl doch unmöglich wissen‘, dachte er bei sich. Aber er sagte nichts.
Zwei Stunden später schien der Wind tatsächlich fast unmerklich etwas abzunehmen und mit dem Ende der Zwölf-Uhr-Wache wurden die Bewegungen der „Glenfalloch“ langsam weicher. Der Sturm hatte seinen Höhepunkt überschritten.
Jetzt erschien die Vier-Uhr Wache in der Person Matthew Longfellows und zwei weiteren Matrosen auf der Brücke. Aber sollte Stephen etwa gedacht haben, dass auch er nun endlich abgelöst werden würde, hatte
er sich geirrt.
„Ich wäre Ihnen sehr verbunden, Mister Tremaine, wenn Sie noch eine Weile weiter am Ruder bleiben würden“, richtete sich Longfellow förmlich an Stephen.
„Aye, Sir!“
Kurz darauf meinte der Kapitän, seine Anwesenheit sei wohl jetzt nicht mehr vonnöten.
„Gehen Sie auch zu Bett, Mr. Bush“, wandte er sich an den Ersten Offizier. „ich denke, wir können die Leute der Wache nun allein lassen“, und mit einem „Danke, Mr. Tremaine“, verließ er in Begleitung des Ersten und des Dritten Offiziers die Brücke.
In der Tür drehte er sich noch einmal zurück: „Ich weiß mein Schiff ja in guten Händen“
Matthew und Stephen schauten sich an, sie hatten zur gleichen Zeit denselben Gedanken:
‚Mit diesem Captain hätten wir die ‚Ajax‘ vor Manila vermutlich halbwegs ohne allzu große Schäden durch den Hurricane gebracht.‘
Aber sie sagten nichts.
„Das sind die Tücken des guten Rufes“, meinte Stephen trocken, „nur vier Stunden Pause und dann gleich zwei Wachen hintereinander. Kann ich gerne darauf verzichten, ich bin hundemüde.“
Im Verlauf der folgenden Stunden war deutlich zu spüren, dass die Schläge der Brecher auf den Steven der „Glenfalloch“ langsam an Härte verloren. Noch peitschte die Gischt des aufgewühlten Meeres zwar in Abständen bis über das Brückenhaus, aber das Schiff ritt den jetzt herrschenden Seegang mit der Eleganz eines routinierten Rennpferdes ab.
Am Ende ihrer Wache, als der Erste Offizier, Mr. Bush, mit seinen Mannen auf der Brücke erschien, um die Wache von ihnen zu übernehmen, hatte sich die See dann auch bereits weitgehend beruhigt.
„Und nun – ab in die Koje!“, sagte der Erste, und an Stephen gewandt: „Selbstverständlich sind Sie heute vom Dienst befreit.
„Aye, aye, Sir!“
Am Mittag des nächsten Tages brach die Sonne durch die Wolken und so blieb es auch die kommenden anderthalb Wochen bis zu ihrer Ankunft in Port of Spain.
Der Atlantik zeigte sich von seiner besten Seite. Es wurde mit jedem Tag wärmer und zwei Tage, bevor die „Glenfalloch“ die Insel Trinidad erreichte, konnte Stephen bereits das Land riechen.
Es war die Eigenart der tropischen Länder, dass man aufgrund des schweren feuchten Klimas ihren unverwechselbaren Duft, eine Mischung aus einer üppigen, alles überwuchernden Vegetation, in die sich der Geruch nach Verwesung mischte, Tage, bevor man das Land sah, bereits riechen konnte.
Für Stephen war es jedes Mal aufs Neue wie eine Verheißung. Wenn er sich den Tropen näherte, war er stets wie elektrisiert. Er liebte die Tropen über alles. Sturmmöwen umkreisten jetzt die Masten des Schiffes – und die flinken Fregattvögel, die sich immer wieder mit angelegten Flügeln pfeilschnell ins Meer stürzten. Niemals tauchten sie ohne einen Fisch im Schnabel wieder auf, schwangen sich sodann mit einer bewundernswerten Leichtigkeit erneut in die Lüfte. Für sie bestand kein Unterschied zwischen den Elementen. Ohne ihren Flügelschlag auch nur ansatzweise zu unterbrechen, schienen sie unter der Wasseroberfläche ihren Flug einfach fortzusetzen.
Wenn, ja, wenn er nicht so unermesslich verzweifelt und niedergeschlagen gewesen wäre, weil seine Gedanken noch immer um Sowenna kreisten, hätte Stephen sich wohl jetzt recht glücklich gefühlt.
Nachdem die „Glenfalloch“ an dem unendlich langen Kai von Port of Spain ihre Leinen übergeben hatte und fest vertäut worden war, machten sich diejenigen, die zu den Glücklichen gehörten, keine Lukenwache gehen zu müssen, landfein.
Stephen ging, wie nahezu immer und überall, allein an Land. Er war das erste Mal in der Region der Westindischen Inseln und abenteuerlustig, wie er war, erfüllt von einer unstillbaren Neugier auf jedes fremde Land und Kultur, freute er sich auf dieses für ihn immer wieder neue Erkunden eines neuen Hafens. Vielleicht war dies sogar ein Mittel gegen seine Schwermut.
Für den Abend hatten Michael, Lars, der Schwede, und Brian ihn aber geradezu genötigt, sie auf ihrer gemeinsamen Vergnügungstour zu begleiten, um ihn in das Etablissement einzuführen, von dem bereits die Rede gewesen war.
„Das musst du unbedingt erlebt haben“, hatte Michael gesagt.
Stephen durchstreifte die Straßen von Port of Spain, aber das Geheimnisvolle, den Atem uralter Kulturen, all das, was ihn in den asiatischen Häfen immer so ganz besonders fasziniert hatte, vermisste er hier.
Zum Abendessen ging er zurück an Bord. Nach einer schnellen Dusche huschte er die Gangway hinunter, wo auf dem Kai bereits seine Kompagnons auf ihn warteten.
Stephen schloss sich ihnen mit durchaus gemischten Gefühlen an.
Das abrupte Ende seiner Verlobung hatte eine tiefe Wunde in seinem Inneren hinterlassen und nicht nur allein das, es war nichts weniger als der Verlust eines ganzen Lebensentwurfes, seines Lebensentwurfes.
Was sollte das Leben jetzt noch für ihn bereithalten – war er überhaupt bereit für ein anderes Leben? Gleichgültigkeit beherrschte ihn, wie er nun loszog mit seinen Kollegen, sich zu betäuben mit flüchtigen Freuden. Vielleicht half es ihm, zu vergessen, und vielleicht war er sogar ein wenig gespannt auf dieses so viel gelobte Etablissement.
Er war Seemann genug, um, auch wenn er in der Vergangenheit an den Zügen seiner Kollegen durch die Hafenkneipen eher selten teilgenommen hatte, Vorurteile gegen die bezahlte Liebe zu haben. Er wusste sehr wohl, das alles gehörte zu einem Seemannsleben dazu.
Aber dieses Verschwinden aufs Zimmer, für eine Stunde mit einem dieser käuflichen Mädchen, das mochte er irgendwie einfach nicht.
Schnelle Liebe? Gab es so etwas überhaupt?
Nein, aber wenn schon, dann wollte er mit der Frau, und sei es auch, dass er sie dafür bezahlte, in eine Art von Beziehung treten. Er wollte wissen, wie sie war, wie sie fühlte und wie sie dachte. Und natürlich musste sie ihn auch mögen.
All die Jahre zuvor mit der Vorstellung an ein Leben mit Sowenna hatte sich ihm etwas in dieser Art verboten. Allein der Gedanke daran war ihm fremd. Aber natürlich wusste er, dass seine Kollegen auch hier in Port of Spain feste, wenn auch bezahlte Freundinnen hatten, genauso wie in allen anderen Häfen der Welt. Das war durchaus nichts Neues für ihn.
Und so war es auch früher mit seinen Kollegen in Manila gewesen. Bei diesem Gedanken kam ihm die Erinnerung an seine Mannschaftskollegen der „Ajax“ in ihm hoch. Sie hatten ihr Leben in den Weiten des Ozeans verloren. Ob die Hafenmädchen in Manila um sie trauerten? Wo doch mit jedem neuen Schiff, das in den Hafen einlief, immer wieder aufs Neue alte Freunde zu ihnen kamen, um für wenige Stunden ihre Einsamkeit zu vergessen und sich der Illusion von Wärme und Geborgenheit hinzugeben.
Ja, und doch, Stephen war sich ganz sicher, dass auch sie um seine toten Kameraden trauerten.
Er glaubte sicher, dass diese Mädchen auf ihre Art treu waren, und aus diesem Grunde mochte er sie, auch wenn er alles dies nur aus den Erzählungen seiner Kollegen kannte.
Die kleine Gruppe der Matrosen nahm sich ein Taxi und Lars, der Schwede, nannte dem Fahrer die Adresse. Dass die „Glenfalloch“ heute eingelaufen war, hatte in der Hafenszene natürlich längst die Runde gemacht. Über welche Kanäle diese Neuigkeiten immer bekannt wurden, hatte Stephen sich schon oft gefragt.
Das Etablissement, zu dem sie sich jetzt auf dem Wege befanden, kannte jeder Westindienfahrer. Es lag nicht im Hafenbezirk, sondern etwas außerhalb der Stadt. In Port of Spain gab es offenbar nicht diese typischen Hafenviertel, wie Stephen sie von den ostasiatischen Häfen her kannte. Das wunderte ihn.
Das Taxi hielt schließlich vor einem großen villenähnlichen Gebäude im Kolonialstil. Die Fenster waren mit schweren roten Gardinen verhängt und ließen keinen Einblick auf das zu, was sich hinter ihnen verbarg. Sie waren überdies in einem hellen Rosa angeleuchtet. Über der hohen zweiflügeligen Eingangstür prangte auf dem Vordach, gestützt von zwei griechischen Säulen, eine knallrote Neonschrift mit dem etwas hochtrabenden Namen „Club Moulin Rouge“. Und dahinter befand sich, wenn auch wesentlich kleiner als ihr Pendant in Paris, eine Nachbildung der in aller Welt bekannten „Roten Mühle“.
Nachdem sie den Fahrer entlohnt hatten, sprangen die vier unternehmungslustigen Seeleute aus dem Taxi und stürmten, beide Flügel aufstoßend, durch die Tür. Der große hohe Raum mit der umlaufenden Galerie wirkte zu dieser Stunde noch recht leer. Es war früh und es schien, als wären sie tatsächlich die ersten Gäste. Eine Handvoll Mädchen lümmelte an der Bar und machte den Eindruck, sich zu langweilen.
Als sie jedoch die hereinstürmende Schar Seeleute erkannten, erwachten sie sehr schnell zum Leben. Sie begrüßten die Neuankömmlinge mit großem Hallo. Tatsächlich schien es Stephen, als ob sie sich wirklich über ihr Kommen freuten. Er staunte immer wieder aufs Neue darüber.
Es folgte ein langer Augenblick innigster Umarmungen, feuriger Küsse und alles das war begleitet von einem ununterbrochenen Plappern und Gekreisch.
In Stephens Gedanken drängte sich die Erinnerung an seine jüngste Rückkehr in seine Heimatstadt auf, nach einem Jahr voller Lebensgefahr und Verzweiflung, in dem einzig sein Band zu Sowenna und die Hoffnung auf ein gemeinsames trauliches Glück seinen Lebensmut befeuert hatten. Kein Jubel hatte ihn begrüßt, kein Glück auf ihn gewartet, nichts als Enttäuschung und Kälte hatten in empfangen.
Er hielt sich zunächst etwas im Hintergrund, aber als die ganze Schar sich nun daran machte, an einem der vielen Tische Platz zu nehmen, nahmen die Mädchen erstmalig Notiz von ihm.
„Oh, ein neues Gesicht!“, rief die eine und: „Was für ein schöner Mann!“, die andere.
Stephen machte das verlegen. Aber gleich darauf wandten sich wieder alle einander zu und es begann ein fröhliches Geplauder und Geplapper, an dem er keinerlei Anteil hatte. Er blieb außen vor.
Stephen merkte schnell, dass in dieser Runde für ihn kein Blumentopf zu gewinnen war und sein Blick wanderte einige Male unauffällig in Richtung Bar. Die Spielregeln beherrschte er und schließlich hatte er sich an diesem Abend darauf eingelassen.
Ein Zwinkern eines der Mädchen, aber Stephen fühlte sich zunehmend unbehaglich. Frauen als Ware zu betrachten, sich eine auszusuchen wie in einem Schaufenster, da sträubte sich in ihm alles.
Seine Freunde waren viel zu beschäftigt, gefangengenommen von ihren Mädchen, als dass sie auf ihn achteten.
Stephen überlegte gerade, wie er möglichst unauffällig aus der Sache herauskommen könnte, als er einer jungen Frau gewahr wurde, die eben aus einer Tür neben dem Tresen heraustrat. Sie betrat nicht einfach nur den Raum, nein, sie wirkte wie eine Erscheinung. Sie trug ein leuchtend rotes, knöchellanges Kleid, eng geschnitten und geschlitzt, was Stephen ein wenig an Hongkong oder Singapur erinnerte.
Das neben diesem Kleid Auffallendste an ihr aber war ihr langes pechschwarzes Haar, das ihr über den Rücken bis zu ihren Hüften herunterhing. Sie schritt mit einem nicht übertrieben aufreizenden Gang zur Bar, setzte sich auf einen der Hocker, schlug ihre langen Beine übereinander und schickte einen scheinbar uninteressierten Blick zu der Gruppe um Stephen; schweifte achtlos über sie alle hinweg, verhielt für den Bruchteil einer Sekunde auf Stephen und kehrte zurück zu ihren Schuhspitzen. Stephen aber hatte das kurze Aufflackern in ihrem Blick, mit dem sie ihn streifte, durchaus bemerkt.
Die anderen hatten sie inzwischen nun auch entdeckt.
„Donnerwetter!“, sagte Brian und Lars, der Schwede, pfiff anerkennend durch die Zähne und sofort erwachte Eifersucht in den Mädchen an ihrem Tisch.
„Die ist noch nicht lange hier bei uns“, meinte eine von ihnen auf eine entsprechende Frage von Brian, „stammt auch nicht von hier.“
„Sie hält sich für etwas Besseres“, fauchte eine andere. Stephen hörte schiere Missgunst aus ihren Worten heraus. Er schoss einen schnellen Blick zu der Rotgekleideten hinüber und wusste im selben Moment warum. Wenngleich er neu war in der Westindien- und Lateinamerikafahrt, schien es ihm, dass sie tatsächlich nicht von hier stammte. Sie mochte vom Festland sein, aus Mexiko oder Kolumbien. Zwar wies ihr Gesicht die weichen Züge der Indiofrauen auf, aber ihre Haut war sehr viel dunkler. Sie erinnerte Stephen an ein Mädchen, das er einst in Manila gesehen, und ihn ebenfalls vom ersten Augenblick an fasziniert hatte.
Inzwischen hatte die Neue ebenfalls Stephens Augenhuscherei bemerkt, machte allerdings keinerlei Anstalten, aktiv seine Aufmerksamkeit zu erlangen. Sie wandte sich ihm zu und schaute ihn nur ruhig an. Da erhob er sich nach einer Weile und schritt zu ihr hinüber.
„Darf ich dich zu einem Drink einladen?“
Sie lächelte ihn freundlich an.
„Gerne!“
„Möchtest du dich vielleicht mit zu uns an den Tisch setzen? Ich möchte meinen Freunden gegenüber nicht unhöflich sein.“
Der Barkeeper mixte ihre Getränke und mit den Gläsern in der Hand schlenderten sie zu seinen Kollegen hinüber. Sie gab ein kurzes Nicken in die Runde und Stephen zog ihr einen Stuhl heran. Michael konnte es sich nicht verkneifen, zu frozzeln.
„Natürlich hat sich unserer Freund Stephen gleich die Schönste ausgesucht.“
Stephen lächelte gutmütig, vergewisserte sich aber mit einem schnellen Blick, dass die Frau in Rot diese Bemerkung ebenfalls mit Wohlwollen aufgenommen hatte.
„Ich bin Stephen“, stellte er sich ihr nun vor, „Stephen Tremaine."
Die Schöne nickte ganz leicht und lächelte.
„Und ich bin Mercedes“, sagte sie und erzählte ihm, dass sie eigentlich aus Caracas stamme. Ihr Englisch hatte einen stark spanischen Akzent. Sie berichtete, dass sie von Kolleginnen von diesem Club hier in Port of Spain gehört habe und dass die Frauen hier zu besseren Bedingungen angestellt seien als drüben auf dem Festland.
„Und?“, fragte Stephen. „Ist es so?“
„Ein bisschen besser“, entgegnete sie und lachte. „Im Grunde sind diese Clubs alle gleich.“ Sie blickte ihn forschend an „Wir müssen leben.“
Stephen spürte eine gewisse Zurückhaltung an ihr, noch mehr von sich preisgeben zu wollen.
„Ich komme aus England“, begann er daher von sich selbst zu erzählen, „aus einem kleinen Fischerort in Cornwall, direkt am Meer.“
„Ist es dort ebenso heiß wie hier?“, fragte Mercedes und er konnte ihre Erleichterung über den Fortgang ihres Gespräches deutlich merken.
„Nein, es ist kalt dort“, gab Stephen zurück und meinte damit nicht allein das Klima.
Sie begann nun, ihm allerlei Fragen zu stellen, wie dort, wo er herkam, das Leben sei, ob er auch aus einer Fischerfamilie stamme.
Während sie so plauderten, hörte man jetzt immer häufiger die großen Flügeltüren gehen und der Saal füllte sich nach und nach.
Zudem waren vier Musiker aufgetaucht, die sich nun auf ihrem Spielpodest einrichteten, das sich vor der Treppe befand, die zur Galerie führte. Es waren zwei Gitarristen, ein Violinist und ein Mann mit einer Harfe. Es dauerte eine Weile, bis sie ihre Instrumente gestimmt hatten, aber als sie nun loslegten, erhoben sich sogleich die ersten Paare, die rings um die Tanzfläche an den Tischen saßen. Da hielt es auch Mercedes nicht mehr auf ihrem Stuhl, sie erhob sich ebenso, streckte beide Arme nach Stephen aus und zog ihn mit sich fort auf die Tanzfläche. Die Band spielte eines dieser romantischen Lieder, an denen Lateinamerika so reich war, und Mercedes schmiegte sich beim Tanzen fest an ihn. Stephen fühlte sich nach langer, langer Zeit endlich einmal wieder leicht und frei. Natürlich machte er sich nichts vor, er war sich durchaus bewusst, wo er sich hier befand, aber es war so unsagbar schön, sich einfach gerade vollständig und bedingungslos der Wärme einer Frau in seinen Armen und einer träumerischen Stimmung hingeben zu können.
Dreimal hintereinander tanzten sie zu den traurigschönen Liedern, bevor sie wieder ihren Tisch aufsuchten. Stephen holte neue Getränke für sich und Mercedes und versuchte sich darin, an der Unterhaltung teilzunehmen, die seine Freunde und die Mädchen fröhlich lachend führten. Es gelang ihm nur halbwegs und er merkte sehr bald, wie platt seine Reden klangen. Auch Mercedes nahm nur zögernd an ihrer Konversation teil, aber das war wohl kein Wunder.
Erstens war sie neu hier und zweitens war ja deutlich zu merken, dass das Englische nicht ihre Muttersprache war. Stephen wurde einfach nicht warm in dieser Runde. Wieder einmal hatte er das Gefühl, außen vor zu sein. Es tröstete ihn ein wenig, dass es seiner Gefährtin auch nicht besser ging als ihm.
Als er sich ein wenig umschaute, stellte er fest, dass nun so nach und nach ein Paar nach dem anderen für eine längere Zeit verschwand. Stephen konnte beobachten, wie sie zu zweit zusammen die Treppe hinaufstiegen, die zur Galerie führte, und dort oben hinter einer der Türen verschwanden. Auch seine Kollegen taten dies, einer nach dem anderen, mit ihrer Begleitung. Am Ende befanden sich Mercedes und Stephen allein am Tisch. Er knetete seine Finger, während sie von Ratlosigkeit ergriffen wurde.
Die Anwesenheit in diesem Etablissement folgte klaren Regeln und Übereinkünften – worauf wartete er? Stephen suchte nach Worten, bis er sich schließlich durchgerungen hatte. Er neigte seinen Kopf dicht zu seiner Partnerin und flüsterte:
„Mercedes …“, seine Stimme wurde ein wenig krächzend, „ich möchte gern eine ganze Nacht mit dir verbringen.“
Sie blickte ihn ein wenig spöttisch an.
„Kannst du dir denn das auch leisten?“
Sie schaute ihm eine lange Weile in die Augen und nannte schließlich ihren Preis. Stephen musste nun doch schwer schlucken. Es würde nahezu seinen gesamten Vorschuss auffressen, den er sich beim Zahlmeister hatte geben lassen.
Andererseits, unbezahlbar war es nicht.
Er nickte.
Jetzt lächelte sie ihn warm an:
„Okay“, sagte sie, „ich kann hier allerdings frühestens um elf weg. Normalerweise bleibe ich bis zwei. Aber wir sind hier relativ frei, ich kann auch mal drei Stunden früher gehen“, sie machte eine Pause, „… wenn die Einnahmen stimmen.“ Fragend blickte sie ihn an. „Und nun muss ich dich allerdings allein lassen. Ich bin hier schließlich angestellt, um Geld zu verdienen.“
„Ich will’s versuchen“, erwiderte er ihr mit einem schiefen Grinsen.