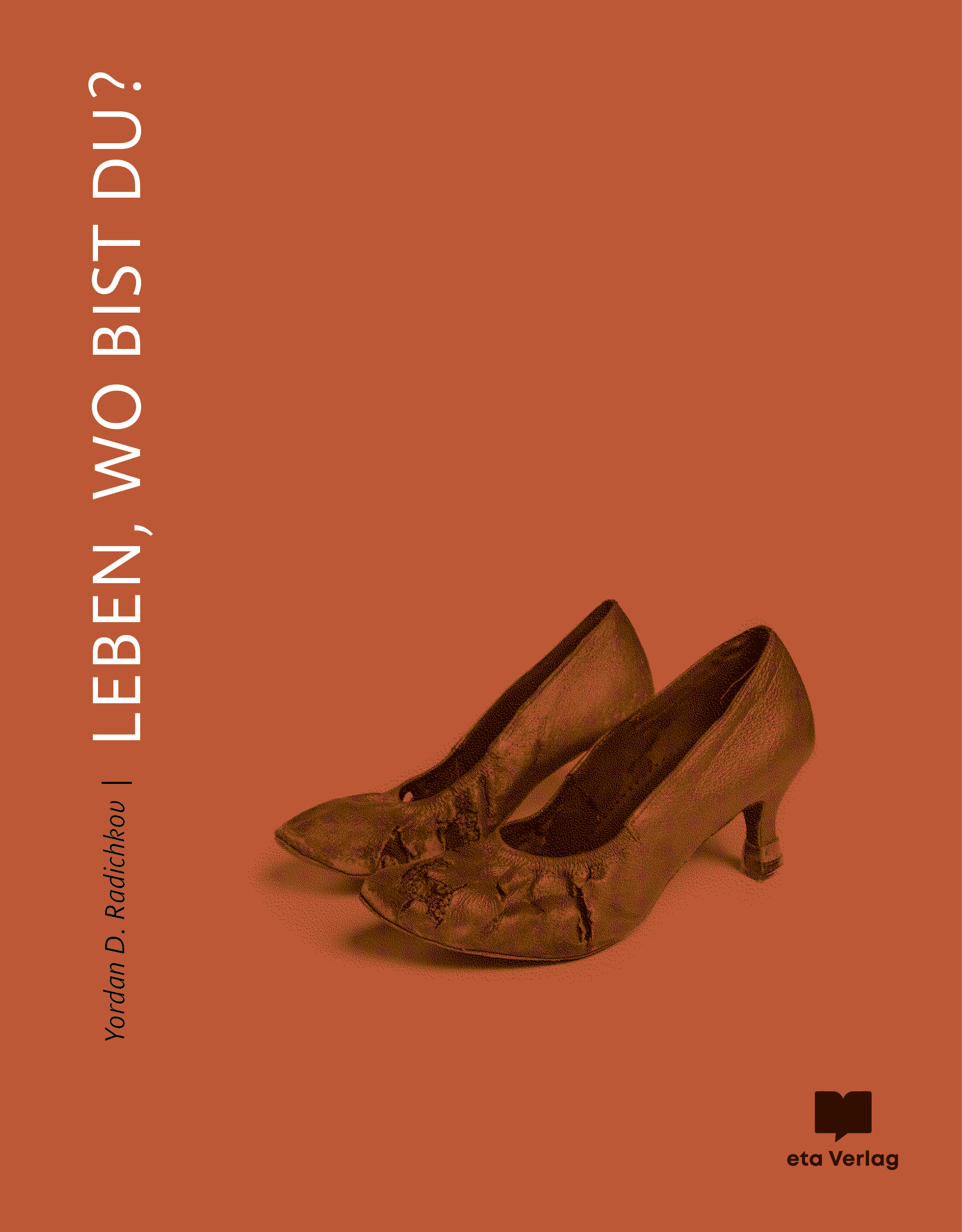
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: eta Verlag
- Sprache: Deutsch
Leben, Tod und Teufel sind die Helden in diesem Erzählband. In manchen Erzählungen geht das Leben verloren, man muss es suchen, ihm nachlaufen und es finden, als sei es ein Hund oder ein anderes Haustier. Der Tod und der Teufel wiederum laufen den Menschen unentwegt nach, folgen ihnen auf Schritt und Tritt und lauern deren Schwächen auf, den Fehlern, die sich als fatal erweisen könnten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1. Auflage 2019 © eta Verlag Alle Rechte vorbehalten
www.eta-verlag.de Petya Lund [email protected] Schönhauser Allee 26 10435 Berlin
Übersetzung aus dem Bulgarischen: Elvira Bormann-Nassonowa Lektorat: Elvira Veselinović Gestaltung & Satz: Stefan Müssigbrodt
ISBN 978-3-9820030-4-7
Die Herausgabe dieses Buches erfolgte mit freundlicher Unterstützung des Übersetzungsprogramms des bulgarischen nationalen Kulturfonds
Eine kleine Menschen-Melodie
Auf der Welt gibt es allerhand talentierte Nachtigallen, und auch deren Lieder sind zahlreich. Nachtigallen schwingen sich in aller Ruhe durch die Lüfte, beschauen sich die Erde aus ihrer Vogelperspektive und verstreuen ihr Federkleid und ihren Gesang in alle Ecken und Enden des Planeten. Vielleicht bis auf jene Gegenden, in denen es zu kalt für Vogelfüße ist, aber auch dort wird sich wohl eine weniger frostempfindliche Nachtigall finden, sie wird über die Tundra fliegen, durch den Schnee laufen und ihr Lied in der endlosen weißen Einöde erschallen lassen. Denn Lieder wird es immer und überall geben. Und wenn es nur ein kümmerliches menschliches Vor-sich-hin-Pfeifen ist.
So sprach mein Vater einige Tage, bevor er starb. Wir alle dachten, dass die Pillen nun endlich anschlugen. Was sollte das jetzt mit den Nachtigallen und Liedern? Mein Vater war Hilfsarbeiter und von Vögeln hatte er keine Ahnung. Über Ornithologen hatte er sich immer lustig gemacht, schon allein mit dem Wort Ornithologe hatte er seinen Spott getrieben. Er saß da und feixte: »Was sind das nur für komische Leute, diese Ornithologen? Sitzen den ganzen Tag mit ihren großen Ferngläsern herum und starren auf Vögel. Was gibt’s bei diesen Vögeln schon zu sehen? Sie fliegen und schnattern und weiter nichts, und der da kriegt sogar noch Geld vom Staat dafür, dass er Vögel anglotzt!« Und dann folgte eine Schimpftirade auf den Staat.
Woher der Schlaganfall kam, der meinen Vater niederwarf, wusste niemand. Er rauchte nicht, gehörte somit keiner direkten Risikogruppe an, hat sich nie beim Denken übernommen und dennoch war er plötzlich ans Bett gefesselt. Und einige Tage, bevor er von uns ging – Friede seiner Asche – erzählt er mir unaufhörlich etwas von Nachtigallenliedern. Er redet und lächelt. Er schaut mir ins Gesicht, ohne es zu sehen. Schaut zu meiner Mutter, doch auch sie sieht er nicht. Er starrt die Nachtigallen an und träumt von ihnen, versucht, ihren Gesang nachzuahmen.
Zusammengeschrumpft liegt er auf der Stahlmatratze, in Mutters strahlend weiße Laken gehüllt, setzt sich auf und versucht, die Backen aufzublasen. Er spitzt seine ausgetrockneten Lippen und presst die Luft heraus. Dadurch scheint sein Gesicht noch schmaler zu werden. Er hat bereits keine Luft mehr in sich und auch keine Wangen mehr. Die Augen liegen ihm tief in den Höhlen und an der Oberfläche bleibt nur die kalte, blaue Flamme des in ihm schwindenden Lebens.
»Du wirst sie suchen, mein Junge, und du wirst sie finden. Und selbst, wenn du nicht auf mich hörst, sie wirst du hören und du wirst sehen, wie weit der Gesang reicht. Und nun ab zu den Nachtigallen.«
Und damit tat er seinen letzten Atemzug. Tagelang weinte ich wie ein kleines Kind. Während dieser ganzen Zeit versteckte ich mich im Keller, in der Küche oder auf dem Boden, weil Mutter mich nicht so sehen sollte. Sie war am traurigsten, und ich sollte ihr Halt geben, während die Verwandten kamen und gingen. Sie schauten meinen toten Vater an, bekreuzigten sich, tranken einen Schnaps, auf dass Gott ihm seine Sünden vergebe, und ließen uns wieder allein. Das Haus verstummte.
Nur das leise Knarren der Türen war zu hören. Wenn jemand im Haus stirbt, pflegte meine Großmutter zu sagen, kehrt er in den darauffolgenden Tagen mehrmals zurück, um zu schauen, ob er nicht etwas vergessen habe. Genau, es war Vater, der die Türen knarren ließ. Und ich hörte es nicht, weil ich mich im Keller versteckte. Nur mein heftiges Atmen hörte ich, und wie Mutter oben in der Bodenkammer schluchzte. Ich versteckte mich vor ihr und sie versteckte sich vor mir. Weshalb wir nicht zusammen losheulten, ist mir nie klargeworden. Ich vermute, dass jeder Kummer, auch der in der Familie, eine zutiefst private Angelegenheit ist. Sogar die solidarischsten Gesellschaften mit dem höchsten Grad an Zusammenhalt weinen bisweilen allein. In aller Stille.
In den darauffolgenden Tagen klebte diese Stille im Haus, sie klebte an meinen Sohlen und in meinen Worten. Nicht von ungefähr sprach man von Totenstille. Da geht jemand von uns, und die Natur verstummt. Auch Nachtigallen sind nicht zu hören. Nur ein Vor-sich-hin-Pfeifen. Ich war sehr verwundert. Zunächst dachte ich, dass ich mir dieses Geräusch nur einbildete.
Ich gehe hinaus auf den Hof und erblicke in der Ferne eine Gestalt. Einen Mann. In einem weißen Anzug. Nie habe ich einen weißeren Anzug gesehen. Nicht einmal auf der Hochzeit meiner Schwester hat jemand etwas so Weißes getragen.
Dabei prahlte meine Großmutter damit, dass ihre Schürzen, Schleier usw. die weißesten seien. Wie es nur Großmütter tun, sie wissen schließlich alles. Doch vom weißen Anzug dieses Mannes hatte noch keine Großmutter je etwas gehört. Höchstens in ihren Großmutter-Träumen hatten sie schon einmal ein so weißes Hemd wie das jenes Mannes gesehen.
Und dieser schreitet höchst poetisch und gemessen, mit der ganzen Ernsthaftigkeit und Unanfechtbarkeit seines weißen Hemdes den Weg entlang und kommt näher. Als er vor mir steht, nimmt er seinen Zylinder ab und lächelt sein weißestes Lächeln, er sagt kein Wort zum Gruß, sondern pfeift weiter vor sich hin, eine wahre Nachtigall. Er grüßt nicht nur mit seinem Lied, sondern auch mit dem Blick. Mit seinen lebhaften Augen, seltsam nur, dass sie grau sind. Andererseits – so seltsam ist es nun auch wieder nicht. Wir wohnen in einem kleinen Weiler und haben noch nie Augen aus der Stadt gesehen. Wir kennen nur die aus dem Dorf. Diese können häufig braun-grün-blau sein, niemals aber grau.
Da geht nun also dieser Herr mit den grauen Augen und dem weißen Zylinder direkt an mir vorüber und begrüßt mich auf die musikalischste Weise. Schon ist er vorbei, doch sein Pfeifen bleibt stehen. Es ist vor mir, so greifbar, dass ich mir ganze Hände voll davon abschöpfen kann. Und ich nehme mir. Ich packe ein wenig Pfeifen in meine Hosentasche und denke an Vater.
Ob auch er an mich denkt? Ich weiß nicht, aber ich weiß, dass ich Lust habe zu pfeifen. Pfeifend gehe ich los. Ich habe eine Melodie in der Tasche und muss nicht fürchten, dass ich sie falsch pfeife. Schließlich erfinde ich sie selbst. Ich gehe und lasse das Pfeifen hinter mir zurück.
Ich weiß nicht, warum – aber wo auch immer ich mit meiner Melodie entlangkomme, setzt jemand sie fort. Er verzerrt sie auf seine Weise: wo tiefe Töne waren, bringt er hohe; statt die Klangluft auszuatmen, atmet er sie ein, verschluckt sich an ihr und setzt die Melodie auf eigene Art fort. Ein anderer wiederum saugt sie ein, und sobald er anfängt, pfeift er sie kurz und klein.
Ich dagegen halte meine Melodie. Meine Melodie ist nicht kompliziert, mein Lied ist nicht wie Vogelgesang. Es ist immer gleich und gehört nur mir. Vielleicht machen deshalb auch die anderen ihre eigenen Melodien. Damit auch sie eine Melodie haben, die sie pfeifen können.
Und sie hören nicht auf damit. Da greift einer die Melodie bei der Feldarbeit auf, sie überträgt sich auf die Kornähre, dringt ins Brot, und jene Stadtmenschen, die das Brot kaufen, brechen es mit ihren hungrigen Händen und führen unsere kleine, kümmerliche Melodie weiter, zwirbeln sie nach Städter Art, machen sie zu ihrer und schmausen weiter, nun aber mit einem Lied auf den Lippen.
Oder mit einer Melodie. Wenn sie ihre Wohnungen verlassen, pfeifen sie weiter. Bald pfeift die ganze Stadt. Ich traue meinen Augen nicht – so stark ist diese Melodie in meiner Tasche, die der Mann mir geschenkt hat, dass sie ganze Städte berauscht?
Von der Stadt gerät sie auf den Gleisen bis zum Bahnhof, und schon verlässt die Melodie die bulgarischen Lande. Sie schlängelt sich mit den Wagenreihen der Eisenbahn ins Unendliche und kommt bis ans Ende der Welt. Binnen kurzem höre ich ein Pfeifen aus allen Ecken und Enden der Erde. Und alle gieren danach zu pfeifen, machen sich ihre Melodie und nehmen diese mit auf ihren Weg.
Ich denke an meinen Vater und frage mich, ob er jenen Mann mit dem weißen Zylinder gekannt oder nur angenommen hat, dass dieser eventuell durch unseren Weiler kommen könnte. Ich glaube nicht, dass mein Vater so weit vorausblickte, er hätte sich wohl kaum vorstellen können, dass sich die ganze Welt einmal etwas von meiner Melodie abpfeifen wird.
Dabei ist es eine ganz einfache. Ich vermute, auch die Melodie meines Vaters war ähnlich geartet. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass sie bis in die Tundra gelangt ist. Und dort, in der Tundra, hockt eine Nachtigall in der Schneewehe, hört das Pfeifen meiner Familie und hält sich den Bauch vor Lachen, weil diese unsere kleine Menschen-Melodie so spröde und simpel ist.
Meine Vergangenheit steckt in der Tasche des Unbekannten
Ich vergaß, worüber ich gerade mit meinem Kumpel geredet hatte, als ich jemanden hinter uns bemerkte. Ich drehte mich um und sah hinter mir lediglich den Gebirgspfad, auf dem wir die letzten zwei Stunden gegangen waren. Auf unserem gesamten Weg haben wir niemanden zu Gesicht bekommen außer ein paar Vögeln und den Bäumen, die den Pfad zu beiden Seiten säumten. Wir waren in Gespräche vertieft darüber, wie gut es tut, in die Berge und an die frische Luft zu gehen, dass es in der Stadt fast nichts Echtes mehr gibt, und wir waren gerade so weit gekommen, dass es nicht einmal mehr echte Freunde gibt, als in meinem Rücken der kalte Verdacht aufkam, dass jemand hinter uns geht.
Dass er nicht einfach hinter uns geht, sondern uns verfolgt.
»Was ist passiert, Mischa? Hast du etwas verloren?«
Ich sagte zu meinem Kumpel, dass ich nichts verloren habe, sondern es mir so vorgekommen sei, als ob uns jemand verfolgte. Er fragte mich, ob ich etwas gesehen habe, und ich versuchte mich zu erinnern, ob ich vielleicht tatsächlich für den Bruchteil einer Sekunde eine menschliche Gestalt oder Tiere gesehen hätte. Vor meinem geistigen Auge tauchte eine schmale Hand mit langen, schmalen Fingern auf, weißer als die verschneiten Gipfel vor uns.
Mein Kumpel lachte heftig über diese Geschichte und sagte, ich sei ja wohl nicht normal, und dies alles spiele sich nur in meinem Kopf ab. Genau das sagte er:
»Mischa, du bist doch nicht normal! Das alles läuft in deinem Kopf ab. Mann, da geht der zum ersten Mal seit hundert Jahren in die Berge und gleich wird ihm schlecht wegen des Sauerstoffs.«
Ich tat es meinem Kumpel gleich und lachte, dann schwafelten wir weiter über unsinniges Zeug, während wir bergauf gingen. Auch wenn es schon langsam kühler wurde, war es uns gelungen, die vielleicht letzten Sonnenstrahlen für die nächsten Monate zu erhaschen, und das Wetter war wirklich sehr schön. Wir hatten keinerlei Pläne für die nächsten Tage und leisteten uns dieses Ausbrechen – einfach so zu zweit, um uns zu entspannen und zu labern.
Es ist immer nett, mit Leuten zu plaudern. Je mehr Unsinn geredet wird, umso wahrscheinlicher ist es, dass sich die eine oder andere Wahrheit auf leisen Sohlen zwischen die Worte schleicht und dich angrinst, dass du weiterredest, sie zwar musterst, aber nicht aufhörst zu reden, dass du sehr erstaunt bist, sie irgendwo in dir bewahrst und dass sie dir in einem unerwarteten Moment nützlich ist.
»Es wird Zeit, ins Dorf hinunter zu gehen!«, sagte mein Kumpel und wir zuckelten beide den Hang hinunter; dabei lachten wir weiter und sagten, es sei durchaus möglich, dass ich etwas gesehen hätte, denn in diesem Wald lebten zahlreiche Geister, selbst ein Drachen lebte darin, und sie alle täten das seit Menschengedenken, seit der Zeit unserer Urgroßmütter.
Mitten in unserem Gelächter stellte sich uns auf einmal ein großer Schäferhund in den Weg, beinahe war er schon an uns vorbeigelaufen, doch aus irgendeinem Grund machte er kehrt, baute sich vor uns auf, fletschte die Zähne und fing an zu knurren. Mein Kumpel war ziemlich erschrocken und bat mich, keine heftigen Bewegungen zu machen und wenn möglich den Stein zu nehmen, der hinter meinem Fuß läge, und damit auf den Hund einzuschlagen. Auch ich hatte gehörig Schiss und wandte ein, dass er, wenn er etwas wolle, dies schon selbst tun müsse, statt mich darum zu bitten, dieser Angsthase.
Bevor wir aneinandergerieten, tauchte der Schäfer auf und rief seinem Hund sofort zu:
»Iwan! Lass die Leute in Ruhe! Der Teufel soll dich holen, du Sauhund!« Damit stürzte sich der Schäfer auf den Hund und versetzte ihm einen solchen Fußtritt, dass dieser sich winselnd davonmachte und sich nicht einmal mehr umschaute, ob der Schäfer weiter mit Tritten hinter ihm her war oder von ihm abgelassen hatte.
»Entschuldigen Sie, meine Herren, das ist nur ein simpel gestricktes Tier. Es ist nicht wie wir Menschen. Wir Menschen können reden, deshalb erweist Gott uns seine Gnade, wir haben die Gnade, uns zu verständigen und in keiner Situation ohne Hosen dazustehen, sondern unsere Würde zu bewahren.«
Diese Worte verwirrten uns, hatten sich mein Freund und ich doch schon gegenseitig beleidigt; wir bedankten uns bei dem Schäfer und wünschten ihm einen guten Tag. Zum Abschied winkte er uns müde, mit dem Blick eines Menschen, der vielleicht auf ein kurzes Gespräch gehofft hatte. Doch in jenem Augenblick fühlten wir uns wie Kinder und waren innerlich sehr aufgewühlt.
Im Dorf angekommen, baten wir uns gegenseitig um Verzeihung, gingen noch ein Bier trinken, tranken es aus, aber es gelang uns nicht, die gute Stimmung wiederzuerlangen, deshalb änderten wir unseren Plan – statt diese Nacht noch dazubleiben, wollten wir gleich in die Stadt zurückkehren.
Mein Kumpel bot mir an, mich im Auto mitzunehmen, doch ich lehnte ab – ob aus Stolz oder um Mut zu beweisen, aus Dummheit oder weil ich müde war, kann ich nicht sagen. Mit meinem Gepäck in der Hand stand ich wie ein Idiot vor seinem Wagen und murmelte etwas wie – ich sei schon lange nicht mehr mit dem Zug gefahren und dies sei jetzt die beste Gelegenheit dazu.
Mein Kumpel dampfte ab und ich machte mich auf den Weg zum Bahnhof. Ich sah auf die Uhr und stellte erleichtert fest, dass mir noch mindestens zwei Stunden Tageslicht blieben. Die Zugfahrt würde also keine Zeitverschwendung sein.
Immerhin würde ich die kleinen Dörfer sehen mit ihren noch kleineren Schafen, die höchst poetisch das kleine Gras unseres kleinen bulgarischen Bodens wiederkäuten; und das bewirkte, dass ich mich besser fühlte.
Ich war am Bahnhof angelangt, er war menschenleer. Vielleicht wegen der späten Stunde, vielleicht weil es ein Wochentag war oder vielleicht sahen alle Bahnhöfe in allen kleinen bulgarischen Dörfern so aus – ohne eine Menschenseele, mit abgeblättertem Putz, ein wenig trist, aber frisch und munter – von jener Munterkeit, die nur der offene Schienenweg aufzuweisen hat, der einem auf der einen Seite ein Gefühl von Unendlichkeit gibt, auf der anderen Seite die Annehmlichkeit von etwas, das man wie seine Westentasche kennt, möglicherweise etwas, das mit der Kindheit zu tun hat.
Ich ging zur Kasse, wo die Verkäuferin eine Zeitung las, in der zweifelhafte Ratschläge zur Instandhaltung der Lunge mittels einer Schachtel Zigaretten gegeben wurden und dazu, wie wir in zwei leichten Schritten unser Baby allein zur Welt bringen konnten.
»Was wollen Sie?«, fragte mich die Verkäuferin, ohne die Augen von der Zeitung zu lösen.
»Eine Fahrkarte.«
»Also, wollen Sie eine Fahrkarte? Oder zwei? Oder wollen Sie vielleicht alle Fahrkarten? Wohin wollen Sie, wollen Sie heute fahren oder morgen – sehen Sie, all diese Dinge haben mit Ihrer Fahrkarte und Ihren persönlichen Angelegenheiten zu tun.«
Ich war überrascht, dass eine alte Fahrkartenverkäuferin wie sie einen so akkuraten Durchblick hatte, ich lächelte und sagte, dass ich zu meinem Bedauern nicht alle Fahrkarten kaufen würde, da ich nicht zu einer Weltreise aufgebrochen sei, sondern lediglich in meine elende Stadt zurückkehren wolle, um weiter mein elendes Leben zu leben.
»Das ist Ihre elende Sache.«
Da fingen diese Verkäuferin und ich an zu lachen und konnten gar nicht mehr aufhören. Dann sah sie mich streng an, kam hinter der Scheibe hervor und setzte sich neben mich auf die Bank, auf die ich mich mittlerweile zurückgezogen hatte.
»So dürfen Sie nicht über die Stadt reden. Wissen Sie nicht, dass alle unsere Kinder nur von ihr träumen? Sie reden nur von der Stadt, den Mädchen, den Diskotheken dort. Sie gehen in die Stadt und vergessen uns ein für alle Mal. Und weil es bei uns nichts gibt, verzeihen wir den Kindern. Wir leiden sehr, aber was sollen wir machen? Wenn sie in die Stadt wollen, dann gehen sie auch in die Stadt.«
»Vielleicht ist es ja nicht ganz so schlimm, manch einer könnte ja doch zurückkommen?«
»Wann sollte das denn passieren?«, schaute mich die Verkäuferin ganz zärtlich und verständnisvoll an. »Schau mal, mein Junge, meine Kinder sind vor zig Jahren in die verdammte Stadt gegangen. Die Jahre vergehen, die Zeit bleibt nicht stehen – denkst du, ich sei mein ganzes Leben so aufgedunsen gewesen? Weißt du, wie hübsch ich mal war? Aber es ging ja um die Zeit. Die Zeit geht einfach so an uns vorüber, und die Vergangenheit gehört uns nicht mehr. Ist sie einmal vorbei, bleibt uns nur noch der Augenblick der Gegenwart.
Jetzt zum Beispiel, siehst du, da sitzen wir beide in diesem kleinen Bahnhof in diesem kleinen elenden Land, und nur das haben wir. Wir haben kein Gestern, das gehört uns nicht mehr.
Das hat der Tod geholt und wird es nie mehr hergeben, verstehst du mich, mein Junge? Er wird es uns nie zurückgeben!
Dabei liegt uns auf der Zunge zu sagen, dass wir immer ein Morgen haben werden, dass wir stets unsere Träume von einem besseren Morgen haben werden, doch was ist, wenn du morgen tot aufwachst? Tja, dann wirst du nicht mehr draußen herumlaufen! Dann bleibst du im Bett, wartest darauf, dass alle vorbeikommen und um dich weinen, rührst dich nicht, danach wirst du verscharrt und das war’s.
Du und ich, wir haben nur diese Bank und deinen Zug, der Verspätung hat. Und der Zug hat sowieso jedes Mal Verspätung. Jedes Mal hat er Verspätung, und wir sind immer zu früh da – aus Angst, ihn zu verpassen. Drehen wir uns um, sehen wir ihn nicht mehr. Und die Wahrheit ist, dass wir nichts von unseren Leben hinter uns sehen, nur verschwommene Gestalten, die wir bestaunen wie Affen, und uns ist nicht klar, dass der Sensenmann sie sich schon längst geholt hat, sie in das Album mit unserem Namen geklebt hat und ab und zu darin blättert – vielleicht sind genau das die Momente, in denen man sich an etwas erinnert.«





























