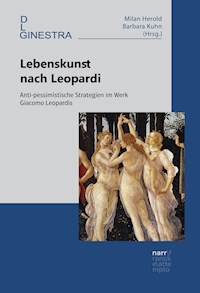
Lebenskunst nach Leopardi E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ginestra. Periodikum der Deutschen Leopardi-Gesellschaft
- Sprache: Deutsch
Leopardis Dichtung und Philosophie werden gemeinhin als ausschließlich oder doch überwiegend pessimistisch beschrieben, obgleich der Autor selbst sich wiederholt gegen eine solche vereindeutigende und reduktive Lektüre aussprach. Tatsächlich lassen sich immer wieder in seinem Werk anti-pessimistische Strategien entdecken, etwa, wenn Leopardi über die Wirkung eines "pezzo di vera, contemporanea poesia" schreibt: "essa aggiunge un filo alla tela brevissima della nostra vita" (Zibaldone 4450). Der Band leistet einen facettenreichen Beitrag zur Überwindung des ‹Stereotyps des Pessimismus› (Antonio Prete), das noch immer die Rezeption des ungleich vielfältigeren Werks dominiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 571
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Barbara Kuhn / Milan Herold
Lebenskunst nach Leopardi
Anti-pessimistische Strategien im Werk Giacomo Leopardis
Narr Francke Attempto Verlag Tübingen
Umschlagabbildung: Ausschnitt aus Sandro Botticelli, La Primavera, 1482. Bildquelle: commons.wikimedia.org/wiki/File:Botticelli-primavera.jpg
Gedruckt mit freundlicher Unterstützung des Romanischen Seminars der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.
ISSN 1436-2260
© 2020 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen www.narr.de • [email protected]
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-8233-8416-8 (Print)
ISBN 978-3-8233-0278-0 (ePub)
Inhalt
Zeit, Gesang und Lebenskunst
Zur Frage einer «arte del vivere» nach Leopardi Einführende Überlegungen
Tempo, canto e arte del vivere
Modi e concetti di un’«arte del vivere» leopardiana Riflessioni preliminari
Della lettura di un pezzo di vera, contemporanea poesia, in versi o in prosa […], si può, e forse meglio, (anche in questi sì prosaici tempi) dir quello che di un sorriso diceva lo Sterne; che essa aggiunge un filo alla tela brevissima della nostra vita. Essa ci rinfresca, p. così dire; e ci accresce la vitalità.
(Zibaldone 4450, 1. Feb. 18291)
Und wie seltsam wird das Phrasengeräusch der Pessimisten von der Nichtigkeit der Welt übertönt durch dieses memento vivere ihres größten Dichters!
(Paul Heyse2)
«Kennen Sie Leopardi, Ingenieur, oder Sie, Leutnant?» Nicht von ungefähr stellt in Thomas Manns 1924 erstmals in Buchform erschienenem Zauberberg Lodovico Settembrini diese Frage an Hans Castorp und dessen Vetter Joachim. Offenbar konnte der Italiener solche Kenntnis nicht voraussetzen, denn er fährt fort: «Ein unglücklicher Dichter meines Landes, ein bucklichter, kränklicher Mann mit ursprünglich großer, durch das Elend seines Körpers aber beständig gedemütigter und in die Niederungen der Ironie herabgezogener Seele, deren Klagen das Herz zerreißen. Hören Sie dieses!», und man kann sich fragen, was Settembrini dann wohl vor den beiden Herren, die ihn nicht verstehen, rezitiert, bevor er weiter über den «Krüppel Leopardi», über die «Verkümmerung seiner Seele» und sein «[V]erzweifel[n] an Wissenschaft und Fortschritt»3 räsonniert: vielleicht A se stesso, An sich selbst, in dem dem Ich die Welt nur mehr wie Schlamm erscheint, «e fango è il mondo» (v. 10)? Vielleicht die ironischen «magnifiche sorti e progressive» aus La ginestra (v. 51 [die «großartige[n] und fortschrittliche[n] Geschicke»])? Oder vielleicht Sapphos letzte[n] Gesang, den Ultimo canto di Saffo, ehe die unglückliche Dichterin sich – möglicherweise – vom Leukadischen Felsen stürzt?
Die Spekulation über das ungeschriebene Tun einer Romanfigur braucht nicht fortgeführt zu werden; sie ist ebenso müßig wie die Suche nach einer Antwort auf die Frage, ob Settembrini möglicherweise die Operette morali, vor allem den Dialog zwischen der Natur und einer Seele, allzu schlicht und unmittelbar auf deren Schöpfer bezogen hat, wenn er von Tragik spricht und von der grausamen Natur, die «einen edlen und lebenswilligen Geist mit einem zum Leben nicht tauglichen Körper verband» und so die «Harmonie der Persönlichkeit» gebrochen oder «von vornherein unmöglich»4 gemacht habe. Zu erwägen ist aber dennoch die Frage, warum Settembrini diese Frage überhaupt stellen muß und zudem, offenbar zu recht, davon ausgeht, daß seine deutschen Zuhörer den berühmten italienischen Dichter nicht kennen, denn dieser Befund, der hier im Rahmen der Fiktion knappe 100 Jahre nach der Entstehung von Leopardis Texten angestellt wird, scheint auch weitere knappe 100 Jahre später in Teilen immer noch zuzutreffen, wenn etwa noch in einer 2002 erschienenen Dissertation statt von einer «fortuna di Leopardi in Germania» nur von einer «sfortuna» zu lesen ist, von Mißgeschick und Unglück, und dies konkretisiert wird in den Worten:
Im Falle Leopardis ist die merkwürdige Situation zu konstatieren, daß über einen Autor der hierzulande traditionell so beliebten italienischen Kultur und Literatur, der in seinem Heimatland ähnlich aufbereitet ist wie in Deutschland Goethe, Kafka oder Thomas Mann […], auch nach zweihundert Jahren vor allem Klischees kursieren.5
Doch nicht nur im deutschen Sprachraum existieren solche Klischees, existieren jene Schubladen, in die Leopardi oft vorschnell gesteckt wird, auch wenn hier möglicherweise das eine oder andere Mißverständnis in Übersetzungen und Deutungen des komplexen Werks eine zusätzliche Rolle spielen mag6 und auch wenn insbesondere das große Interesse Schopenhauers, der glaubte, in dem Dichter aus Recanati einen Geistesverwandten gefunden zu haben, die Rezeption vor allem, wenngleich keineswegs nur7 hierzulande in eine spezifische Richtung lenkte. Die wichtigste und beliebteste Schublade, die bis in die Gegenwart immer wieder dazu dient, diese Texte in ihrer Komplexität, ihrer Offenheit und Vieldeutigkeit weniger zu erschließen, als zu verbergen, indem sie ihnen, statt Offenheit und Vieldeutigkeit zuzulassen, ein einheitliches Etikett aufklebt und sie so teilweise bis zur Unkenntlichkeit reduziert,8 ist eben die des angeblichen, gleichsam mantraartig wiederholten und daher schon fast legendären Pessimismus, der in seinen diversen Spielarten durch viele Publikationen geistert. So ist etwa die Rede von einem individuellen oder psychologischen Pessimismus, in einer nächsten Phase von einem historischen Pessimismus, die schließlich gar gekrönt werde von einem allumfassenden kosmischen Pessimismus in den letzten Lebens- und Schaffensjahren – aber ganz gleich, welche Facette gewählt wird, sie reduziert stets das vielgestaltige und vieldeutige Werk Leopardis auf die eine und in sich schon reduktive Dimension: auf jenes Stereotyp des Pessimismus, das einem sich unaufhörlich verändernden Dichten, einem Denken in ständiger Bewegung nicht gerecht werden kann.9
Ein Text, der nicht nur besonders häufig Gegenstand der Forschung geworden ist, sondern zudem vielfach mit der beliebten Pessimismus-Formel bedacht wurde, ist Il passero solitario, der daher besonders geeignet scheint, um in einführenden Überlegungen der Frage nach möglichen anti-pessimistischen Strategien und nach jener spezifischen Lebenskunst nachzugehen, von der Leopardi im 79. seiner Pensieri handelt: jener Frage, der sich auch der 30. Leopardi-Tag der Deutschen Leopardi-Gesellschaft vom 18. bis zum 20. Juli 2019 an der Universität Bonn, dem Gründungsort der Gesellschaft, in einer Vielzahl von breit gefächerten Vorträgen, Diskussionen und einer Lesung von Burkhart Kroeber aus seiner Übersetzung der Operette morali widmete. Denn einmal mehr zeigt sich auch und gerade im Passero solitario, daß entgegen der verbreiteten Forschungsmeinung, die versucht, den Text bruchlos mit der Pessimismus-These zu verknüpfen, eine genaue Lektüre des Gedichts, die auf dieses vermeintliche Geländer verzichtet und sich statt dessen auf den Text selbst einläßt, anderes sichtbar zu machen vermag als nur die erneute Bestätigung des allzuoft Wiederholten10.
Anders als in der großen Mehrzahl der dem «Passero» gewidmeten Beiträge der Forschungsliteratur, die vor allem anderen und immer wieder den Fragen der Entstehungszeit des canto, seiner Quellen und der mit dem «passero solitario» gemeinten Vogelart nachging11, nähern sich die hier vorgeschlagenen Überlegungen dem Gedicht von einigen anderen Vögeln im Werk Leopardis her an, die die mit den fliegenden und singenden Wesen verknüpften Konnotationen in Erinnerung rufen und so die Lektüre des Gedichts, statt primär durch bisherige Forschungsbeiträge, durch die Bilder-, Klang- und Gedankenwelt des Leopardischen Werks grundieren.
I. Leopardis Vögel
Während in Alla primavera o delle favole antiche der «Musico augel»1 oder «sangeskundige[…] Vogel […] die Rückkehr | des Frühlings», «il rinascente anno» (v. 71sq.), in «klangreichen Lieder[n]» besingt, die, anders offenbar als die Lieder dieses hier singenden Ich, keine Klagelieder sind, nicht aus dem Schmerz entstehen («quelle tue varie note | Dolor non forma», v. 78sq.), vermißt die unglückliche Dichterin Sappho gerade den «canto | De’ colorati augelli», der «me non […] saluta» (Ultimo canto di Saffo, vv. 29–31 [«Mich begrüßt nicht | der farbigen Vögel froher Gesang»]): Noch in der Negation durch das lyrische Ich hebt das Gedicht so das herausragende Charakteristikum der Vögel desto stärker hervor: Vor allem anderen singen sie, und kaum ist der Sturm vorbei, singen sie schon wieder, wie das berühmte Incipit von La quiete dopo la tempesta erinnert: «Passata è la tempesta: | Odo augelli far festa» (v.1sq. [«Vorüber ist das Gewitter. | Vögel höre ich jubeln»]).2 Entsprechend scheint diesen gefiederten Wesen ein leichteres Leben vergönnt, wie auch der Hirte im Canto notturno di un pastore errante nell’Asia oder Nachtgesang eines Hirten, der in Asien umherstreift, sich vorstellt:
Forse s’avess’io l’ale
Da volar su le nubi,
E noverar le stelle ad una ad una,
O come il tuono errar di giogo in giogo,
Più felice sarei, dolce mia greggia,
Più felice sarei, candida luna.
O forse erra dal vero,
Mirando all’altrui sorte, il mio pensiero:
Forse in qual forma, in quale
Stato che sia, dentro covile o cuna,
È funesto a chi nasce il dì natale. (Canto notturno, vv. 133–143)
[Vielleicht, wenn ich Flügel hätte, | über den Wolken zu fliegen, | die Sterne zu zählen, einen nach dem andern, | oder als Donner von Berg zu Berg zu irren, | wäre ich glücklicher, du liebe Herde, | wäre ich glücklicher, du weißer Mond. | Oder vielleicht irrt mein Sinn, wenn er das Schicksal | andrer betrachtet, und verfehlt die Wahrheit. | Vielleicht bringt einem jeden, | ob in der Höhle, ob in der Stube geboren, | der Tag der Geburt schon sein Verhängnis.3]
Wie in den drei zuvor zitierten Texten geht es auch in diesem Gedicht nicht eigentlich um Vögel, aber dennoch werden diese hier am Ende über die Flügel als zweitem Spezifikum neben dem Gesang sozusagen synekdochisch ins Gedicht hereingeholt: Mit den Flügeln assoziiert der singende Hirte die Vorstellung des Fliegens, das ihm wie eine Befreiung aus seiner Beschränkung erscheint. Fliegend, so denkt er, könnte er sich über sein kleines, unbedeutendes Dasein erheben, darüber schweben und damit über den bedrängenden Fragen seines Lebens, über der Frage nach dem Sinn des lebenslangen Sich-Abmühens stehen, und dann wäre er, wie die anaphorische Wiederholung des «Più felice sarei» unterstreicht, glücklicher.
Trotz dieser Selbstbeschwörung jedoch ist dieses Glück nur im Konditional zu haben, nur in der Abhängigkeit vom Bedingungssatz, der durch seine Form und zudem durch das einleitende «Vielleicht» (v. 133) schon Zweifel anmeldet, und diese Zweifel am ‹Dann wäre ich glücklicher› werden noch hartnäckiger, wenn das «Vielleicht» gleich zweimal (v. 139 und 141) wiederholt wird: Vielleicht ist auch dies ja nur eine Illusion. Zur Gewißheit gelangt der singende Hirte nicht mit seinem Canto notturno, im Gegenteil; er gelangt zum dreimaligen «Forse», das mithin das ist, was vor allem stehen bleibt am Ende des Gedichts: Sicher ist nicht, daß er fliegend sein Glück fände, sicher ist aber ebensowenig, daß alles von Geburt an unheilvoll ist; sicher ist allein die im «forse» signalisierte und mit dem Gesang realisierte Möglichkeit des Gedankenflugs, die Möglichkeit, sich im canto dank der Imagination momentan aus seinem Trübsinn zu befreien, auch wenn das Ich dadurch nicht zum bewußtlosen Tier wird, sondern eher ein Melancholiker bleibt, wie sein bilder- und gedankenreicher canto in seinen suggestiven Klängen belegt.
Während hier der Hirte an seinem «pensiero» festhält und nur – aber immerhin – im dreimaligen «forse» dessen Relativierung durch andere Denk- und Lebensweisen andeutet, inszeniert Leopardi in einem anderen Text einen Philosophen, der, seinem sprechenden Namen zufolge, ein «spensierato» ist, Amelio, der Sorgenfreie oder, wörtlicher, Gedankenlose, der demnach seine Gedanken auch in der «immensità» des weiten Himmels fliegen lassen kann: Wie das Ich des Infinito, das sie in der Unermeßlichkeit des Meeres versinken läßt und so den Schiffbruch als Wonne erlebt, weil die Gedanken es einmal nicht weiter verfolgen4, imaginiert Amelio sich als frei, unbeschwert und unbekümmert über allem fliegender und singender Vogel. In diesem Fall handelt es sich nicht um einen der Canti, nicht um ein Gedicht, sondern um eine der Operette morali, den Elogio degli uccelli, das Lob der Vögel, das, anders als die meisten Operette, nicht in Dialogform gehalten ist, sondern nach einer kurzen Einleitung, wie der Titel ankündigt, der Form des Enkomion gehorcht. Hier heißt es über den Philosophen und die Situation, in der das Enkomion entsteht:
Amelio filosofo solitario, stando una mattina di primavera, co’ suoi libri, seduto all’ombra di una sua casa in villa, e leggendo; scosso dal cantare degli uccelli per la campagna, a poco a poco datosi ad ascoltare e pensare, e lasciato il leggere; all’ultimo pose mano alla penna, e in quel medesimo luogo scrisse le cose che seguono. (153)
[An einem Frühlingsmorgen, als der einsame Philosoph Amelios umgeben von seinen Büchern lesend im Schatten seines ländlichen Hauses saß, wurde er vom Singen der Vögel ringsum so abgelenkt, dass er ihnen mehr und mehr zuhörte, über sie nachzudenken begann, schließlich das Lesen aufgab und zur Feder griff, um Folgendes zu schreiben. (161)]5
Auch hier spielt der Vogelgesang eine wichtige Rolle, der sich mithin nicht auf bloßes Zwitschern reduziert, denn vor allem zwei Gründe sind es, die Amelio, den sorgenfreien Philosophen, das Lob der Vögel singen lassen: ihr Gesang und ihr Fliegen, und damit auch jene Punkte, die den Elogio mit dem Canto notturnoverbinden. So wie sich dort der Hirte in seinem Gesang Flügel zum Fliegen wünscht, so wünscht Amelio am Ende seines Elogio: «io vorrei, per un poco di tempo, essere convertito in uccello, per provare quella contentezza e letizia loro» (160 [«so wäre ich gern für ein Weilchen in einen Vogel verwandelt, um die Zufriedenheit und Heiterkeit seines Lebens zu erfahren», 171]). Und wie der Hirte glaubt, wer Flügel hat und über den Wolken fliegen kann, müsse glücklicher sein als er auf seinen beschwerlichen Erdenwegen, so vermutet auch Amelio, die Zufriedenheit und Heiterkeit der Vögel hänge mit ihrem Fliegen und unaufhörlichen Singen zusammen.
Der Gesang im allgemeinen und im besonderen der Vogelgesang ist für ihn ein Zeichen von Fröhlichkeit, gleichsam ein Lachen: Trost und Vergnügen bereite der Vogelgesang den Menschen oder, wie er vermutet, sogar allen Lebewesen, und zwar weder aufgrund der Süße des Klangs noch aufgrund seiner Vielfalt oder Harmonie, sondern weil er Freude bedeute: aufgrund «quella significazione di allegrezza che è contenuta per natura, sì nel canto in genere, e sì nel canto degli uccelli in ispecie. Il quale è, come a dire, un riso, che l’uccello fa quando egli si sente star bene e piacevolmente» (155 [aufgrund «jener Bekundung von Fröhlichkeit, die naturgemäß in jedem Gesang, besonders aber in dem der Vögel steckt. Ist er doch gleichsam ein Lachen, in das der Vogel ausbricht, wenn er sich wohl und vergnügt fühlt», 164]). Insofern die Vögel, wie Amelio fortfährt, folglich durch ihren Gesang am menschlichen Privileg, das einzige animal ridens zu sein, teilhaben, wird das Lob der Vögel insgeheim zu einem ‹Lob des Lachens› und kehrt sich damit in diesem kleinen Exkurs die Argumentation beinahe um: Obwohl die menschliche Spezies «unter allen Geschöpfen das geplagteste und elendeste» ist (164), «infra tutte le creature […] la più travagliata e misera» (155), besitzt der Mensch doch die Fähigkeit, noch unter den widrigsten Umständen zu lachen, selbst wenn er das Unglück des Lebens kennt und von der Eitelkeit aller menschlichen Güter überzeugt ist. Im Grunde scheint die Fähigkeit zu lachen ausgerechnet in jenem Wesen, das nicht nur das lachende, sondern auch das denkende Tier sein soll, zumindest paradox, wenn nicht gar eine Art momentaner Verrücktheit, eine «specie di pazzia non durabile», die sich der Mensch gelegentlich sogar durch Trunkenheit verschafft, weil es einen vernünftigen Grund zum Lachen im Dasein des unglücklichsten unter allen Lebewesen ja eigentlich nicht gebe, das Lachen aber erlaubt, sich selbst und sein Leben zeitweise zu vergessen. Dieses menschliche Lachen also sei dem Vogelgesang vergleichbar, der jedoch, und damit beschließt Amelio seinen Exkurs über das Lachen, anders als das Singen und Lachen der Menschen, das privat bleibe, dank des Wirkens der Natur öffentlich gehört werde und daher, wie jede Heiterkeit anderer, wo sie keinen Neid auslöst, tröste und erfreue:
sapientemente [la natura] operò che la terra e l’aria fossero sparse di animali che tutto dì, mettendo voci di gioia risonanti e solenni, quasi applaudissero alla vita universale, e incitassero gli altri viventi ad allegrezza, facendo continue testimonianze, ancorchè false, della felicità delle cose. (157)
[mit großer Weisheit hat die Natur es so eingerichtet, dass die Erde und die Luft erfüllt ist mit Tieren, die den ganzen Tag lang festliche Freudenstimmen erklingen lassen, als applaudierten sie gleichsam dem Leben selbst, und die anderen Wesen zum Frohsinn anstacheln, indem sie ununterbrochen Zeugnis ablegen, mag es auch falsch sein, von der Glückseligkeit aller Dinge. (167)]
Mit diesem falschen Zeugnis, das dennoch seine gute Wirkung tut, kehrt er zu den Vögeln zurück, die nicht grundlos die fröhlichsten unter allen Lebewesen seien, mithin nicht grundlos fast ununterbrochen singen und somit vom scheinbaren Glück künden können: Da sie ebenso ununterbrochen den Ort wechseln, von Land zu Land fliegen, ohne sich irgendwo lang aufzuhalten, sich aus der Tiefe bis in die höchsten Lüfte erheben, sind sie nicht der noia, der Langeweile, unterworfen und von daher viel eher dazu geschaffen, zu genießen und glücklich zu sein. Sie sehen und erfahren in ihrem Leben unendlich viele und verschiedene Dinge, kommen und gehen, wie sie wollen, nicht von irgendeiner Notwendigkeit getrieben, sie fliegen aus purem Zeitvertreib, legen nur zum Vergnügen Hunderte von Meilen zurück, um am Abend wieder zurückzukehren, und selbst wenn sie einen kurzen Moment an einem Ort bleiben, verharren sie nie in Ruhe, wie der seinerseits sich rasch hin- und herbewegende Satz illustriert:
sempre si volgono qua e là, sempre si aggirano, si piegano, si protendono, si crollano, si dimenano; con quella vispezza, quell’agilità, quella prestezza di moti indicibile. (158)
immerzu drehen sie sich hierhin und dorthin, trippeln umher, bücken sich, strecken sich, schütteln sich, alles mit einer unbeschreiblichen Lebhaftigkeit, Gewandtheit und Geschwindigkeit. (168)
Abgesehen von den Augenblicken des Schlafs kommt der Vogel vom Schlüpfen aus dem Ei bis zum Tod nie zur Ruhe, gönnt er sich nie eine Pause, wie das vielsagende und in Leopardis Texten rekurrente Verb «posare»6 signalisiert: «non si posa un momento di tempo» (158 [«ruht er […] keinen Augenblick», 168]). Zu diesen äußeren Eigenschaften des Vogels gesellen sich innere, die ihn ebenfalls fähiger zum Glück machen als alle anderen Lebewesen: Dank ihres feinen Gehörs und ihrer scharfen Augen «godono tutto giorno immensi spettacoli e variatissimi» [«genießen sie den ganzen Tag lang unermessliche und höchst abwechslungsreiche Schauspiele»], schreibt der Philosoph; sie überblicken aus der Höhe so viel Raum, sie entdecken so viele Länder, daß sie «debbono avere una grandissima forza e vivacità, e un grandissimo uso d’immaginativa» [«eine überaus große und lebhafte Phantasie haben müssen»], und zwar nicht jene, die in Unruhe und Ängste versetzen kann, sondern
quella ricca, varia, instabile, leggera e fanciullesca; la quale si è larghissima fonte di pensieri ameni e lieti, di errori dolci, di vari diletti e conforti; e il maggiore e più fruttuoso dono di cui la natura sia cortese ad anime vive. (158sq.)
[jene reichhaltige, vielfältige, leichte, unbeständige und kindliche Phantasie, die eine unerschöpfliche Quelle für angenehme und heitere Gedanken ist, für süße Irrtümer, Entzücken und Trost, mithin die größte und fruchtbarste Gabe, welche die Natur einer lebenden Seele zu schenken vermag. (169)]
Der unaufhörliche Gesang, der dem Lachen gleicht, und die ständige Bewegung, die das taedium vitae verhindert und die Einbildungskraft stimuliert, also sind es, die Amelio das Lob der Vögel singen und ihn ebenso wie den Hirten des Canto notturno wünschen läßt, zeitweise in einen Vogel verwandelt zu werden: Canto und volo stellen wie die zeitweilige Verrücktheit und die kindliche Einbildungskraft eine Opposition zur allzu engen und einseitigen Vernunft des so oft unglücklichen Vernunftwesens Mensch dar, weil sie ihm erlauben, von seiner düsteren Gegenwart abzusehen und sich kraft seiner Imagination über das gleichzeitige Wissen um die «infelicità», über das Bewußtsein von der finitudine, der Vergänglichkeit und Endlichkeit, zu erheben. Fliegen und Imaginieren, Lachen und Gesang bewirken ein momentanes Vergessen der conditio humana – aber dieses momentane Vergessen ist, gerade weil es sich um «continue testimonianze, ancorchè false, della felicità delle cose» handelt, gerade weil das Bewußtsein der Endlichkeit gleichzeitig bestehen bleibt, kein Eskapismus, sondern eher eine Reflexion über das, was im «canto», in der Fiktion, in der Dichtung geschieht und was der paradoxen Situation des Menschen in seiner Welt entspricht: Er weiß um die vanitas, er kennt die «infelicità della vita» – aber er lacht, er singt, und er dichtet. Dank seiner Sprache und seiner Imagination erfindet er all jene Welten, die der Vogel singend überquert, erfindet er den einsamen Philosophen, der von all seinem allzu menschlichen Unglück abzusehen und das Lob der Vögel zu singen vermag.
II. Der Vogel und der Mensch
Ein «Io solitario», ein einsames, denkendes und singendes Ich inszeniert Leopardi aber auch in weiteren Canti, nicht nur im bereits zitierten Gesang des umherirrenden Hirten oder in jenem der Sappho, sondern insbesondere in jenem, der den canto zwar nicht im Titel trägt, aber dennoch «canto» ist und zudem, wie der Elogio, unter anderem vom Gesang der Vögel handelt: im Passero solitario.
Il passero solitario
D’in su la vetta della torre antica,
Passero solitario, alla campagna
Cantando vai finchè non more il giorno;
Ed erra l’armonia per questa valle.
Primavera dintorno
Brilla nell’aria, e per li campi esulta,
Sì ch’a mirarla intenerisce il core.
Odi greggi belar, muggire armenti;
Gli altri augelli contenti, a gara insieme
Per lo libero ciel fan mille giri,
Pur festeggiando il lor tempo migliore:
Tu pensoso in disparte il tutto miri;
Non compagni, non voli,
Non ti cal d’allegria, schivi gli spassi;
Canti, e così trapassi
Dell’anno e di tua vita il più bel fiore.
Oimè, quanto somiglia
Al tuo costume il mio! Sollazzo e riso,
Della novella età dolce famiglia,
E te german di giovinezza, amore,
Sospiro acerbo de’ provetti giorni
Non curo, io non so come; anzi da loro
Quasi fuggo lontano;
Quasi romito, e strano
Al mio loco natio,
Passo del viver mio la primavera.
Questo giorno ch’omai cede alla sera,
Festeggiar si costuma al nostro borgo.
Odi per lo sereno un suon di squilla,
Odi spesso un tonar di ferree canne,
Che rimbomba lontan di villa in villa.
Tutta vestita a festa
La gioventù del loco
Lascia le case, e per le vie si spande;
E mira ed è mirata, e in cor s’allegra.
Io solitario in questa
Rimota parte alla campagna uscendo,
Ogni diletto e gioco
Indugio in altro tempo: e intanto il guardo
Steso nell’aria aprica
Mi fere il Sol che tra lontani monti,
Dopo il giorno sereno,
Cadendo si dilegua, e par che dica
Che la beata gioventù vien meno.
Tu, solingo augellin, venuto a sera
Del viver che daranno a te le stelle,
Certo del tuo costume
Non ti dorrai; che di natura è frutto
Ogni vostra vaghezza.
A me, se di vecchiezza
La detestata soglia
Evitar non impetro,
Quando muti questi occhi all’altrui core,
E lor fia voto il mondo, e il dì futuro
Del dì presente più noioso e tetro,
Che parrà di tal voglia?
Che di quest’anni miei? che di me stesso?
Ahi pentirommi, e spesso,
Ma sconsolato, volgerommi indietro. (Il passero solitario, vv. 1–59)
[Die einsame Amsel
Droben, hoch auf der Spitze des alten Turmes, | einsame Amsel, singst du ins weite Land | dein Lied hinaus, bis schließlich der Tag vergeht. | Und harmonischer Wohlklang erfüllt dieses Tal. | Frühling glänzt überall | in den Lüften und jubiliert auf den Feldern, | und Rührung ergreift das Herz, wenn man schauend steht. | Du hörst die Schafe blöken, die Rinder muhen. | Die anderen Vögel ziehen vergnügt um die Wette | am blauen, heiteren Himmel tausend Kreise | und feiern ihres Lebens schönste Zeit. | Du bleibst sinnend beiseit und betrachtest das alles. | Du nimmst nicht teil, und du fliegst nicht. | Scherz und Fröhlichkeit abgeneigt, sitzt du da und singst du, | und so, in Gedanken, verbringst du | des Jahrs und des eigenen Lebens Blütezeit.
Weh mir, wie ähnlich im Grunde | ist deine Art zu leben der meinen. Frohsinn | und Lachen, stets mit der Jugend in süßem Bunde, | und Liebe, auch dich, der Jugend leibliche Schwester | und der späteren Tage bittere Sehnsucht, | achte ich nicht, ich weiß nicht, warum. Statt dessen | zieht es mich fluchtartig fort. | Ein Einsiedler gleichsam und Fremder | am eigenen Heimatort | schaue ich zu, wie der Lenz meines Lebens verstreicht. | Den heutigen Tag, der nun dem Abend weicht, | pflegt man fröhlich zu feiern in unserem Städtchen. | Du hörst in der klaren Luft die Glocke schallen, | hörst wieder und wieder das Donnern aus ehernen Rohren | von Dorf zu Dorf in der Ferne widerhallen. | Die Burschen und Mädchen verlassen | die Häuser im Festtagskleid | und schlendern durch den Ort und füllen die Gassen. | Man sieht und wird gesehen und freut sich von Herzen. | Ich stehle mich einsam beiseit | und suche diese entlegenen Felder, verschiebe | auf eine spätere Zeit | Freude und Scherz, und indessen trifft meinen Blick | in lichtdurchfluteter Luft | die Sonne, die in der Ferne zwischen den Bergen | langsam versinkt und erblindet | am Ende des heiteren Tags, und es scheint mir, sie ruft, | sie flüstert mir zu, daß die glückliche Jugendzeit schwindet.
Einsamer kleiner Vogel, du wirst am Abend | deines Lebens, den dir die Sterne bestimmen, | die Art, wie du lebtest, sicher | nicht bedauern. Denn eure Neigung ist nur | eine Frucht der Natur. | Ich aber, wenn ich nicht | die verabscheute Schwelle | des Alters zu meiden vermag, | wenn diese Augen nicht mehr zum Herzen des andren | sprechen, die Welt sich leert und der morgige Tag | trostloser, dunkler noch als der heutige zu werden verspricht, | was wohl werde ich denken | von mir selbst, und wie ich gelebt und gehofft? | Bereuen werd ich und oft, | doch ungetröstet, die Blicke rückwärts lenken.]
Außer den drei oben angesprochenen Fragen hat sich, vor allem in den letzten Jahren, die Forschung selbstverständlich auch weiteren Aspekten zugewandt: Neben der immer wieder auftauchenden biographistischen Deutung des Textes, derzufolge Leopardi mit dem Ich des Textes exakt sich selbst und sein Leben in Recanati portraitiert habe, und neben den zahlreichen intertextuellen Anknüpfungspunkten vom «passer solitarius» in Psalm 102 über diverse Gedichte Petrarcas bis hin zu Texten ungefähr aus Leopardis Zeit sind dies vor allem zwei Bereiche: Zum einen wird, gerade in den neuesten Arbeiten, die Frage nach der Selbstbezüglichkeit des Textes gestellt, die Frage danach, ob es sich um ein Gedicht über das Dichten handle, zum anderen die Frage nach der Zeit, die in Anbetracht der vielen und vielfältigen Erwähnungen im Gedicht als dessen zentrale Isotopie angesehen werden muß, die zugleich die meisten anderen Aspekte berührt oder einschließt.1
Der oben vollständig abgedruckte Text ruft in Erinnerung, daß das Gedicht nicht in regelmäßige Strophen, sondern in drei ungleich lange Versabschnitte geteilt ist, von denen der erste und der dritte mit 16 und 15 Versen ungefähr gleichlang sind, während der mittlere mit 28 Versen beinahe die doppelte Länge umfaßt und damit fast die Hälfte des Gedichts ausmacht. Diese freie Strukturierung, die einhergeht mit nur wenigen, verstreut eingesetzten Reimen, findet sich bekanntlich auch sonst in der Lyrik des späten Leopardi, der sich nach und nach von der strengen Canzonenform löst, wie sie aus der provenzalischen Dichtung in die italienische übernommen und vor allem in der bei Petrarca gestalteten Weise kanonisiert wurde. Diesem Aufbau in drei Teile entspricht die Sprechsituation des Gedichts, die, auch wenn das ganze Gedicht hindurch das lyrische Ich die Sprechinstanz bleibt, doch mehrfach changiert: Im ersten Teil wendet es sich vor allem an den Vogel, der im zweiten Vers direkt angesprochen wird. Hier dominiert ein eher beschreibender Gestus, insofern die Lebensgewohnheiten des Vogels geschildert werden, die sich von denen anderer Vögel unterscheiden. Demgegenüber beschreibt das Ich im zweiten Abschnitt, wie wiederum gleich die ersten beiden Verse unterstreichen («quanto somiglia | Al tuo costume il mio» [«wie sehr ähnelt deine Lebensweise der meinen»]), seine eigenen Gewohnheiten, die nun wiederum dargelegt werden, aber hier ist sein Gesang von vornherein mit der Exclamatio Oimè als Klage statt als neutrale Beschreibung gekennzeichnet. Diese Doppelheit wiederholt sich im dritten und letzten Versabschnitt, der wie zuvor einen kürzeren Teil dem direkt angesprochenen Vögelchen, «Tu, solingo augellin», widmet und diesem mit dem «A me» ab Vers 50 einen doppelt so langen Teil entgegensetzt. Dieser mündet in den letzten beiden Versen in einen durch «Ahi» eingeleiteten, klagenden Ausruf, die einzige Antwort auf die drei zuvor gestellten Fragen des Ich.
Insbesondere zwischen erstem und zweitem Abschnitt sind die Bezüge vom Gedicht klar markiert und lassen sich bei aufmerksamem mehrfachem Hören und Lesen deutlich wahrnehmen, weil sich essentielle Elemente wiederholen: In der Mitte des ersten Teils ist zunächst von der «primavera» die Rede, dann vom Hören, «Odi», und von den anderen; dies wiederholt sich exakt im zweiten Teil, wo in v. 26 der Frühling, in v. 29sq. insistierend das «du hörst» und mit der «Dorfjugend» in v. 33 auch das Pendant zu den anderen Vögeln wiederkehren. Dies wird in der Weise umrahmt, daß Teil I mit dem Du und auf dem Land beginnt, während Teil II mit dem Ich auf dem Land endet (cf. v. 2sq. und v. 36sq.); umgekehrt endet Teil I damit, daß der Vogel sich nicht um das schert, was den anderen Freude bereitet – «non ti cal d’allegria» (v. 14) –, so wie der zweite damit beginnt, daß das Ich sich um Frohsinn, Lachen und Liebe nicht kümmert: «non curo» (v. 22). Zahlreiche Elemente des Gedichts also lassen die enge Verbindung, die Ähnlichkeit zwischen Ich und «passero» hörbar und sichtbar werden, und tatsächlich unterstreichen diese beiden Teile in vielerlei Hinsicht die Gemeinsamkeiten zwischen beiden.2
Allerdings könnte man doch leise Skepsis anmelden, wenn man die raffiniert überkreuzte Struktur der jeweiligen Rahmenteile betrachtet, die die Parallelen im Innern überlagern: Zwar wird so einerseits der Zusammenhalt der beiden Versabschnitte sehr deutlich markiert – am Anfang und Ende die «campagna», die Ich und Du in ihrer Gemeinsamkeit umschließt, dazwischen mit «non ti cal || non curo» ein gleitender Übergang vom Du zum Ich, der seinerseits die Ähnlichkeit durch den ähnlichen Klang sinnlich wahrnehmbar macht. Andererseits und gleichzeitig stellt durch diesen Chiasmus der zweite den ersten Teil auf den Kopf und weist damit bereits auf den dritten Teil voraus, der, wie erwähnt, die Strukturierung des Vorausgegangenen in einer Art Stretto wiederholt und dabei im Ich-Teil auch den Klagegestus wiederaufnimmt. Anders als zuvor jedoch betont das Ich nun vor allem die Unterschiede, wie schon die Opposition von «Tu – A me» andeutet, während zuvor mit «Passero solitario» und «Io solitario» die Analogie hervorgehoben worden war. So steht jetzt auf der einen Seite die Selbstgewißheit des Vogels, den in all seinem Wollen und Streben die Natur leitet. Auf der anderen Seite setzt das Ich diesem fraglosen «certo del tuo costume» (v. 47) konsequent seine eigenen Fragen entgegen, die es als reflexives und reflektierendes, als, wie der letzte Vers sagt, sich zurückwendendes Wesen zeigen – und mit diesem «volgerommi indietro» endet das Gedicht und wird daher gern als Beleg für die alles andere zum Schweigen bringende, aber kaum je selbst verstummende Pessimismus-These gewertet.
Daß der canto und das, was er wie besingt, in einem Band über die «arte del vivere» und «anti-pessimistische Strategien» damit nicht seinerseits zum Verstummen gebracht werden kann, mag auf einen ersten Blick als petitio principii erscheinen, gründet sich aber weiterhin auf den Wortlaut des Textes und auf die bereits zitierten wie auch weitere Passagen des Leopardischen Werks. Keinesfalls soll damit suggeriert werden, es handle sich um ein per se fröhliches oder gar – horribile dictu – optimistisches Gedicht: Dies hieße, die Komplexität von Leopardis Texten einmal mehr, nur von der anderen Seite her, weit über Gebühr zu reduzieren, wenn nicht zu verfälschen – und nicht umsonst spricht der Bandtitel von anti-pessimistischen, nicht von optimistischen Strategien. Dennoch gilt es, dem nachzugehen, daß in diesen schönen, klangvollen und daher weiterklingenden Versen mehr stecken muß als nur ein pessimistischer Leopardi, der aus seinem engen Recanati nicht herauskommt und das ganze menschliche Leben unter einem ebensolchen Zeichen der Enge und Ausweglosigkeit sieht. Einmal mehr ließe sich mit und frei nach Hölderlin3 sonst fragen: «Wozu Dichte[n] in dürftiger Zeit?» und antworten: «Was bleibet aber, stiften die Dichter.»
Fraglos ist das bereits angesprochene Thema der Zeit als die zentrale Isotopie des Gedichts in vielfachen Bedeutungsaspekten so präsent, daß man die Zeit als das trotz seiner Vielfalt alle einzelnen Aspekte einende Element bezeichnen kann. Auffallend ist dabei, wie insbesondere Gier herausarbeitet4, daß unterschiedliche Ebenen, unterschiedliche Bezugsrahmen der Zeit kombiniert werden, wenn etwa gleich im ersten Versabschnitt zunächst vom ‹Sterben des Tages› die Rede ist, mithin vom sterbenden Tageslicht am Abend (v. 3), danach von der «primavera», dem Frühling (v. 5), und schließlich von der besten Zeit der Vögel (v. 11), von der Blüte des Lebens und der des Jahres (v. 16). Bezogen auf den Vogel werden hier Tageszeit, Jahreszeit und Lebenszeit thematisiert, so wie erneut im folgenden Abschnitt bezogen auf das Ich: Wieder wird der Frühling erwähnt, die untergehende Sonne am Ende des heiteren Tages und die Jugend im Gegensatz zum fortgeschrittenen Alter. Im dritten Versabschnitt, der im Gegensatz zum bisherigen Präsens als der typischen Zeit für Beschreibungen in einem visionären Futur gehalten ist, taucht erneut der Abend auf und in v. 50 die «vecchiezza», das Alter, in dem jeder künftige Tag dunkler, aussichtloser erscheint als der gegenwärtige: «fia […] il dí futuro | Del dí presente più noioso e tetro» (v. 54sq.).
Doch Tageszeit, Jahreszeit und Lebenszeit werden nicht nur nebeneinandergestellt; sie werden auch miteinander verflochten, in der Weise, daß jede zur Metapher, vielleicht auch einer Art metonymischer Metapher der anderen werden kann: So werden Jahreszeit und Lebenszeit nicht nur wie in v. 16 mit der Blüte des Lebens und des Jahres parallelisiert; vielmehr kann, nachdem der erste Versabschnitt zu solchem Lesen angeleitet hatte, im zweiten das eine unmittelbar für das andere einspringen: «Passo del viver mio la primavera», singt das Ich in v. 26, um unmittelbar danach von dieser metaphorischen Verwendung der Jahreszeit zur eigentlichen Verwendung der Tageszeit zurückzuspringen: «Questo giorno ch’omai cede alla sera» (v. 27). Der sich dem Abend zuneigende Tag kehrt im dritten Teil wieder, nun aber erneut in metaphorischem Gebrauch, wenn das Ich sein Vögelchen mit einer poetischen Apostrophe anspricht mit den Worten: «Tu, solingo augellin, venuto a sera | del viver che daranno a te le stelle» (v. 45sq. [‹wenn Du am Abend der Lebensspanne angekommen sein wirst, die dir die Sterne zuweisen›]). Dieses poetische Bild des Lebensabends ist die letzte bildliche Evokation des Themas Zeit, denn wenn das Ich es nun wiederum auf sich selbst bezieht, benennt es sie mit dem kruden, dem eigentlichen Wort «vecchiezza», das es zudem durch eine andere Metapher stark in den Vordergrund rückt: durch die verabscheute, aber gleichwohl nicht zu umgehende Schwelle zu diesem Alter. Dementsprechend wird diese Lebensphase in den folgenden Fragen auch nicht wieder poetisch als Herbst oder Abend stilisiert; vielmehr weist das Demonstrativum «questi» schlicht und klar auf ‹diese meine Jahre› hin, insofern «quest’anni miei» die «vecchiezza» wieder aufnimmt, so daß das ebenso bildhafte wie bilderreiche Gedicht in ein ungeschöntes Benennen mündet, dem die offenen Fragen und der klagende Ausruf korrespondieren.
Aber nicht nur die für den Vogel und für das Ich jeweils gebrauchten Bezeichnungen divergieren hier; vor allem unterscheidet sich, wie das Ich darlegt, die Haltung, die der Besungene und der Singende, das Tier und der Mensch zu ihrer jeweiligen Lebenszeit einnehmen. Während beide sich von den jeweiligen Art- und Zeitgenossen absondern, die Einsamkeit suchen und dem lustigen Treiben allenfalls von ferne zuschauen, lebt der Vogel dabei, anders als das Ich, ganz in seiner Gegenwart: Er singt von seinem Turm aus über das Land, bis der Tag sich neigt, wie es gleich zu Beginn heißt, und singend verbringt er auch den besten Teil des Jahres und des Lebens, wie die Alliterationen und Assonanzen zusätzlich hervorheben: «alla campagna | Cantando vai» (v. 2sq.), und «canti e così trapassi | Dell’anno e di tua vita il più bel fiore» (v. 15sq.). Während also der Vogel nur seine Gegenwart kennt und jeden Tag mit seinem Gesang füllt, weiß das Ich um die Zukunft, weiß, daß die Liebe im fortgeschrittenen Alter Ursache bitterer Seufzer sein wird (cf. v. 20sq.), und läßt doch den Frühling seines Lebens einfach so vergehen: «Passo del viver mio la primavera». Zweimal weist es selbst auf den Abend hin, einmal fühlt es sich gar von der untergehenden Sonne ermahnt, deren Bild schon im zweiten Versabschnitt proleptisch den Lebensabend evoziert (cf. vv. 39–44), aber anders als der in seiner Gegenwart lebende, stets singende Vogel, anders auch als seinesgleichen, die festlich gekleidet die Straßen füllen und fröhlich miteinander umgehen (cf. vv. 32–35), verschiebt das Ich alle Freude auf eine unbestimmte Zukunft: «Ogni diletto e gioco | Indugio in altro tempo» (v. 38sq.).
Solcher Aufschub jedoch bewirkt nicht das Glück, von dem Leopardi im Zibaldone, wo er an verschiedenen Stellen seine teoria del piacere entfaltet, schreibt, es sei nur in der Erinnerung, im Rückblick, oder in der Hoffnung darauf, in einer imaginierten Zukunft, zu haben, nie in der Gegenwart, weil es, insofern es zwangsläufig ein Streben nach unbegrenztem Glück ist, nur in der Imagination ‹verwirklicht› werden kann, hinter der die konkrete Erfüllung stets zurückbleibt. So genügt dem Ich das Treiben der festlich gekleideten jungen Menschen nicht, allein die mahnenden Strahlen der untergehenden, der sich quasi auflösenden Sonne führen ihm vor Augen, daß eine Zeit kommen wird, in der auch diese unbestimmte ‹andere Zeit›, auf die es sein erfülltes Leben verschoben hatte, Vergangenheit sein wird.
Eben diese Zukunft, in der «[s]ollazzo e riso, […] amore, […] diletto e gioco» keinen Ort und keine Zeit mehr haben werden, imaginieren die letzten Zeilen, die das Alter des Vogels und das des Ich vor Augen stellen und so vorwegnehmen: Während der Vogel dank seiner ständigen Gegenwärtigkeit auch dann seine Gegenwart hinnehmen wird, wie sie ist, nicht nach Unerreichbarem streben und sich nicht bedauernd zurückwenden – «Non ti dorrai» (v. 48) –, fürchtet das Ich die Zeit schon vorab, in der ihm die Welt leer scheinen wird, seine Augen kein Herz eines anderen mehr ansprechen werden und jeder Tag dunkler sein wird als der vorausgehende. Das einzige, was dann bleibt, ist, zu bereuen und sich zurückzuwenden, wohl wissend, daß darin kein Trost zu finden sein wird. Genau gegensätzlich also, verglichen mit dem ‹jugendlichen Irrtum› in Petrarcas Eröffnungsgedicht, dessen Ich ebenfalls im vorletzten Vers nur die Reue beim Blick auf das vergangene Leben bleibt, bereut das Ich im Passero solitario nicht, sich dem, was der Welt gefällt und doch nur leerer Schein ist, zu sehr hingegeben zu haben; es bereut vielmehr, die Jugend in der Erwartung des Aufgeschobenen nicht gelebt zu haben und sich nunmehr nur zu ihr zurückwenden zu können.
Das Tier also lebt glücklich, wie es der Elogio degli uccelli bereits vorgeführt hatte und wie die Zusammenschau der beiden Texte von anderer Warte her vorführt: Der unaufhörliche Gesang, der einem Lachen gleicht und das Leben der Vögel an das der Kinder erinnern läßt, signalisiert das ungebrochene Sein in der Gegenwart, das weder Vergangenheit noch Zukunft kennt. Das Ich hingegen lebt nur in der imaginären Vorwegnahme der Zukunft oder der Zurückwendung zur Vergangenheit; es scheint seine Gegenwart trotz des Carpe diem der untergehenden Sonne nicht zu erleben. Vielmehr besitzt es, anders als der Vogel und die Kinder, die Fähigkeit zur Reflexion, die aber, begnügt man sich mit der oberflächlichen Lesart, eher eine unheilvolle Gabe ist und einmal mehr das Tier dem Menschen entgegensetzt. Denn während das Tier einfach seiner Natur folgt und sich und diese nicht in Frage stellt – «di natura è frutto | Ogni vostra vaghezza» (v. 48sq.) –, daher auch keine künftige Zeit in Gedanken vorwegnimmt und keine gewesene bedauernd erinnert, scheint dem Ich die Gegenwart zu entgehen, scheint es sie am Ende gar verpaßt zu haben.
Aber es gibt doch etwas, was zwischen der gewesenen Jugend und dem gefürchteten Alter, zwischen erinnerter Vergangenheit und vorweggenommener Zukunft stehenbleibt, und eben dies verbindet über alle Unterschiede in gewisser Weise dann doch das singende Ich mit seinem besungenen Vogel: eben der canto, der Gesang. Hier wird die Fähigkeit zur Re-flexion, zum Zurückwenden, das «volgerommi indietro» gleichsam vom Fluch des Menschen zu seinem Segen. Zwischen der vergangenen Jugend des Ich und der noch nicht erreichten, nur vorgestellten Zukunft erklingen die Verse, wird die Klage zwar nicht erneut zu einem Elogio, zu einem Loblied, aber doch zu Musik, die vom Ende wieder an den Anfang springen kann, zu Klang, wie nicht zuletzt die Reime unterstreichen, die die Grenzen der so klaren gedanklichen Strukturierung doch wieder verwischen5.
Was sie jedoch, über das Verwischen der klaren Gliederung hinaus, vor allem bewirken, ist das unaufhörliche Weiterklingen des canto, in dem gerade nicht, wie in einer typischen Canzone, identisch gebaute, aber sonst klanglich voneinander unabhängige Strophen aneinandergereiht werden. Allein der ‑ore-Reim durchzieht das ganze Gedicht von «core» in Vers 7 über «migliore», «fiore» und «amore» bis hin zum erneuten «core» im siebtletzten Vers und verbindet so alle drei Versabschnitte. Ähnliches ließe sich zeigen für die einzelnen Teile eines jeden Abschnitts, die alle, trotz der semantischen Gegensätze, klanglich verknüpft werden, wie besonders eindrücklich der letzte Abschnitt hörbar macht, der ausgerechnet «vaghezza» und «vecchiezza», das Ersehnte und das Verabscheute, in einen Klang, in Einklang bringt und so die scheinbar unüberbrückbare Kluft zwischen der Welt des Vogels und der des Menschen durch das Weiterklingen schließt. Überhaupt fällt in diesem letzten Versabschnitt auf, daß im dem Vogel gewidmeten Teil nur dieser eine Vers als Brücke zum nächsten reimt, während ausgerechnet im folgenden allerletzten Teil des Gedichts nur ein einziger Vers, signifikanterweise «il dì futuro», nicht reimt, alle anderen hingegen geradezu einen klangvollen Gegen- oder zumindest einen Nebengesang, para odia, zu den offen bleibenden Fragen und zu den stumm werdenden Augen anzustimmen scheinen.
Mit anderen Worten: Der Gesang des Vogels verstummt einfach an dessen Lebensende, gleichsam naturgemäß, denn der Vogel kennt nur seine Gegenwart; der Gesang des Ich hingegen, auch wenn er sich in der Zeit entfaltet, gehorcht nicht solcher Linearität, sondern vermag in seiner Sprache, seinen Bildern, seinen Klängen die Zukunft, auch wenn aus ihr logischerweise noch nichts widerhallen kann, imaginativ vorwegzunehmen und sich erinnernd zur Vergangenheit zurückzuwenden; er klingt weiter, wie die Reimdichte am Ende belegt und wie das Ich selbst ausspricht, indem es sein eigenes «volgerommi indietro» evoziert. Statt wie die lineare Zeit und wie der Vogelgesang unaufhörlich voranzuschreiten, zeichnen sich Verse – im Unterschied zum vorwärtsdrängenden prorsus der Prosa – eben durch dieses Zurückwenden, das vertere, aus, und was sie in solchem Re-flektieren bewirken, ist, daß aus dem prosaischen Vorwärtsdrängen, aus der Linie vom Schlüpfen aus dem Ei bis zum Tod, wie sie der Elogio evoziert hatte, ein Raum entsteht, ein Klangraum, in dem – wie erinnerte Vergangenheit und vorgestellte Zukunft in der Gegenwart des Ich – alles gleichzeitig gegenwärtig sein kann, alles präsent ist und präsent bleibt, wie die weiterklingenden Bilder und Töne des Schrift gewordenen Gedichts zeigen. Und in diesem Sinn kann dann der «passero solitario», wenngleich er dank seiner Unbewußtheit in Opposition zum melancholischen Menschen steht, doch zum Analogon des Dichters oder mehr noch von dessen Gedicht werden. Denn so wie der Vogel stets in seiner Gegenwart lebt, so ist im Gedicht alles gleichzeitig gegenwärtig und erlaubt es stets von neuem, sich zurückzuwenden und wieder neu mit dem Gesang einzusetzen. Damit aber ist die vergehende und vergangene Zeit kein Grund, pessimistisch zu verstummen; vielmehr öffnet sich in solcher Re-flexion die Zeit auf ein Unendliches, wie das oben erwähnte, das berühmteste Gedicht Leopardis, L’infinito, das in der Sammlung der Canti unmittelbar und wohl kaum zufällig6 auf den Passero solitario folgt, in seinen nur 15 Versen vorführt. Wiederum entsteht das Unendliche, das hier die quasi endlos weiterklingenden, über die Versgrenzen hinweg schwingenden Verse und das unaufhörliche Hin und Her zwischen «questo» und «quello» andeuten, allein im Innern des Ich, in Reflexion und Imagination, im Nebeneinanderstellen aller Zeiten, in deren Unermeßlichkeit der Gedanke endlich Schiffbruch erleidet und untergeht. Doch dieser Schiffbruch ist ebensowenig wie das «volgerommi indietro» Grund zu pessimistischer Klage, im Gegenteil: «il naufragar m’è dolce in questo mare».
Gegen die gängige Lesart, derzufolge die letzten beiden Verse des Passero solitario ein «gelido distico»7, ein ‹eisiges Verspaar› seien, eine «conclusione disillusa», die aus der «amara consapevolezza che gli anni più maturi hanno portato» resultiere und somit eine dem Ende des Elogio degli uccelli genau entgegengesetzte «chiusa […] cupa, funebre e appesantita»8 darstelle, läßt sich dieses Gedicht folglich auch ganz anders lesen. Nicht als «Verkörperung des philosophischen Pessimismus Leopardis»9, nicht als am Schluß «explizit» ausgesprochene «pessimistische Botschaft», die den sich als «absolut» erweisenden «Pessimismus des Gedichts» noch einmal bündelte10, und schon gar nicht als Eingeständnis des Scheitern des Dichters, wie Bárberi Squarotti formuliert: Er liest die beiden letzten Verse als «dichiarazione dello scacco del poeta», für den im Angesicht der ‹Wahrheit› von Alter und Tod das Dichten sinnlos geworden sei: «la poesia finisce, nel confronto con il prezzo di vita e di giovinezza e di gioia che è costata, ad apparire vana e senza senso».11
Gewiß bezeichnet das Ich sein Sich-Zurückwenden als «sconsolato», führt doch an der Einsicht in die finitudine nach einer solchen ‹Analytik der Endlichkeit›, als die das Gedicht in Anlehnung an Foucault12 auch qualifiziert werden könnte, kein Weg vorbei, gibt es mithin keinen billigen ‹Trost› und keinen programmatischen ‹Optimismus› im Sinne der ‹besten aller möglichen Welten›; es gibt kein banales ‹positive thinking›, das die Wirklichkeit menschlichen Lebens nicht sehen und nicht wissen will, und kein selbstbetrügerisches ‹wishful thinking›, das sich über sich selbst belügt. Aber das «sconsolato», das nicht weg- und nicht schönzuredende Wissen um die Endlichkeit als conditio sine qua non der conditio humana, bewirkt gerade nicht den Verzicht auf das vertere und damit auch nicht den Verzicht auf die Poesie, im Gegenteil, ist doch der canto, ist die Dichtung letztlich die einzige Möglichkeit des Glücks13 und damit immer ein ‹Gegengesang› zum «acerbo vero» [zur «herbe[n] Wahrheit»], immer ‹anti-pessimistische Strategie› und Lebenskunst in Anbetracht gewußter Negativität: «conosciuto, ancor che tristo, | Ha i suoi diletti il vero» (Al Conte Carlo Pepoli, v. 140 und v. 151sq. [«Die Wahrheit, die man erkennt, auch wenn sie | traurig ist, hat ihre Freuden»]).
In diesem Sinne erweist sich gerade das Ende des Gedichts als zentral für das Verständnis des Textes wie der «poesia pensante» und des «pensiero poetante»14 im Werk Leopardis generell, impliziert doch das ‹volgersi indietro› in eins das poetische Moment des Verses und das philosophische der Reflexion. Zwar scheint der Passero solitario mit seinen komplexen Zeitverhältnissen zunächst der berühmten «teoria del piacere», derzufolge das Glück nicht in der Gegenwart, sondern nur in der erinnerten Vergangenheit oder der imaginativ vorweggenommenen Zukunft erfahren werden kann, geradezu antithetisch zuwiderzulaufen, insofern vom Ich dieses Gesangs die Vergangenheit vor allem als unwiederbringliche, die Zukunft vor allem wegen des Alters gefürchtet wird (cf. vv. 50–56). Doch gerade die Möglichkeit des Zurückwendens, über die der scheinbar beneidete Vogel nicht verfügt, erweist sich als Strategie, um dichtend das Gedachte zu bewältigen: Allein der canto als sich umwendendes vertere statt als vorlaufendes prorsus vermag dem Ich des Gedichts, vermag dessen Leserin und Leser wie dem poeta e pensatore als seinem ersten Leser als lebenskünstlerische Strategie zu dienen15.
Mit ihrem «Volgerommi» evoziert die Sprechinstanz des Passero solitario, evoziert das Gedicht selbst somit diese Spezifik dichterischen Sprechens, memoria und ripetizione, Erinnerung und Wiederholung zu sein, wie sie Agamben aus seiner Lektüre des Infinito entfaltet und wie sie vergleichbar für eine Lektüre des Passero solitario Gültigkeit besitzt, insofern auch hier jeder Leser und jede Leserin das «Volgerommi indietro» ebenso mit-, nach- oder überhaupt vollziehen muß, wie dort jedes sprechende oder lesende Ich dem questo allererst ‹seinen› Sinn gibt16. Wie das «Volgerommi indietro» ausspricht und wie die sich in ihrem Rhythmus stets wieder zum Anfang zurückwendenden Verse samt den Reimen, Alliterationen, Assonanzen und anderen Rekurrenzphänomenen des Passero solitario unterstreichen, führt die Lyrik geradezu ihr Spezifikum, Erinnerung und Wiederholung, immer schon erklungene und immer neu erklingende Sprache zu sein, vor:
la poesia – ogni poesia – contiene […] un elemento che avverte già sempre chi l’ascolta o ripete che l’evento di linguaggio, che è, in essa, in questione, è già stato e farà ritorno infinite volte. Questo elemento, che funziona, in qualche modo, come un super-shifter, è l’elemento metrico-musicale. […] L’elemento metrico-musicale mostra innanzitutto il verso come luogo di una memoria e di una ripetizione. Il verso (versus, da verto, atto di volgere, di far ritorno, opposto al prorsus, al procedere dirittamente della prosa) mi avverte, cioè, che queste parole sono sempre già avvenute e ritorneranno ancora, che l’istanza di parola che, in esso, ha luogo, è, pertanto, inafferrabile.17
Insofern aber jedes Sprechen, jede Lektüre eines Gedichts als Erinnerung und Wiederholung stets auf das schon Erklungene und immer wieder neu Erklingende und damit auf Vergangenheit und Zukunft deuten, weisen sie – wie das beide ebenso unauflöslich wie raffiniert zusammenbindende «Volgerommi indietro»18 – zugleich in einem umfassenderen Sinn auf die zunächst vom Gedicht scheinbar in Frage gestellte teoria del piacere hin, die Leopardi in seinem Zibaldone di pensieri oder Gedankenbuch so oft umreißt und umkreist. Auch dort hängt das Empfinden von Glück oder Lust, piacere, nicht von einer ‹frohen› statt einer ‹pessimistischen› Botschaft ab, sondern von der Fähigkeit, zu erinnern und zu imaginieren und so den gegenwärtigen Augenblick dank des in Erinnerung und Vorstellung Gesehenen, Gehörten, Empfundenen zu bereichern.19
III. Literatur und Lebenskunst
In welchem Maße im Rahmen einer Lebenskunst, einer «arte del vivere», gerade der Dichtung eine «funzione vivificante»1 zukommt, macht eine Zibaldone-Passage deutlich, die wie ein Anklang an Rousseaus Rêveries du promeneur solitaire klingt. Waren schon diese ‹Träumereien› oder ‹fantasticherie›, die letzte der autobiographischen Schriften Rousseaus, geschrieben, damit ihr Autor sich in späteren Jahren mit einem jüngeren Selbst unterhalten kann,2 erhofft der Autor des Zibaldone, indem er in «quella età» die Zukunft, das Alter, imaginativ vorwegnimmt und durch die Erinnerung ‹köstlich› werden läßt, eine vergleichbare ‹Lust am Text›, ein geradezu sinnliches3 «piacere» von seinen Versen, von seinem ‹volgersi indietro› zur eigenen Jugendzeit, vom «riflettere» über die Vergangenheit:
Uno de’ maggiori frutti che io mi propongo e spero da’ miei versi, è che essi riscaldino la mia vecchiezza col calore della mia gioventù; è di assaporarli in quella età, e provar qualche reliquia de’ miei sentimenti passati, messa quivi entro, per conservarla e darle durata, quasi in deposito; […] oltre la rimembranza, il riflettere sopra quello ch’io fui, e paragonarmi meco medesimo; e infine il piacere che si prova in gustare e apprezzare i propri lavori, e contemplare da se compiacendosene, le bellezze e i pregi di un figliuolo proprio, non con altra soddisfazione, che di aver fatta una cosa bella al mondo, sia essa o non sia conosciuta per tale da altrui. (Zib. 4302 [15. Feb. 1828])4
[Eine der wichtigsten Früchte, die ich mir von meinen Versen erhoffe und verspreche, ist, daß sie mein Alter mit dem Feuer meiner Jugend erwärmen mögen; daß ich sie im Alter genießen und manche Reliquie meiner vergangenen Gefühle wiederfinden werde, daselbst hineingetan, um sie aufzubewahren und ihr Dauer zu verleihen, fast wie in einer Schatzkammer; […] zudem die Erinnerung, das Nachdenken über das, was ich war, das Mich-mit-mir-selbst-Vergleichen; und schließlich die Lust, die man empfindet, wenn man die eigenen Arbeiten genießt und schätzt, wenn man für sich die Schönheiten und Vorzüge eines eigenen Kindes betrachtet und sich daran erfreut, mit keiner anderen Befriedigung als der, etwas Schönes auf der Welt gemacht zu haben, gleich ob es von anderen als schön erkannt wird oder nicht.5]
Auch das Ich des ‹Gedankenbuchs› praktiziert demnach, wie das im Gedicht inszenierte und sprechende Ich, das «volgerommi indietro», statt nach «felicità celesti» oder anderen «godimenti» [nach ‹himmlichen Glückseligkeiten› oder anderen ‹Genüssen›] zu streben. Zwischen «la mia vecchiezza» und «la mia gioventù» [«mein[em] Alter» und «meiner Jugend»] bereichern Rückblick und Vorausblick, Erinnertes und Erhofftes die Gegenwart und geben damit ein Bild jener «anti-pessimistischen Strategie», jener «Lebenskunst», die der 79. pensiero skizziert (cf. Zib. 4420sq. [1. Dic. 1828]). Wie – nach der Erläuterung mittels der (selbst-)ironischen und wiederum einem Gegengesang gleichkommenden ‹natura benigna› [‹wohlgesinnten Natur›] – das Ende des Aphorismus als seine eigentliche Pointe zeigt, ist diese «arte del vivere» letztlich vom zu errechnenden Lebensalter gänzlich unabhängig; genauer, er sagt sich los von den Stereotypen jugendlichen Stürmens und Drängens hier und vermeintlicher Altersweisheit und gesetzter Abgeklärtheit dort, weil de facto die einen solche ‹Kunst› schon in jungen Jahren erlernten und erfolgreich praktizierten, während sie den anderen bis ins hohe Alter und bis zum Tod verschlossen bleiben werde:
Il giovane non acquista mai l’arte del vivere, non ha, si può dire, un successo prospero nella società, e non prova nell’uso di quella alcun piacere, finchè dura in lui la veemenza dei desiderii. Più ch’egli si raffredda, più diventa abile a trattare gli uomini e se stesso. La natura, benignamente come suole, ha ordinato che l’uomo non impari a vivere se non a proporzione che le cause di vivere gli s’involano; non sappia le vie di venire a’ suoi fini se non cessato che ha di apprezzarli come felicità celesti, e quando l’ottenerli non gli può recare allegrezza più che mediocre; non goda se non divenuto incapace di godimenti vivi. Molti si trovano assai giovani di tempo in questo stato ch’io dico; e riescono non di rado bene, perché desiderano leggermente; essendo nei loro animi anticipata da un concorso di esperienza e d’ingegno, l’età virile. Altri non giungono al detto stato mai nella vita loro: e sono quei pochi in cui la forza de’ sentimenti è sì grande in principio, che per corso d’anni non vien meno: i quali più che tutti gli altri godrebbero nella vita, se la natura avesse destinata la vita a godere. Questi per lo contrario sono infelicissimi, e bambini fino alla morte nell’uso del mondo, che non possono apprendere. (Pensieri, LXXIX)
[Der Jüngling wird niemals die Kunst zu leben erlernen, und man kann sagen, niemals in der Gesellschaft Erfolg oder Freude an ihr haben, solange die Heftigkeit seiner Wünsche nicht nachläßt. Je schneller er sich abkühlt, um so schneller wird er dazu fähig sein, die Menschen und sich selbst richtig zu behandeln. Die Natur, gütig wie sie zu sein pflegt, hat es so eingerichtet, daß der Mensch in gleichem Maße zu leben lernt, wie ihm der Grund zum Leben entschwindet, daß er die Wege, mit denen er seine Ziele erreichen kann, erst dann kennt, wenn er aufgehört hat, diese Ziele als himmlische Seligkeit anzusehen und wenn ihre Verwirklichung ihm nur noch eine recht mäßige Freude bereiten kann; kurz, daß der Mensch erst dann genießen kann, wenn er zum Genießen nicht mehr fähig ist. Viele befinden sich in dem Lebensabschnitt, von dem ich hier spreche, und sind noch Jünglinge; solche haben nicht selten guten Erfolg, weil sie nicht allzuviel mehr wünschen, da sie in ihren Seelen durch ein Zusammentreffen von Welterfahrung und Geist das Mannesalter vorweggenommen haben. Andere erreichen diesen Zustand aber niemals in ihrem ganzen Leben: es sind dies jene ganz wenigen, bei denen die Stärke des Gefühls von Anfang an so mächtig ist, daß es auch im Laufe der Jahre nicht schwächer wird; solche Menschen würden mehr als alle anderen das Leben genießen, wenn die Natur das Leben zum Genießen bestimmt hätte. Weil aber das Gegenteil der Fall ist, sind dies die unglücklichsten Menschen; sie sind bis an ihr Lebensende in ihrem Umgang mit der Welt wie Kinder, die nichts lernen können.6]
Diese Maxime, in der Leopardi das über dem vorliegenden Band stehende Konzept der Lebenskunst explizit einführt, mag in ihrer Mehrdeutigkeit zugleich paradigmatisch für die Pensieri selbst stehen, wie sie Walter Benjamin in seiner Rezension der 1928 erschienenen deutschen Übersetzung der Gedanken qualifizierte. Während Leopardis Texte «der saturierten Geschichts- und Kunstbetrachtung des 19. Jahrhunderts ganz unzugänglich geblieben» seien, so daß sie, ähnlich wie bei Hölderlin, offenbar nur die Möglichkeit fand, «hier ganz besonders beharrlich mit ihren Schlagworten aufzutrumpfen» und die Texte – im Falle Leopardis – mit dem «Kennwort des ‹Pessimismus›» zuzudecken, mithin «sein Schaffen ins Abstrakte zu verwandeln», erkennt Benjamin in dem Autor gerade nicht den «kontemplativen und resignierten Typus des Pessimisten». Vielmehr stellt sich diesem
in dem Dichter […] ein anderer: der paradoxe Praktiker, der ironische Engel entgegen. […] Denn in der schlechtesten Welt das Rechte durchsetzen, ist bei ihm nicht nur Sache des Heroismus, sondern der Ausdauer und des Scharfsinns, der Verschlagenheit und der Neugier. Es ist dies todesmutige Experimentieren mit dem Explosivstoffe ‹Welt›, was die ‹Pensieri› so hinreißend macht. Sie sind ein Handorakel, eine Kunst der Weltklugheit für Rebellen.7
Doch ungeachtet solcher aus dem ‹unverstellten› Lesen der Texte Leopardis gewonnenen Einsichten ist die Pessimismus-These als vermeintliches Kennwort für Leopardis Schaffen, das freilich eher zu dessen Verkennen beiträgt, auch im 20. und 21. Jahrhundert keineswegs gänzlich verstummt, im Gegenteil: Wie Maria Corti etwa 40 Jahre nach Benjamin schrieb, breitete sie sich in ‹Legionen von Aufsätzen über den persönlichen, kosmischen etc. Pessimismus›8 immer weiter aus. In solcher ‹Ausdifferenzierung› jedoch mußte sie notwendigerweise alle der These zuwiderlaufenden Differenzen, alle Offenheit und alle Widersprüche des vielschichtigen Werks, alles «todesmutige Experimentieren», alle «Neugier» und «Weltklugheit» aus dem Blick verlieren oder verbannen und statt ihrer das Werk selbst in die Gefahr des Verstummens bringen, weil sie weiter, wie der zu Beginn zitierte Settembrini in Thomas Manns wenige Jahre vor Benjamins Lektüre erschienenem Roman, nur von Unglück, Elend und Demütigung, von Niederungen der Ironie und herabgezogener, verkümmerter Seele, von herzzerreißenden Klagen, Entbehrungen und Verzweiflung sprechen wollte, dabei aber den «schönen Silben», von denen auch Ingenieur und Leutnant «kein Wort verstanden»9, kein Gehör schenkte. Dennoch sind, wie exemplarisch die Stimmen Paul Heyses mit der Einleitung zu der von ihm übersetzten Werkausgabe und Antonio Pretes mit seinem jüngsten Buch, La poesia del vivente, zeigen, seit dem 19. Jahrhundert und bis in die Gegenwart auch jene Stimmen niemals völlig verstummt, die weder den Pessimismus für «die einzig befriedigende Lösung aller Tages- und Menschheitsfragen» halten noch gar Leopardis «memento vivere» vom «Phrasengeräusch der Pessimisten»10 übertönen lassen.
Auf den Spuren dieses memento vivere Leopardis, das sich weder auf die verschiedenen Pessimismen noch auf irgendeinen Optimismus reduzieren läßt, sondern in seinem Skeptizismus offen bleibt für immer neue Lesarten, bewegen sich die im vorliegenden Band versammelten Beiträge des Bonner Leopardi-Tags 2019. Dabei geht es in einem ersten Teil, dessen Beiträge vor allem von Pensieri (Helmut Meter), Operette morali (Antonio Panico) und Zibaldone (Martina Kollroß) ausgehen, unmittelbar um das Leopardische Konzept des Lebens und der Lebenskunst, das selbstverständlich immer auch die Frage noch dem Tod einschließt. Im zweiten Teil werden (in den Beiträgen von Milan Herold und Paul Strohmaier) wider die hartnäckige Pessimismus-These vielfältige Überlegungen zur vielgestaltig präsenten Heiterkeit im Werk Leopardis an- und vorgestellt, bevor zur Widerlegung der allzu schlichten These im dritten Teil einzelne canti, Il risorgimento (Giuseppe Antonio Camerino) und Il tramonto della luna (Annika Gerigk), einer je neuen und genauen Lektüre unterzogen werden. Der vierte Teil schließlich zeigt facettenreich, in welchem Maße Leopardi und sein Werk unaufhörlich in einem Dialog stehen und zum Dialog anregen: So entstehen seine Texte zum einen im Austausch und in der Auseinandersetzung mit früheren Autoren und Werken wie etwa Pascal, Leibniz, Voltaire (Giulia Abbadessa) oder Rousseau (Luigi Camerino); zum anderen wird Leopardis Denken und Dichten seinerseits Gegenstand von De Sanctis’ Dialog Leopardi e Schopenhauer





























