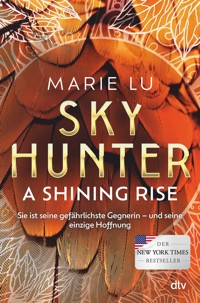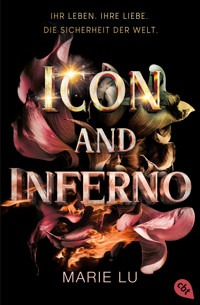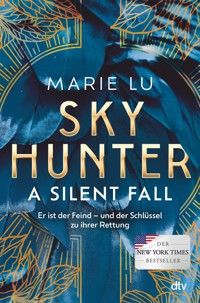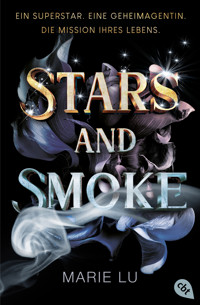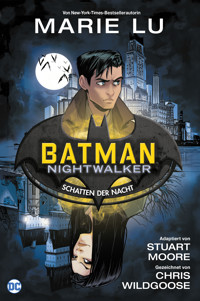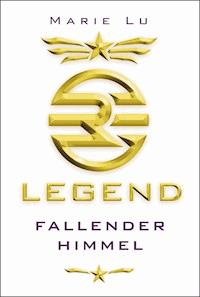
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Legend
- Sprache: Deutsch
Eine Welt voller Unterdrückung. Rachegefühle, die durch falsche Anschuldigungen immer weiter genährt werden. Und eine grenzenlose Liebe, die dem Hass entgegentritt. Das ist die Geschichte von Day und June. Getrennt sind sie erbitterte Gegner, aber zusammen sind sie eine Legende!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Falls du dich mit anderen Lesern über den Roman austauschen möchtest, findest du am Ende dieses E-Books einen Social-Reading-Stream. Dort kannst du direkt deine Meinung zum Roman abgeben und lesen, wie anderen Nutzern das Buch gefallen hat.
LOS ANGELES, KALIFORNIEN
REPUBLIK AMERIKA
EINWOHNER: 20174
TEIL EINS
DER JUNGE,DER IM LICHT WANDELT
DAY
Meine Mutter glaubt, dass ich tot bin.
Wie man sieht, bin ich nicht tot, aber es ist sicherer, sie in dem Glauben zu lassen.
Mindestens einmal pro Monat sehe ich mein Fahndungsfoto auf einem der JumboTrons, die über die ganze Innenstadt von Los Angeles verteilt sind. Es wirkt da oben immer völlig fehl am Platz. Meistens zeigen die riesigen Monitore fröhliche Bilder: lachende Kinder unter einem leuchtend blauen Himmel, Touristen, die vor den Ruinen der Golden Gate Bridge posieren, Republik-Werbespots in Neonfarben. Manchmal wird auch Propaganda gegen die Kolonien gesendet. Die Kolonien wollen uns unser Land wegnehmen, verkünden die Schlagzeilen. Sie neiden euch das, was ihr habt. Lasst nicht zu, dass sie euch eure Heimat rauben! Wehrt euch!
Und mittendrin meine Fahndungsanzeige. Sie lässt die JumboTrons in all ihrer bunten Pracht erstrahlen:
GESUCHT IM NAMEN DER REPUBLIK Akten-Nr.462178-3233 »DAY«
GESUCHT WEGEN KÖRPERVERLETZUNG, BRANDSTIFTUNG, DIEBSTAHLS, BESCHÄDIGUNG STAATLICHEN EIGENTUMS UND BEHINDERUNG MILITÄRISCHER EINSÄTZE
200000 REPUBLIKNOTEN BELOHNUNG FÜR HINWEISE, DIE ZUR FESTNAHME FÜHREN
Die Meldung wird jedes Mal von einem anderen Foto begleitet. Einmal zeigt es einen Jungen mit Brille und einem wirren roten Lockenschopf. Ein anderes Mal einen Jungen mit schwarzen Augen und Glatze. Manchmal bin ich schwarz, manchmal weiß, dann wieder milchkaffeebraun oder gelb oder rot oder was ihnen sonst gerade in den Sinn kommt.
Mit anderen Worten: Die Republik hat keine Ahnung, wie ich aussehe. Sie scheinen insgesamt nicht besonders viel über mich zu wissen, außer dass ich jung bin und dass sie meine Fingerabdrücke so oft durch ihre Datenbanken jagen können, wie sie wollen – sie bekommen keinen Treffer. Darum hassen sie mich so, darum bin ich vielleicht nicht der gefährlichste Verbrecher des ganzen Landes, aber der meistgesuchte. Denn ich lasse sie ziemlich dumm aussehen.
Es ist erst früher Abend, aber draußen ist es schon stockdunkel und das Licht der JumboTrons spiegelt sich in den Pfützen auf der Straße. Ich setze mich auf ein bröckelndes Fensterbrett im dritten Stock, verborgen hinter rostigen Stahlträgern. Das hier war ursprünglich mal ein Wohngebäude, heute aber ist es total verfallen. Der Boden in diesem Zimmer ist mit kaputten Lampen und Glassplittern übersät und von den Wänden blättert die Farbe. In einer Ecke liegt ein altes Porträt unseres Elektors auf dem Boden. Ich frage mich, wer hier wohl gelebt hat – niemand wäre dumm genug, das Bild unseres Staatsoberhauptes so achtlos im Dreck liegen zu lassen.
Meine Haare habe ich wie immer unter eine alte Ballonmütze gestopft. Mein Blick ruht auf dem kleinen eingeschossigen Haus auf der anderen Straßenseite. Meine Finger spielen mit dem Anhänger, der an einer Schnur um meinen Hals hängt.
Tess lehnt an dem anderen Fenster im Zimmer und beobachtet mich. Ich bin unruhig an diesem Abend und wie immer kann sie es spüren.
Die Seuche hat den Lake-Sektor schwer erwischt. Im Schein der JumboTrons können Tess und ich die Soldaten am anderen Ende der Straße sehen. Sie inspizieren Haus für Haus und tragen ihre glänzend schwarzen Umhänge der Hitze wegen offen. Sie haben alle Gasmasken auf. Manchmal, wenn sie ein Haus wieder verlassen, markieren sie die Tür mit einem großen roten X. Danach betritt oder verlässt niemand mehr dieses Haus – zumindest nicht so, dass es jemand mitbekommt.
»Siehst du sie immer noch nicht?«, flüstert Tess. Ihr Gesichtsausdruck ist durch die Schatten verborgen.
Um mich ein bisschen abzulenken, bastele ich eine kleine Schleuder aus alten PVC-Schläuchen. »Sie haben überhaupt nicht zu Abend gegessen. Sie haben schon seit Stunden nicht mehr am Tisch gesessen.« Ich verlagere mein Gewicht und strecke mein schmerzendes Knie.
»Vielleicht sind sie gar nicht zu Hause?«
Ich werfe Tess einen verdrossenen Blick zu. Sie versucht nur, mich zu trösten, aber danach ist mir jetzt nicht zumute. »Es brennt Licht. Guck doch mal, die Kerzen. Mom würde nie Kerzen verschwenden, wenn keiner zu Hause wäre.«
Tess tritt neben mich. »Wir sollten die Stadt für ein paar Wochen verlassen, okay?« Sie versucht, ihre Stimme ruhig klingen zu lassen, aber die Angst sickert trotzdem durch. »Die Seuche ebbt bestimmt bald wieder ab, dann kannst du zurück und sie besuchen. Wir haben mehr als genug Geld für zwei Zugtickets.«
Ich schüttele den Kopf. »Einen Abend pro Woche, weißt du nicht mehr? Lass mich einen Abend pro Woche nach ihnen sehen.«
»Klar. Aber diese Woche bist du jeden Abend hergekommen.«
»Ich will nur sehen, ob es ihnen gut geht.«
»Was ist, wenn du krank wirst?«
»Das Risiko gehe ich ein. Und du hättest ja auch nicht mitkommen müssen. Du hättest genauso gut in Alta auf mich warten können.«
Tess zuckt mit den Schultern. »Irgendwer muss ja ein Auge auf dich haben.« Zwei Jahre jünger als ich – und manchmal klingt sie trotzdem, als wäre sie mein Kindermädchen.
Wir sehen eine Weile schweigend zu, wie sich die Soldaten immer weiter auf das Haus meiner Familie zubewegen. Jedes Mal, wenn sie vor einem Haus stehen bleiben, hämmert einer von ihnen laut an die Tür, während ein zweiter mit der Waffe im Anschlag daneben steht. Wenn innerhalb von zehn Sekunden niemand öffnet, tritt der erste Soldat die Tür ein. Sobald sie drinnen sind, kann ich sie nicht mehr sehen, aber ich kenne das Prozedere: Ein Soldat nimmt von jedem Familienmitglied eine Blutprobe, schiebt sie in ein tragbares Analysegerät und testet sie auf die Seuche. In zehn Minuten ist das Ganze vorbei.
Ich zähle die Häuser, die noch zwischen dem meiner Familie und den Soldaten liegen. Ich werde noch etwa eine Stunde warten müssen, bis ich ihr Schicksal erfahre.
Ein Schrei gellt vom anderen Ende der Straße durch die Dunkelheit. Mein Blick huscht in die Richtung, aus der er gekommen ist, und meine Hand schnellt zu dem Messer an meinem Gürtel. Tess atmet scharf ein.
Es ist ein Seuchenopfer. Die Frau muss schon seit Monaten dahinsiechen, denn ihre Haut ist überall aufgesprungen und blutig, und ich frage mich, wie die Soldaten sie bei ihren früheren Kontrollen übersehen konnten. Eine Weile taumelt sie orientierungslos umher, dann fängt sie plötzlich an zu rennen, nur um zu stolpern und auf die Knie zu fallen.
Ich blicke wieder zu den Soldaten. Jetzt sehen sie sie auch. Der mit der gezogenen Waffe nähert sich ihr, die übrigen elf bleiben zurück und sehen zu. Ein Seuchenopfer stellt keine große Bedrohung dar. Der Soldat hebt sein Gewehr und zielt. Funken stieben um die infizierte Frau auf.
Sie bricht zusammen und bleibt reglos liegen. Der Soldat gesellt sich wieder zu seinen Kameraden.
Ich wünschte, wir könnten irgendwie an eins von diesen Gewehren kommen. So eine nette, kleine Waffe kostet auf dem Schwarzmarkt nicht viel – 480Noten, weniger als ein Herd. Wie alle Schusswaffen ist sie hochpräzise und nutzt magnetische und elektrische Felder, sodass man ein Ziel auf drei Häuserblocks Entfernung sicher trifft. Dad hat mal gesagt, dass sie diese Technologie bei den Kolonien geklaut haben, aber das würde die Republik natürlich nie zugeben. Wenn wir wollten, könnten Tess und ich uns fünf Stück davon kaufen … Über die Jahre haben wir uns angewöhnt, einen Teil des Geldes, das wir stehlen, zu horten und für Notfälle zu sparen. Aber das eigentliche Problem bei diesen Waffen sind nicht die Kosten. Man ist damit einfach zu leicht aufzuspüren. Jede von ihnen ist mit einem Sensor versehen, der Informationen über die Handform des Benutzers, seine Fingerabdrücke und seinen Aufenthaltsort speichert. Wenn sie mich auf diese Weise nicht schnappen würden, dann weiß ich auch nicht. Also bleibe ich lieber bei meinen selbst gebauten Waffen, Schleudern aus PVC und anderem Kinderspielzeug.
»Sie haben noch eins gefunden«, sagt Tess. Sie kneift die Augen zusammen, um besser sehen zu können.
Ich blicke nach unten und beobachte, wie die Soldaten aus einem weiteren Haus strömen. Einer von ihnen schüttelt eine Spraydose und sprüht ein riesiges rotes X an die Tür. Ich kenne dieses Haus. Zu der Familie, die dort wohnt, gehörte mal eine Tochter in meinem Alter. Als meine Brüder und ich noch klein waren, haben wir mit ihr gespielt – Blindekuh oder Straßenhockey mit alten Eisenstangen und Bällen aus zusammengeknülltem Papier.
Tess versucht mich abzulenken und deutet mit dem Kinn auf das Stoffbündel, das zu meinen Füßen liegt. »Was hast du ihnen mitgebracht?«
Ich lächele, dann bücke ich mich und knote das Päckchen auf. »Ein paar von den Sachen, die wir diese Woche zusammengetragen haben. Damit können sie ein bisschen feiern, wenn sie die Kontrolle überstanden haben.« Ich wühle in dem Sammelsurium von Mitbringseln und halte schließlich eine Schutzbrille hoch. Ich untersuche sie abermals, um sicherzugehen, dass das Glas nirgends gesprungen ist. »Für John. Ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk.« Mein älterer Bruder wird diese Woche neunzehn. Er schiebt Vierzehnstundenschichten am Dampfkessel in einem nahe gelegenen Kraftwerk, und wenn er nach Hause kommt, tränen ihm immer die Augen von dem ganzen Dampf. Die Brille war ein richtiger Glücksfund, den wir in einer Lieferung von Militärausrüstung aufgestöbert haben.
Ich lege sie zurück und krame in den restlichen Sachen. Hauptsächlich Konserven mit Eintopf, die ich in der Cafeteria eines Luftschiffs geklaut habe, und ein altes Paar Schuhe mit völlig intakten Sohlen. Ich wünschte, ich könnte dabei sein, wenn sie die Sachen bekommen. Aber John ist der Einzige, der weiß, dass ich am Leben bin, und er hat versprochen, Mom und Eden nichts zu verraten.
Eden wird in zwei Monaten zehn, was bedeutet, dass er in zwei Monaten den Großen Test machen muss. Ich habe den Test nicht bestanden, als ich zehn war. Darum mache ich mir Sorgen um Eden, denn auch wenn er der Cleverste von uns drei Brüdern ist, denkt er in vielen Dingen genauso wie ich. Als ich mit meinem Test fertig war, war ich mir meiner Antworten so sicher, dass ich noch nicht mal dabei zusah, wie sie sie bewerteten. Dann aber scheuchten mich die Betreuer zusammen mit einem Grüppchen anderer Kinder in eine Ecke des Großen Stadions. Sie stempelten meinen Testbogen ab und steckten mich in einen Zug Richtung Innenstadt. Ich konnte nichts mitnehmen bis auf den Anhänger, den ich um den Hals trug. Ich konnte mich noch nicht einmal verabschieden.
Nach dem Großen Test kann dein Leben in ganz unterschiedlichen Bahnen verlaufen.
Du erreichst die volle Punktzahl: 1500. Das hat noch nie jemand geschafft – na ja, bis auf irgendein Kind vor ein paar Jahren, wegen dem das Militär einen Riesenwirbel veranstaltet hat. Aber wer weiß schon, was das Schicksal für jemanden mit so einem Ergebnis bereithält? Wahrscheinlich haufenweise Geld und Macht.
Du erreichst eine Punktzahl zwischen 1450 und 1499. In dem Fall klopf dir selbst auf die Schulter, denn du darfst die nächsten Klassen überspringen und wirst direkt für sechs Jahre auf die Highschool und anschließend für vier Jahre auf eine der besten Universitäten der Republik geschickt: Drake, Stanford oder Brenan. Danach hast du eine Stelle im Kongress sicher und scheffelst richtig viel Geld – Glück und Zufriedenheit inklusive. Zumindest nach Ansicht der Republik.
Du erreichst eine gute Punktzahl irgendwo zwischen 1250 und 1449. In diesem Fall machst du ganz normal weiter bis zur Highschool und wirst danach einem College zugeteilt. Auch nicht übel.
Du bestehst mit Ach und Krach und einer Punktzahl zwischen 1000 und 1249. Der Kongress verwehrt dir den Zugang zur Highschool. Ab jetzt bist du arm, so wie meine Familie. In dem Fall ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du entweder bei der Arbeit an den Wasserturbinen ertrinkst oder der Dampf in den Kraftwerken dich langsam dahinrafft.
Du fällst durch.
Die Kinder, die durchfallen, stammen fast immer aus den Slumsektoren. Wenn du zu dieser unglückseligen Gruppe zählst, schickt die Republik einen Beamten zu deiner Familie nach Hause. Deine Eltern werden gezwungen, ein Dokument zu unterschreiben, mit dem sie der Regierung das alleinige Sorgerecht für dich übertragen. Sie erzählen deiner Familie, dass du in ein Arbeitslager der Republik geschickt wurdest und sie dich nie wiedersehen werden. Deine Eltern müssen nicken und einwilligen. Manchmal feiern sie sogar, denn immerhin zahlt ihnen die Republik eintausend Noten als Entschädigung. Geld und ein Maul weniger zu stopfen? Wie aufmerksam von unserer Regierung.
Abgesehen davon, dass das alles eine Lüge ist. Ein minderwertiges Kind mit schlechten Genen ist für das Land nicht von Nutzen. Wenn du Glück hast, lässt der Kongress dich einfach sterben, ohne dich vorher in die Labore zu schicken, wo du auf deine Unzulänglichkeiten hin untersucht wirst.
Noch fünf Häuser.
Tess sieht die Sorge in meinen Augen und legt mir die Hand auf die Stirn. »Bekommst du wieder deine Kopfschmerzen?«
»Nein. Alles okay.« Ich spähe in das geöffnete Fenster am Haus meiner Familie und erhasche zum ersten Mal einen Blick auf ein vertrautes Gesicht. Eden geht daran vorbei, lugt nach draußen zu den näher kommenden Soldaten und richtet irgendeinen selbst gebastelten Apparat aus Metall auf sie. Dann zieht er den Kopf wieder ein und verschwindet im Inneren des Hauses. Seine Locken schimmern weißblond im flackernden Licht der Lampe. So wie ich ihn kenne, hat er das Gerät wahrscheinlich gebaut, um zu messen, wie weit jemand von ihm entfernt ist oder so ähnlich.
»Er ist dünner geworden«, murmele ich.
»Er ist lebendig und wohlauf«, entgegnet Tess. »Ich würde sagen, das ist eine gute Nachricht.«
Ein paar Minuten später gehen John und meine Mutter an dem Fenster vorbei, vertieft in ein Gespräch. John und ich sehen uns ziemlich ähnlich, nur dass er durch seine langen Schichten im Kraftwerk etwas muskulöser geworden ist. Sein Haar reicht ihm, wie den meisten in unserem Sektor, bis über die Schultern und ist zu einem einfachen Pferdeschwanz gebunden. Sein Hemd hat rote Lehmflecken. Ich kann erkennen, dass Mom ihn wegen irgendwas ausschimpft, wahrscheinlich, weil er zugelassen hat, dass Eden aus dem Fenster guckt. Sie schlägt Johns Hand weg, als einer ihrer chronischen Hustenanfälle sie zu schütteln beginnt.
Ich atme aus. Gut. Wenigstens sind sie alle drei gesund genug, um auf den Beinen zu sein. Das heißt, selbst wenn sich einer von ihnen infiziert haben sollte, bestünde noch die Chance, dass sie wieder genesen.
Ich kann nicht aufhören, daran zu denken, was passieren würde, wenn die Soldaten unsere Haustür markieren. Meine Familie würde eine Weile wie versteinert in unserem Wohnzimmer stehen, nachdem die Soldaten gegangen wären. Irgendwann würde Mom ihr gewohnt tapferes Gesicht aufsetzen, um dann die ganze Nacht wach zu liegen und sich lautlos die Tränen wegzuwischen. Ab dem nächsten Morgen würden sie mit kleinen Essens- und Wasserrationen versorgt werden und nichts tun als abzuwarten, bis sie wieder gesund wurden. Oder starben.
Meine Gedanken wandern zu dem Geheimvorrat an gestohlenem Geld, den Tess und ich angelegt haben. Zweitausendfünfhundert Noten. Genug, um uns ein paar Monate über Wasser zu halten … aber nicht genug, um meiner Familie ein paar Fläschchen Seuchenmedizin zu kaufen.
Die Minuten ziehen sich hin. Ich stecke meine Schleuder weg und spiele ein paar Runden Schere-Stein-Papier mit Tess. (Ich weiß nicht, wie sie das macht, aber sie ist so gut wie unschlagbar in diesem Spiel.) Hin und wieder werfe ich einen Blick zum Fenster unseres Hauses hinüber, aber ich kann niemanden sehen. Sie müssen sich nahe der Tür versammelt haben, bereit, sie zu öffnen, sobald sie eine Faust an das Holz hämmern hören.
Und dann ist der Zeitpunkt gekommen.
Ich lehne mich so weit über das Fensterbrett, dass Tess mich beim Arm packt, damit ich nicht kopfüber auf die Straße plumpse.
Die Soldaten klopfen an die Tür. Meine Mutter macht sofort auf, lässt sie herein und schließt die Tür wieder. Ich lausche angestrengt auf Stimmen oder Schritte, irgendwas, das aus meinem Zuhause zu mir heraufdringt. Je schneller das alles vorüber ist, desto früher kann ich John meine Geschenke zustecken.
Die Stille nimmt kein Ende.
Tess flüstert: »Keine Nachrichten sind gute Nachrichten, nicht?«
»Sehr witzig.«
Im Kopf zähle ich die Sekunden. Eine Minute vergeht. Dann zwei, dann vier, und schließlich sind es zehn.
Fünfzehn Minuten. Zwanzig.
Ich sehe Tess an. Sie zuckt mit den Schultern. »Vielleicht ist ja ihr Analysegerät kaputt«, meint sie.
Dreißig Minuten vergehen.
Ich wage nicht, mich von meinem Beobachtungsposten wegzubewegen. Ich traue mich kaum zu blinzeln, aus Angst, dass ausgerechnet dann irgendwas Wichtiges passiert. Meine Finger trommeln einen Rhythmus auf den Griff meines Messers.
Vierzig Minuten. Fünfzig Minuten. Eine Stunde.
»Da stimmt was nicht«, flüstere ich.
Tess schürzt die Lippen. »Das kannst du nicht wissen.«
»Doch, ich weiß es. Was soll denn da so lange dauern?«
Tess öffnet den Mund, um zu antworten, doch bevor sie etwas sagen kann, kommen die Soldaten aus unserem Haus, einer nach dem anderen, die Gesichter ausdruckslos. Der letzte Soldat schließt die Tür hinter sich und greift nach etwas, das an seinem Gürtel befestigt ist. Mir wird schwindelig. Ich weiß, was jetzt kommt.
Der Soldat hebt den Arm und sprüht eine lange rote Linie diagonal über unsere Tür. Dann eine zweite, sodass ein X entsteht.
Ich fluche leise und will mich schon abwenden – doch dann tut der Soldat etwas Unerwartetes, etwas, das ich noch nie zuvor gesehen habe.
Er sprüht eine dritte, vertikale Linie auf unsere Haustür und teilt das X damit in zwei Hälften.
JUNE
13:47 UHR DRAKE-UNIVERSITÄT, SEKTOR BATALLA INNENTEMPERATUR: 22 °C
Ich sitze im Vorzimmer des Dekans. Mal wieder. Auf der anderen Seite der Milchglastür lungern ein paar meiner Kommilitonen herum (alle kurz vor dem Abschluss und mindestens vier Jahre älter als ich), die aufzuschnappen versuchen, was los ist. Einige von ihnen haben mitbekommen, wie ich während des Nachmittagstrainings (heutiger Schwerpunkt: das Laden und Entladen eines XM-621-Gewehrs) von zwei bedrohlich aussehenden Wachen davongezerrt wurde. Und jedes Mal, wenn so was passiert, breitet sich die Neuigkeit rasend schnell über den ganzen Campus aus. Das Wunderkind der Republik hat mal wieder was ausgefressen.
Im Büro ist es ruhig bis auf das leise Summen des Computers auf dem Schreibtisch der Sekretärin. Ich habe mir jedes einzelne Detail dieses Raums eingeprägt (handgeschliffene Bodenfliesen aus Marmor – Dakota-Import–, 324 quadratische Deckenplatten aus Kunststoff, sechseinhalb Meter grauer Vorhang zu beiden Seiten des Porträts unseres ehrwürdigen Elektors an der Rückwand des Büros, ein stumm geschalteter 30-Zoll-Bildschirm an der Seitenwand, der soeben die Schlagzeile Gruppe rebellischer Patrioten zündet Bombe in örtlichem Militärstützpunkt, fünf Tote zeigt, gefolgt von der nächsten: Republik schlägt Kolonien in Schlacht um Hillsboro). Arisna Whitaker, die Dekanatssekretärin höchstpersönlich, sitzt an ihrem Schreibtisch und tippt mit den Fingern auf die Glasplatte ein – wahrscheinlich schreibt sie an meinem Verweis. Meinem achten in diesem Quartal. Ich möchte wetten, dass ich die einzige Studentin an der Drake bin, die es jemals geschafft hat, acht Verweise in einem Quartal zu bekommen, ohne von der Uni zu fliegen.
»Haben Sie sich an der Hand verletzt, Ms Whitaker?«, frage ich nach einer Weile.
Sie hört auf zu tippen und wirft mir einen finsteren Blick zu. »Wie kommen Sie darauf, Ms Iparis?«
»Ihr Tippen ist unregelmäßig. Sie versuchen, Ihre rechte Hand zu schonen.«
Ms Whitaker seufzt und lehnt sich in ihrem Stuhl zurück. »Ja, June. Ich habe mir gestern beim Kivaballspielen das Handgelenk verstaucht.«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!