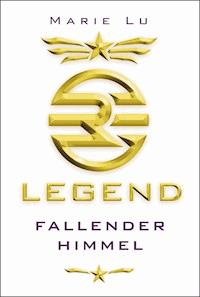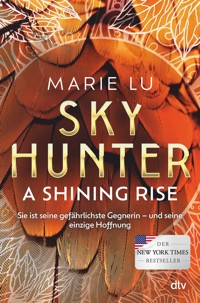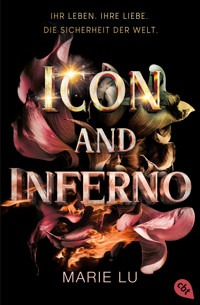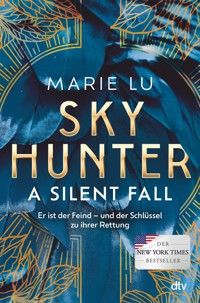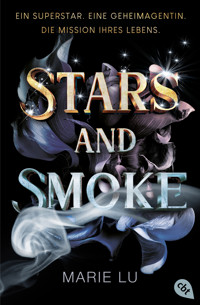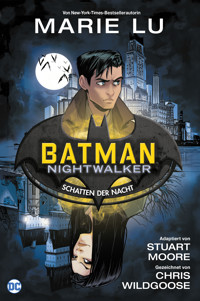Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Young Elites
- Sprache: Deutsch
Nach Legend taucht Bestsellerautorin Marie Lu mit ihrer neuen historischen Fantasy-Reihe Young Elites in eine Welt voller Magie ein und zeigt eine Heldin, die zwischen Liebe und Dunkelheit gefangen ist. Über Nacht verfärbten sich Adelinas wunderschöne schwarze Haare plötzlich silbern. Seit sie das mysteriöse Blutfieber überlebte, ist die Tochter eines reichen Kaufmanns gezeichnet und von der Gesellschaft verstoßen. Aber die Krankheit hat ihr nicht nur eine strahlende Zukunft genommen, sondern auch übernatürliche Kräfte verliehen. Und Adelina ist nicht die Einzige. Die Gemeinschaft der Dolche wird vom König gejagt und gefürchtet, denn mit ihren unerklärlichen Fähigkeiten sind sie imstande, ihn vom Thron zu stürzen. Doch dazu benötigen sie Adelinas Hilfe ... X-Men meets Die rote Königin: Eingebettet in eine märchenhafte Welt, die an das Venedig der Renaissance erinnert, erzählt Spiegel-Bestsellerautorin Marie Lu die Geschichte von Adelina, einer sehr komplexen Heldin, die zunehmend von der rachgierigen Dunkelheit, die sie in sich trägt, übermannt wird. Ob ihre Liebe zu Prinz Enzo sie retten kann? Nach dem New York Times-Bestseller Legend der grandiose Auftakt zu einer neuen originellen und actionreichen Fantasy-Trilogie der Autorin. "Die Gemeinschaft der Dolche" ist der erste Band der Young Elites-Trilogie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vierhundert sind bereits gestorben. Ich bete darum, dass es den Euren besser ergehen mag. Wegen der Quarantänebestimmungen hat die Stadt alle Frühlingsmond-Feierlichkeiten untersagt und die traditionellen Maskenspiele sind ebenso rar geworden wie Fleisch und Eier.
Die meisten Kinder auf unserer Station sind nach ihrer Genesung von der Krankheit aufs Absonderlichste gezeichnet. Das Haar eines Mädchens hat sich über Nacht von Goldblond zu Schwarz verfärbt. Das Gesicht eines sechsjährigen Jungen ist plötzlich mit Narben übersät, ohne dass er sich verletzt hätte. Die anderen Ärzte sind wie von Sinnen vor Angst. Bitte um Nachricht, ob Ihr Ähnliches beobachtet, Sir. Mir ist, als läge etwas Außergewöhnliches in der Luft, und ich brenne darauf, dieses Phänomen eingehender zu studieren.
Brief von Dtt. Siriano Baglio an Dtt. Marino Di Segna
31.
13.JUNO 1361
DALIA
Manche hassen uns wie Verbrecher, die es zu hängen gilt.
Manche fürchten uns wie Dämonen, die es zu verbrennen gilt.
Manche verehren uns wie Kinder der Götter.
Aber ein jeder kennt uns.
Über die Elite der Begabten, Quelle unbekannt
ADELINA AMOUTERU
Morgen früh werde ich sterben.
Das sagen zumindest die Inquisitoren, wenn sie in meine Zelle kommen. Seit Wochen bin ich hier gefangen – und das weiß ich nur, weil ich die Mahlzeiten, die sie mir bringen, gezählt habe.
Ein Tag. Zwei Tage.
Vier Tage. Eine Woche.
Zwei Wochen.
Drei.
Danach habe ich aufgehört zu zählen. Die Stunden verschwimmen zu einem endlosen Strang aus Leere, erfüllt nur vom flackernden Schein der Fackeln, wenn meine Tür sich öffnet, dem Frösteln auf kaltem, feuchtem Stein, den Resten meiner Vernunft, dem zusammenhanglosen Wispern meiner Gedanken.
Doch damit wird es morgen vorbei sein. Sie werden mich vor aller Augen auf dem Marktplatz verbrennen. Die Inquisitoren sagen, dass sich dort draußen bereits die Schaulustigen zusammenfinden.
Ich sitze kerzengerade, so wie man es mich gelehrt hat. Meine Schultern berühren nicht die Wand. Es dauert eine Weile, bis mir bewusst wird, dass ich mich vor und zurück wiege, vielleicht, um nicht den Verstand zu verlieren, vielleicht, um mich warm zu halten. Dabei summe ich ein altes Schlaflied vor mich hin, das meine Mutter mir oft vorgesungen hat, als ich klein war. Ich versuche, den zarten, liebevollen Klang ihrer Stimme nachzuahmen, doch bei mir klingt es heiser und abgehackt, kein bisschen so wie in meiner Erinnerung. Also gebe ich es auf.
Es ist so schrecklich feucht hier unten. Von einer Stelle über der Tür sickert Wasser die Mauer herab und gräbt eine Furche in den Stein, kränklich grün und schwarz vor Ruß. Mein Haar ist verfilzt, meine Nägel verkrustet mit Blut und Dreck. Wie gern würde ich sie sauber schrubben. Ist es seltsam, dass ich an meinem letzten Tag ununterbrochen darüber nachgrübele, wie schmutzig ich bin? Wenn meine kleine Schwester hier wäre, würde sie mir beruhigende Worte ins Ohr murmeln und meine Hände in warmes Wasser tauchen.
Immer wieder frage ich mich, ob es ihr gut geht. Sie ist kein einziges Mal gekommen, um mich zu sehen.
Ich lasse meinen Kopf in die Hände sinken. Wie konnte ich bloß so enden?
Aber das weiß ich natürlich. Die Antwort lautet: weil ich eine Mörderin bin.
Alles begann vor wenigen Wochen in einer stürmischen Nacht in der Villa meines Vaters. Ich konnte nicht schlafen. Draußen rauschte der Regen und Blitze erhellten meine Schlafkammer. Doch selbst das Unwetter vermochte das Gespräch im Erdgeschoss nicht zu übertönen. Mein Vater und sein Gast redeten über mich, natürlich. In den spätabendlichen Gesprächen meines Vaters ging es immer um mich.
Überall in Dalias Osten, wo meine Familie zu Hause war, redete man über mich. »Adelina Amouteru?«, hieß es. »Ach, eine von denen, die vor zehn Jahren das Fieber überlebt haben. Armes Ding. Ihr Vater wird es schwer haben, sie zu verheiraten.«
Niemand meinte damit, dass ich nicht schön genug sei. Ich bin nicht eingebildet – bloß ehrlich. Meine Kinderfrau hat einmal zu mir gesagt: Jeder Mann, der meine verstorbene Mutter erblickt habe, warte voller Neugier darauf, dass deren zwei Töchter zu Frauen heranreiften. Meine jüngere Schwester, Violetta, ist erst vierzehn und bereits der Inbegriff knospender Perfektion. Im Gegensatz zu mir hat Violetta die Sanftmut und den unschuldigen Liebreiz unserer Mutter geerbt. Ständig küsste sie mich auf die Wangen, lachte, tanzte, träumte. Als wir noch klein waren, saßen wir oft zusammen im Garten und sie flocht mir Immergrün ins Haar. Ich sang ihr vor. Sie erfand immer neue Spiele.
Damals liebten wir einander.
Mein Vater brachte Violetta oft Schmuck mit und sah zu, wie sie verzückt in die Hände klatschte, während er ihn ihr um den Hals legte. Er kaufte ihr teure Kleider, die er aus den entferntesten Winkeln der Welt herbeischiffen ließ. Er erzählte ihr Geschichten und gab ihr Gutenachtküsse. Ständig sagte er ihr, wie schön sie sei, in welch guten Stand sie unsere Familie mit einer guten Hochzeit erheben würde, dass sie selbst die Herzen von Prinzen und Königen gewinnen könne, wenn sie es nur wünsche. Violetta hatte schon damals eine ganze Riege von Verehrern, die sie sofort geheiratet hätten, aber mein Vater ermahnte sie alle zur Geduld und bestand darauf, dass Violetta nicht heiratete, ehe sie siebzehn wurde. Was für ein fürsorglicher Vater, dachten die Leute.
Natürlich war auch Violetta nicht vollauf vor der Grausamkeit unseres Vaters geschützt. Manchmal kaufte er ihr mit Absicht Kleider, die zu eng waren und ihr Schmerzen bereiteten. Er genoss den Anblick ihrer blutenden Füße in den harten, juwelenbesetzten Schuhen, die zu tragen er sie anhielt.
Dennoch. Auf seine Art liebte er sie. Der Unterschied zwischen uns lag darin, dass er Violetta als Investition betrachtete.
Bei mir war derlei nicht möglich. Anders als meine Schwester, die mit bronzefarbener Haut und glänzendem schwarzen Haar gesegnet ist, das ihre grünen Augen betont, bin ich alles andere als makellos. Und dies ist der Grund dafür: Als ich vier Jahre alt war, wütete das Blutfieber gerade am heftigsten und die Einwohner von Kenettra verrammelten ängstlich ihre Türen. Vergeblich. Meine Mutter, meine Schwester und ich wurden krank. Man erkannte sofort, wer das Fieber hatte – an dem seltsamen Fleckenmuster, das auf unserer Haut erschien, daran, dass unsere Haare und Wimpern von einer Farbe zur anderen wechselten und uns rötliche, vom Blut getönte Tränen über die Wangen rannen. Ich kann mich noch gut an den Geruch der Krankheit in unserem Haus erinnern, an den Geschmack von Branntwein auf meinen Lippen. Mein linkes Auge schwoll so stark an, dass die Ärzte es entfernen mussten – mit einem rot glühenden Messer und einer Zange.
Also, ja: Man könnte sagen, ich bin mit Makeln behaftet.
Mit Makeln behaftet. Ich trage die Zeichen eines Malfettos.
Während meine Schwester das Fieber unbeschadet überstand, habe ich nun eine Narbe an der Stelle, wo einst mein linkes Auge war. Während das Haar meiner Schwester sein glänzendes Schwarz behalten hat, hat sich meins zu einem sonderbaren, unbeständigen Silber verfärbt. In der Sonne wirkt es fast so weiß wie der Wintermond, im Dunklen dagegen verwandelt es sich in ein tiefes Grau, als hätte man Metall zu schimmernder Seide gesponnen.
Doch zumindest ist es mir besser ergangen als Mutter. Sie ist, wie alle Erwachsenen, die das Fieber ereilt hat, daran gestorben. Ich erinnere mich, wie ich Nacht für Nacht weinend in ihrer leeren Schlafkammer hockte und mir wünschte, das Fieber hätte uns nicht sie, sondern Vater genommen.
Mein Vater und sein geheimnisvoller Gast unterhielten sich noch immer. Schließlich siegte meine Neugier und ich schwang die Beine über die Bettkante, schlich auf Zehenspitzen zur Tür meiner Kammer und öffnete sie einen Spaltbreit. Der Flur war von schwachem Kerzenlicht erhellt. Unten saß mein Vater einem breitschultrigen Mann gegenüber. Der Fremde trug sein Haar, das an den Schläfen leicht ergraut war, im Nacken zu einem kurzen, schlichten Zopf gebunden und sein Samtmantel schimmerte im Schein der Kerzen schwarz und orange. Auch der Mantel meines Vaters war aus Samt, aber der Stoff war längst abgewetzt und dünn. Bevor das Blutfieber unser Land heimgesucht hatte, waren seine Kleider genauso erlesen gewesen wie die seines Gastes. Aber heute? Es ist schwer, gute Geschäftsbeziehungen aufrechtzuerhalten, wenn man eine Malfetto-Tochter im Haus hat, die den Familiennamen beschmutzt.
Beide Männer tranken Wein. Vater muss in Verhandlungslaune sein, dachte ich, wenn er eins unserer letzten guten Fässer geöffnet hat.
Ich schob die Tür ein Stückchen weiter auf, huschte über den Flur und setzte mich, die Knie bis ans Kinn hochgezogen, auf die Treppe. Mein Lieblingsplatz. Manchmal stellte ich mir vor, ich wäre eine Königin, die von ihrem Palastbalkon auf ihr unterwürfiges Volk herabblickt. Jetzt jedoch hockte ich bloß auf meiner gewohnten Stufe und lauschte dem Gespräch im Erdgeschoss. Wie immer achtete ich sorgsam darauf, dass mein Haar die Narbe in meinem Gesicht verdeckte. Meine Hand ruhte etwas unbeholfen auf der Brüstung neben mir. Vater hatte mir den Ringfinger gebrochen und der Knochen war schief zusammengewachsen. Noch heute konnte ich ihn nicht ganz um das Geländer krümmen.
»Ich möchte Euch nicht beleidigen, Master Amouteru«, sagte der Mann unten zu meinem Vater. »Ihr wart einst ein angesehener Kaufmann. Aber das ist lange her. Ich will nicht öffentlich mit einer Malfetto-Familie Geschäfte machen – das bringt Unglück, wie Ihr wisst. Es gibt einfach nicht viel, was Ihr mir anbieten könntet.«
Mein Vater lächelte weiter. Das falsche Lächeln eines Kaufmanns. »Einige Kreditgeber in der Stadt arbeiten immer noch mit mir zusammen. Ich werde Euch das Geld ganz sicher zurückzahlen können, sobald der Hafenverkehr wieder besser läuft. Auf dem Markt sind tamourische Seide und Gewürze dieses Jahr überaus gefragt–«
Der Mann wirkte völlig unbeeindruckt. »Der König ist dumm wie ein Hund«, erwiderte er. »Und Hunde taugen nicht dazu, ein Land zu regieren. Ich fürchte, der Hafenverkehr wird noch über Jahre schwach laufen, und mit den neuen Steuergesetzen werden Eure Schulden nur weiter steigen. Wie wollt Ihr mir das Geld da jemals zurückzahlen?«
Mein Vater lehnte sich in seinem Sessel zurück, nippte an seinem Wein und seufzte. »Es muss doch etwas geben, das Euch interessieren würde.«
Der Mann starrte nachdenklich in sein Weinglas. Seine groben Gesichtszüge jagten mir einen Schauder über den Rücken. »Erzählt mir von Adelina. Wie viele Angebote habt Ihr schon für sie erhalten?«
Mein Vater errötete. Als ob der Wein dafür nicht schon zur Genüge gesorgt hätte. »Die Angebote für Adelina lassen noch auf sich warten.«
Der Mann lächelte. »Niemand interessiert sich also für Euer kleines Monstrum?«
Mein Vater presste die Lippen zusammen. »Nicht so viele, wie mir lieb wären«, gab er zu.
»Was sagen denn die anderen über sie?«
»Die anderen Verehrer?« Mein Vater rieb sich mit der Hand übers Gesicht. Er schämte sich, über meine Makel zu reden. »Sie sagen alle dasselbe. Am Ende scheitert es immer daran, dass sie … gezeichnet ist. Was soll man anderes erwarten, Sir? Niemand will, dass ein Malfetto seine Kinder austrägt.«
Der Mann hörte zu und brummte verständnisvoll.
»Habt Ihr etwa nicht die Neuigkeiten aus Estenzia gehört? Von den zwei Edelmännern, die auf dem Heimweg von der Oper waren und bis zur Unkenntlichkeit verbrannt aufgefunden wurden?« Mein Vater versuchte eine neue Taktik; er hoffte wohl, dass der Fremde Mitleid mit ihm haben würde. »Rußspuren an der Mauer, die Leichen von innen heraus verkohlt. Jedermann fürchtet sich vor den Malfettos, Sir. Ihr selbst scheut Euch sogar, mit mir Geschäfte zu machen. Bitte. Ich weiß allmählich nicht mehr weiter.«
Ich wusste, worauf mein Vater anspielte. Auf eine ganz bestimmte Art von Malfettos, eine kleine Gruppe von Kindern und Jugendlichen, die nach dem Blutfieber weitaus tiefere Narben davongetragen hatten als ich – in Form von furchterregenden Kräften, die nicht von dieser Welt waren. Über diese Malfettos redete man mit gedämpften Stimmen; die meisten Menschen fürchteten sie und nannten sie Dämonen. Ich dagegen war insgeheim fasziniert von ihnen. Es hieß, dass sie aus dem Nichts Feuer heraufbeschwören konnten. Den Wind beherrschen. Wilde Tiere zähmen. Unsichtbar werden. Mit einem einzigen Blick töten.
Auf dem Schwarzmarkt fand man manchmal flache Holzstücke, die mit aufwendigen Schnitzereien ihrer Namen versehen waren: verbotene Sammlerstücke, die angeblich dafür sorgten, dass sie einen beschützten – oder zumindest, dass sie einem nichts zuleide taten. Wie auch immer man darüber dachte, jeder kannte ihre Namen. Der Schnitter. Magiano. Die Windzähmerin. Der Alchimist.
Die Elite der Begabten.
Der Mann schüttelte den Kopf. »Ich habe gehört, dass selbst die Verehrer, die Adelina ablehnen, nicht den Blick von ihr wenden können.« Er hielt kurz inne. »Gewiss, dass sie derart gezeichnet ist, ist … ungünstig. Aber ein schönes Mädchen bleibt ein schönes Mädchen.« Ein seltsames Funkeln trat in seine Augen. Mein Magen verkrampfte sich bei dem Anblick und ich presste mein Kinn fester auf meine Knie, als könnte ich mich dadurch schützen.
Mein Vater schien verwirrt. Er richtete sich in seinem Stuhl auf und deutete mit seinem Weinglas auf den Mann. »Wollt Ihr mich um Adelinas Hand bitten?«
Der Mann griff in seine Tasche, zog eine kleine braune Börse heraus und warf sie auf den Tisch, wo sie mit einem schweren Klimpern landete. Als Tochter eines Kaufmanns kennt man sich mit Geld aus – und ich schloss aus dem Geräusch der Münzen, dass der Beutel bis zum Rand mit Goldtalenten gefüllt sein musste. Ich unterdrückte ein Keuchen.
Während mein Vater nach der Börse griff und hineinstarrte, lehnte sich der Mann zurück und nippte nachdenklich an seinem Wein. »Ich weiß um Eure Steuerzahlungen, die bei der Krone noch ausstehen. Ich weiß auch um Eure neuen Schulden. Und ich bin bereit, für all das aufzukommen, im Austausch gegen Eure Tochter Adelina.«
Mein Vater runzelte die Stirn. »Aber Ihr habt doch bereits eine Ehefrau.«
»In der Tat, das habe ich.« Der Mann hielt kurz inne und fügte dann hinzu: »Ich habe auch nie behauptet, sie heiraten zu wollen. Ich biete Euch lediglich an, sie Euch abzunehmen.«
Ich konnte förmlich spüren, wie mir alles Blut aus dem Gesicht wich.
»Dann … wollt Ihr sie als Eure Mätresse?«, fragte Vater.
Der Mann zuckte mit den Schultern. »Kein Edelmann, der recht bei Verstand ist, würde ein derart gezeichnetes Mädchen zu seiner Frau nehmen – ich könnte mich wohl kaum mit ihr in der Öffentlichkeit sehen lassen. Schließlich habe ich einen Ruf zu wahren, Master Amouteru. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir uns einig werden. Sie wird ein Zuhause haben und Ihr bekommt Euer Gold.« Er hob eine Hand. »Unter einer Bedingung: Ich will sie jetzt, nicht erst in einem Jahr. Ich habe nicht die Geduld zu warten, bis sie siebzehn ist.«
Ein seltsames Dröhnen erfüllte meine Ohren. Keinem Jungen oder Mädchen war es erlaubt, seine Tugend hinzugeben, bevor er oder sie siebzehn war. Dieser Mann verlangte von meinem Vater, dass er das Gesetz brach. Dass er dem Willen der Götter zuwiderhandelte.
Mein Vater hob eine Augenbraue, doch er protestierte nicht. »Als Eure Mätresse«, wiederholte er schließlich. »Sir, Ihr müsst wissen, welche Folgen das für meinen Ruf hat. Da könnte ich sie ebenso gut an ein Bordell verkaufen.«
»Und wie ist es derzeit um Euren Ruf bestellt? Wie sehr hat sie Eurem guten Namen als Kaufmann bereits geschadet?« Der Fremde beugte sich vor. »Ich bin sicher, Ihr wollt damit nicht andeuten, mein Haus sei nicht besser als ein gewöhnliches Bordell. Zumindest würde Eure Adelina so Teil einer angesehenen Familie werden.«
Während ich beobachtete, wie mein Vater seinen Wein trank, begannen meine Hände zu zittern. »Als Mätresse«, murmelte er abermals.
»Entscheidet Euch rasch, Master Amouteru. Ich werde mein Angebot nicht wiederholen.«
»Gebt mir nur einen Moment«, bat mein Vater hastig.
Ich weiß nicht, wie lange das Schweigen andauerte, doch als er das nächste Mal zu sprechen anfing, zuckte ich beim Klang seiner Stimme zusammen.
»Ihr hättet sicher Eure Freude an Adelina. Das habt Ihr gut erkannt. Sie ist hübsch, trotzdem sie gezeichnet ist, und sie hat … Temperament.«
Der Mann ließ seinen Wein im Glas kreisen. »Ich werde sie zu zähmen wissen. Also, kommen wir ins Geschäft?«
Ich schloss mein Auge. Meine Welt versank in Dunkelheit – ich stellte mir das Gesicht des Mannes dicht an meinem vor, sein widerwärtiges Lächeln. Nicht mal eine Ehefrau. Eine Mätresse. Der Gedanke ließ mich von der Treppe aufspringen. Wie in Nebel gehüllt sah ich, wie mein Vater dem Mann die Hand schüttelte und mit ihm anstieß.
»Einverstanden«, sagte er zu ihm. Er wirkte, als wäre eine riesige Last von ihm abgefallen. »Morgen gehört sie Euch. Aber … bitte behaltet die Sache für Euch. Ich will nicht, dass eines Tages die Inquisition vor meiner Tür steht, weil ich sie zu jung fortgegeben habe.«
»Sie ist ein Malfetto«, erwiderte der Mann. »Niemand wird sich dafür interessieren.« Er zog seine Handschuhe zurecht und erhob sich mit einer einzigen fließenden Bewegung aus dem Sessel. Mein Vater neigte den Kopf. »Ich schicke gleich morgen früh eine Kutsche für sie.«
Während mein Vater den Fremden zur Tür begleitete, huschte ich zurück in meine Kammer und blieb dort zitternd im Dunkel stehen. Warum trafen mich die Worte meines Vaters nach all den Jahren noch immer so sehr? Ich sollte längst daran gewöhnt sein. Was hatte er einmal zu mir gesagt? Meine arme Adelina. Seufzend hatte er mir mit dem Daumen über die Wange gestrichen. Es ist wirklich eine Schande. Sieh dich nur an. Wer würde jemals ein Malfetto wie dich heiraten?
Es wird schon alles gut werden, versuchte ich, mich zu beruhigen. Wenigstens kommst du endlich von deinem Vater los. So schlimm wird es wohl nicht werden. Doch noch während ich mir das einzureden versuchte, spürte ich, wie sich etwas Schweres auf meine Brust senkte. Ich kannte die Wahrheit. Malfettos waren unerwünscht. Sie verhießen Unglück. Und sie waren gefürchtet, heute mehr denn je. Der Mann würde mich davonjagen, sobald er genug von mir hatte.
Mein Blick flog durch die Kammer und verharrte schließlich auf dem Fenster. Einen Moment lang schien mein Herz ins Stocken zu geraten. Der Regen zeichnete gezackte Linien auf die Scheiben, doch dahinter sah ich das tiefblaue Häusermeer von Dalia, die Reihen kuppelgekrönter Backsteintürme und die kopfsteingepflasterten Gassen, die Marmortempel, den Hafen, dort, wo die Stadt sanft zum Wasser abfiel, wo man in klaren Nächten die Gondeln mit ihren goldenen Laternen dahingleiten sah, wo an der Grenze zu Süd-Kenettra donnernd die Wasserfälle in die Tiefe stürzten. Heute Nacht aber war der Ozean aufgewühlt und weißer Schaum ergoss sich zornig über die Ausläufer der Stadt und flutete die Kanäle.
Lange Zeit starrte ich aus dem regennassen Fenster.
Heute Nacht. Heute Nacht war es so weit.
Ich eilte zu meinem Bett, kniete mich daneben und zog den Sack darunter hervor, den ich aus einem Bettlaken geknotet hatte. Er war mit feinstem Silber gefüllt, Gabeln und Messern, Kerzenhaltern, verzierten Tellern – mit allem, was sich gegen Essen und ein Dach über dem Kopf eintauschen ließ. Das ist noch so etwas Liebenswertes an mir: Ich bin eine Diebin. Schon seit Monaten hatte ich Dinge aus dem Haus gestohlen und unter meinem Bett gesammelt, als Vorbereitung für den Tag, an dem ich das Leben mit meinem Vater nicht länger ertrug. Es war nicht viel, aber nach meinen Berechnungen sollte es mir ein paar Goldtaler einbringen, wenn ich es an die richtigen Händler verkaufte. Genug, um mich zumindest ein paar Monate über Wasser zu halten.
Als Nächstes öffnete ich meine Kleidertruhe und nahm einen Armvoll Seidengewänder heraus, dann huschte ich durch meine Kammer und sammelte jeglichen Schmuck ein, der sich finden ließ. Meine silbernen Armbänder. Eine Perlenkette, die ich von meiner Mutter geerbt hatte, nachdem meine Schwester sie nicht gewollt hatte. Ein Paar Saphirohrringe. Ich griff mir zwei lange Stücke Seidentuch, mit denen ich mir manchmal einen tamourischen Turban band. Auf der Flucht würde ich mein silbernes Haar verbergen müssen. Ich arbeitete schnell, aber konzentriert. Behutsam packte ich den Schmuck und die Kleider in den Sack, den ich anschließend hinter meinem Bett versteckte, während ich in meine Reitstiefel aus weichem Leder schlüpfte.
Dann setzte ich mich hin und wartete.
Eine Stunde später, nachdem mein Vater zu Bett gegangen und im Haus Stille eingekehrt war, zog ich den Sack wieder hervor. Ich ging zum Fenster und presste die Hand auf die Scheibe. Vorsichtig schob ich den linken Flügel auf.
Der Sturm hatte ein wenig nachgelassen, aber es regnete immer noch so stark, dass das Prasseln meine Schritte übertönte. Ich drehte mich noch einmal um und warf einen letzten Blick zurück in meine Kammer, zur Tür, als könnte jeden Moment mein Vater hindurchtreten. Wo willst du denn hin, Adelina?, würde er fragen. Da draußen gibt es nichts für ein Mädchen wie dich.
Ich schüttelte seine Stimme aus meinen Gedanken. Sollte er ruhig morgen früh feststellen, dass ich, seine beste Chance, jemals seine Schulden zu begleichen, fort war. Ich holte tief Luft und machte mich daran, durchs Fenster zu klettern. Kalter Regen klatschte mir auf die Arme und ließ meine Haut kribbeln.
»Adelina?«
Ich fuhr herum. Hinter mir war die Silhouette eines Mädchens in meiner Zimmertür aufgetaucht – meine Schwester Violetta, die sich den Schlaf aus den Augen rieb. Sie starrte auf das offene Fenster und den Sack über meiner Schulter und einen schrecklichen Moment lang war ich überzeugt, dass sie nach unserem Vater schreien würde.
Doch Violetta sah mich nur schweigend an. Schuldgefühle durchzuckten mich, während mich ihr Anblick gleichzeitig mit Bitterkeit erfüllte. Ich Dummkopf. Warum sollte es mir um jemanden leidtun, der so oft tatenlos zugesehen hatte, wie ich gequält wurde? Ich liebe dich, Adelina, hatte sie immer gesagt, als wir noch klein waren. Und Papa liebt dich auch. Er kann es nur nicht zeigen. Warum hatte ich Mitleid mit der Schwester, die von unserem Vater auf Händen getragen wurde? Warum fühlte ich mich schuldig, sie zurückzulassen?
Und doch huschte ich, ohne darüber nachzudenken, lautlos auf sie zu, nahm ihre Hand in meine und legte ihr einen Finger auf die Lippen.
Sie musterte mich besorgt. »Du solltest zurück ins Bett gehen«, flüsterte sie. Im fahlen Mondlicht sah ich das Schimmern ihrer dunklen Marmoraugen, die Zartheit ihrer Haut. Ihre Schönheit war so ungetrübt. »Du bekommst nur Ärger, wenn Vater dich erwischt.«
Ich drückte ihre Hand fester und lehnte meine Stirn an ihre. So blieben wir einen Moment lang stehen und es war, als wären wir wieder Kinder, die sich aufeinander stützten. Normalerweise war Violetta diejenige, die sich von mir löste, denn sie wusste, dass Vater uns nicht gern so vertraut miteinander sah. Diesmal jedoch schmiegte sie sich an mich. Als wüsste sie bereits, dass heute etwas anders war als sonst.
»Violetta«, flüsterte ich, »weißt du noch, wie du Vater damals angelogen hast, als es darum ging, wer von uns beiden seine wertvolle Vase zerbrochen hatte?«
Meine Schwester nickte an meiner Schulter.
»Das musst du heute noch einmal für mich tun.« Ich zog den Kopf weit genug zurück, um ihr das Haar hinters Ohr zu streichen. »Verrate ihm kein Wort.«
Sie sagte nichts; stattdessen schluckte sie und sah den Flur hinunter zur Kammer unseres Vaters. Sie hasste ihn nicht so sehr wie ich und bei der Vorstellung, sich seinen Ermahnungen zu widersetzen – dass sie zu gut für mich sei, dass es dumm sei, mich zu lieben–, bekam sie ein schlechtes Gewissen. Nach einer Weile aber nickte sie.
Mir war, als hätte sich ein schwerer Mantel von meinen Schultern gehoben, als ließe sie mich frei.
»Pass auf dich auf da draußen. Sei vorsichtig. Und viel Glück.«
Wir wechselten einen letzten Blick.
Du könntest mitkommen, dachte ich. Aber ich weiß, dass du das nie tun würdest. Dazu hast du zu viel Angst. Bleib ruhig hier und lächle weiter, wenn Vater dir Kleider schenkt. Dennoch zog mein Herz sich kurz zusammen. Violetta war immer so brav gewesen. Sie hatte sich nichts von alldem ausgesucht. Ich wünsche dir ein glückliches Leben. Hoffentlich verliebst du dich eines Tages und führst eine gute Ehe. Lebe wohl, Schwester.
Ich wagte es nicht zu warten, ob sie noch etwas anderes sagte. Also drehte ich mich um, ging zum Fenster und kletterte auf den Sims.
Beinahe wäre ich ausgerutscht. Durch den Regen war alles glitschig und meine Reitstiefel kämpften auf dem schmalen Vorsprung um Halt. Ein paar Stücke Tafelsilber rutschten aus dem Bündel auf meinem Rücken und landeten scheppernd ein Stockwerk tiefer auf dem Boden. Nicht nach unten sehen. Ich schob mich seitwärts über den Vorsprung, bis ich einen Balkon erreichte, an dem ich mich herabgleiten ließ, bis ich nur noch an meinen zitternden Händen vom Geländer baumelte. Ich schloss mein Auge und ließ los.
Bei der Landung knickten meine Beine unter mir ein. Die Wucht des Aufpralls trieb mir die Luft aus den Lungen und einen Moment lang lag ich hilflos vor unserem Haus, vom Regen durchnässt, mit schmerzenden Gliedern und rang um Atem. Feuchte Haarsträhnen klebten mir im Gesicht. Ich wischte sie beiseite und stemmte mich auf alle viere hoch.
Der Regen überzog die Welt mit einem nassen Schimmer und es war, als befände ich mich inmitten eines Albtraums, aus dem ich nicht erwachen konnte. Mein Blick schärfte sich wieder. Ich musste hier weg, bevor mein Vater bemerkte, dass ich fort war. Schließlich kämpfte ich mich hoch und rannte benommen zum Stall. Die Pferde traten nervös von einem Huf auf den anderen, als ich hereinkam, aber ich band meinen Lieblingshengst los, raunte ihm ein paar beruhigende Worte ins Ohr und sattelte ihn, sobald er still hielt.
Dann rasten wir in den Sturm hinaus.
Ich trieb ihn hart an, bis wir die Villa meines Vaters weit hinter uns gelassen hatten und den Marktplatz von Dalia erreichten. Der Platz war voller Pfützen und lag verlassen da – zu dieser Stunde war ich noch nie in der Stadt gewesen und die Leere dieses sonst so belebten Orts war verstörend. Der Hengst schnaubte, verunsichert durch den Regen, und tänzelte ein paar Schritte rückwärts. Seine Hufe sanken in den Schlamm. Ich schwang mich aus dem Sattel und strich ihm beruhigend über den Hals, um ihn dann weiter voranzuziehen.
Da hörte ich es. Das Geräusch eines galoppierenden Pferdes hinter mir.
Ich erstarrte.
Zuerst schien das Getrappel weit entfernt – kaum hörbar über dem tobenden Unwetter–, doch dann, nur Sekunden später, war es plötzlich ohrenbetäubend laut.
Bebend stand ich da. Vater.
Ich wusste, wer da kam; es konnte nur er sein. Meine Hände hielten mitten im Streicheln inne und krallten sich stattdessen verzweifelt in die nasse Mähne des Hengstes. Hatte Violetta mich doch verraten? Vielleicht hatte er aber auch einfach das Klirren des Silbers auf dem Pflaster gehört.
Und bevor ich auch nur einen weiteren Gedanken fassen konnte, sah ich ihn – meinen Vater, der sich mit funkelnden Augen aus der verregneten Nacht löste, ein Anblick, der eine Welle von Furcht durch meinen Körper sandte. Noch nie in meinem Leben hatte ich solchen Zorn in seinem Gesicht gesehen.
Ich versuchte, mich zurück in den Sattel zu schwingen, aber ich war zu langsam. Im einen Moment war das Pferd meines Vaters noch auf uns zugesprengt gekommen, im nächsten befand er sich auch schon neben mir und seine Stiefel platschten in eine Pfütze, als er mit wehendem Mantel absprang. Seine Hand schloss sich um meinen Arm wie eine eiserne Fessel.
»Was machst du hier, Adelina?«, fragte er und seine Stimme klang gefährlich ruhig.
Vergeblich versuchte ich, mich aus seinem Griff zu winden, aber er drückte nur immer fester zu, bis ich vor Schmerz wimmerte. Mein Vater riss mich grob zurück – ich stolperte, verlor das Gleichgewicht und taumelte gegen ihn. Schlamm spritzte mir ins Gesicht. Alles, was ich hörte, waren das Rauschen des Regens und die Finsternis in seiner Stimme.
»Steh auf, du undankbare kleine Diebin«, zischte er mir ins Ohr und zerrte mich auf die Füße. Dann wurde seine Stimme plötzlich sanft. »Na, komm schon, mein Liebling. Du bist ja völlig durchnässt. Ich bringe dich wieder nach Hause.«
Ich starrte ihn an und entriss ihm schließlich mit aller Kraft meinen Arm. Seine Hand rutschte in der glitschigen Nässe ab – meine Haut verdrehte sich schmerzhaft in seinem Griff, aber für einen Moment war ich frei.
Gleich darauf spürte ich, wie er mich bei den Haaren packte. Ich schrie auf und versuchte, nach ihm zu schlagen.
»Ungehorsames Ding. Warum kannst du nicht ein bisschen mehr wie deine Schwester sein?«, murmelte er und schleifte mich kopfschüttelnd zu seinem Pferd.
Mein rudernder Arm traf den Sack, der am Sattel meines Hengstes befestigt war, und das Silber darin fiel mit einem lauten Scheppern zu Boden und blieb schimmernd im Mondlicht liegen.
»Wo wolltest du überhaupt hin? Wer würde dich aufnehmen wollen? Ein besseres Angebot wirst du niemals erhalten. Weißt du eigentlich, wie viel Schmach ich ertragen musste, jedes Mal, wenn ein Mann sich geweigert hat, dich zu heiraten? Weißt du, wie unangenehm es ist, mich immer wieder für dich entschuldigen zu müssen?«
Ich schrie. Schrie aus voller Kehle, in der Hoffnung, die Leute zu wecken, die in den Häusern ringsum schliefen, in der Hoffnung, dass sie aus dem Fenster sehen und Zeugen dessen würden, was sich hier unten abspielte. Aber würde es überhaupt jemanden kümmern?
Mein Vater zog fester an meinem Haar. »Komm wieder mit nach Hause«, sagte er und sah mich an. Regen rann ihm über die Wangen. »Sei ein braves Mädchen. Ich als dein Vater weiß, was für dich am besten ist.«
Ich biss die Zähne zusammen und starrte zurück. »Ich hasse dich«, flüsterte ich.
Mit voller Wucht schlug er mir ins Gesicht.
Ein greller Lichtblitz zuckte in meinem Kopf auf. Ich strauchelte und fiel zurück in den Schlamm. Mein Vater hielt mich immer noch an den Haaren fest. Er zerrte so stark, dass ich spürte, wie einzelne Strähnen aus meiner Kopfhaut gerissen wurden. Ich bin zu weit gegangen, dachte ich, plötzlich wie von Sinnen vor Angst. Ich habe ihn zu wütend gemacht. Die Welt versank in einem Meer aus Blut und Regen.
»Du bist eine Schande«, flüsterte er mir ins Ohr, erfüllte es mit seinem grausamen, eisigen Zorn. »Morgen früh verlässt du mein Haus und, bei den Göttern, eher bringe ich dich um, bevor ich zulasse, dass du mir diesen Handel verdirbst.«
Etwas in mir zerbarst. Meine Lippen verzogen sich zu einem Zähnefletschen.
Ein jäher Energieschub schoss durch meinen Körper, blendendes Licht und tiefschwarzer Wind. Mit einem Mal sah ich alles gestochen scharf vor mir: die reglose Gestalt meines Vaters, sein wutverzerrtes Gesicht nur wenige Fingerbreit von meinem eigenen entfernt, unsere Umgebung, in so strahlendes Mondlicht getaucht, dass die Welt jeder Farbe beraubt und nur mehr schwarz-weiß erschien. Regentropfen hingen in der Luft. Millionen glitzernder Fäden verbanden alles miteinander.
Irgendetwas tief in meinem Inneren wisperte mir zu, an den Fäden zu ziehen. Die Welt um uns herum erstarrte und im nächsten Moment – als wäre mein Geist aus meinem Körper und geradewegs in die Erde gefahren – schossen riesige dunkle Gestalten daraus empor, ihre Körper verwachsen und zuckend, ihre Augen blutrot und starr auf meinen Vater gerichtet, die mit Reißzähnen bestückten Mäuler so breit, dass ihre schemenhaften Gesichter beinahe dahinter verschwanden und ihre Schädel wie gespalten wirkten.
Die Augen meines Vaters weiteten sich und starrten fassungslos auf die Gestalten, die sich auf ihn zubewegten. Er ließ mich los und ich krabbelte so schnell wie möglich vor ihm davon. Die geisterhaft schwarzen Schemen näherten sich ihm immer weiter. Es gab kein Entkommen. Ich kauerte mich zwischen ihnen auf dem Boden zusammen, hilflos und mächtig zugleich, und sah ihnen wie gebannt zu.
»Ich bin Adelina Amouteru«, wisperten die phantomartigen Gestalten meinem Vater meine furchterregendsten Gedanken zu, der Chor ihrer Stimmen hasserfüllt. Erfüllt von meinem Hass. »Ich gehöre niemandem. Heute Abend schwöre ich dir, dass ich über alles hinauswachsen werde, was du mir jemals beigebracht hast. Ich werde Macht erlangen, wie sie diese Welt noch nicht gesehen hat. Ich werde so mächtig sein, dass niemand es je wieder wagen wird, Hand an mich zu legen.« Sie kreisten ihn ein.
Halt, wollte ich schreien, trotz des seltsamen Hochgefühls, das mich plötzlich erfüllte. Halt, wartet.
Doch die Phantome beachteten mich gar nicht.
Mein Vater schrie und schlug panisch nach ihren knochigen, ausgestreckten Fingern. Dann drehte er sich um und rannte los. Blindlings. Er prallte gegen sein Pferd und fiel in den Matsch. Das Pferd wieherte und rollte wild mit den Augen. Dann stieg es. Seine Vorderbeine schnellten durch die Luft…
… und krachten schließlich mit ihrem ganzen Gewicht zurück nach unten. Genau auf die Brust meines Vaters.
Sein Geschrei brach jäh ab. Zuckungen schüttelten seinen Körper.
Augenblicklich verschwanden die Phantome, so als wären sie nie da gewesen.
Der Regen wurde wieder stärker, Blitze zerschnitten den Himmel und der Donner fuhr mir bis in die Knochen.
Das Pferd befreite seine Hufe aus dem zertrümmerten Brustkorb meines Vaters und zerstampfte seinen Körper dabei noch mehr. Dann warf es den Kopf zurück und stürmte durch den Regen davon.
Hitze und Kälte pulsierten abwechselnd durch meine Adern; alle meine Muskeln pochten. Zitternd und entgeistert lag ich dort im Schlamm und starrte voller Entsetzen auf die Leiche nur wenige Schritte von mir entfernt. Abgehackte Schluchzer schüttelten mich und meine Kopfhaut brannte wie Feuer. Blut rann mir über das Gesicht. Eisengeruch stieg mir in die Nase – ich konnte nicht sagen, ob er von meinen eigenen Wunden herrührte oder von denen meines Vaters. Ich wartete ab, darauf gefasst, dass die Phantome jederzeit wieder auftauchen und ihren Zorn diesmal gegen mich richten würden, doch es passierte nichts.
»Das wollte ich nicht«, flüsterte ich, ohne zu wissen, mit wem ich da eigentlich redete. Mein Blick huschte zu den Fenstern der umstehenden Häuser hoch, voller Angst, dass von überall Menschen zu mir herausstarrten, aber es war niemand zu sehen. Das Unwetter hatte mit seinem Lärm alles übertönt.
Ich wendete mich von der Leiche meines Vaters ab. Ich wollte nicht, dass es so kommt.
Aber das war gelogen. Selbst in jenem Moment war ich mir darüber im Klaren.
Seht ihr, wie sehr ich nach meinem Vater komme? Ich hatte jede Sekunde genossen.
»Das wollte ich nicht!«, schrie ich erneut, versuchte, die Stimmen in meinem Inneren zu ersticken. Doch meine Worte waren nichts als ein dünnes, klägliches Gewirr. »Ich wollte nur fliehen … Ich wollte nur … weg … Ich … ich wollte nicht … Ich will nicht…«
Ich weiß nicht, wie lange ich dort sitzen blieb. Alles, woran ich mich erinnere, ist, dass ich mich irgendwann schwankend erhob. Mit zitternden Fingern sammelte ich das verstreute Tafelsilber ein, band den Sack wieder zu und zog mich in den Sattel meines Hengstes. Dann ritt ich fort von dem Blutbad, das ich selbst angerichtet hatte. Ich ließ meinen toten Vater im Schlamm liegen. Meine Flucht war so überstürzt, dass ich mich kein einziges Mal mehr fragte, ob mich vielleicht doch jemand aus einem Fenster beobachtet hatte.
Ich ritt tagelang. Auf dem Weg verkaufte ich mein gestohlenes Silber an einen freundlichen Wirtshausbesitzer, einen mitleidigen Bauern, einen warmherzigen Bäcker, bis sich meine kleine Börse mit Goldtalern gefüllt hatte, die mich zumindest bis zur nächsten Stadt bringen würden. Mein Ziel: Estenzia, die Hafenhauptstadt im Norden, das Juwel Kenettras, die Stadt der tausend Schiffe. Eine Stadt, die groß genug war, um Massen an Malfettos zu beherbergen. Dort würde ich bestimmt sicherer sein. Ich wäre so weit weg von allem – von meiner Heimat–, dass mich niemand je finden würde.
Doch am fünften Tag übermannte mich plötzlich die Erschöpfung – ich war schließlich keine Soldatin und hatte noch nie einen solchen Ritt unternommen. Und so brach ich völlig entkräftet vor dem Tor eines Bauernhauses zusammen.
Eine Frau fand mich. Sie trug ein sauberes braunes Gewand und ich erinnere mich an ihre mütterliche Wärme, die mich sogleich Vertrauen schöpfen ließ.
Ich streckte eine zitternde Hand nach ihr aus. »Bitte«, flüsterte ich durch aufgesprungene Lippen. »Ich brauche einen Platz, um mich auszuruhen.«
Die Frau hatte Mitleid mit mir. Sie nahm mein Gesicht in ihre glatten, kühlen Hände und betrachtete einen Moment lang meine Entstellungen. Dann nickte sie. »Komm mit mir, Kind.« Sie brachte mich auf den Dachboden ihrer Scheune, wo ich nach einem Mahl aus Brot und hartem Käse schlafen konnte. Im festen Vertrauen darauf, einen sicheren Zufluchtsort gefunden zu haben, sank ich bewusstlos ins Heu.
Am Morgen rüttelten mich grobe Hände wach.
Verschreckt blickte ich in die Gesichter zweier Soldaten der Inquisition, die gnadenlos auf mich herabstarrten. Ihre weißen Rüstungen und Mäntel waren mit Goldrändern versehen und ihre Mienen hart wie Stein. Die Friedenswächter des Königs. Sie hatten mich gefunden.
Verzweifelt versuchte ich, dieselbe Kraft heraufzubeschwören, die mich erfüllt hatte, kurz bevor mein Vater gestorben war, doch diesmal blieb der Energieschub aus, die Welt verfärbte sich nicht schwarz-weiß und es wuchsen keine Phantome aus der Erde empor.
Neben den Inquisitoren stand ein Mädchen. Einen Moment lang starrte ich sie bloß an, bevor ich glauben konnte, was ich sah.
Violetta. Meine kleine Schwester.
Sie sah aus, als hätte sie geweint, und dunkle Augenringe verunzierten ihr perfektes Gesicht. Auf ihrer Wange prangte ein dicker blauer Fleck.
»Ist das deine Schwester?«, wandte sich einer der Inquisitoren an sie.
Violetta blickte sie schweigend an, unwillig, die Frage zu bejahen – aber meine kleine Schwester war noch nie eine gute Lügnerin gewesen und die Antwort war ihr deutlich an den Augen abzulesen.
Die Inquisitoren schoben sie beiseite und konzentrierten sich auf mich. »Adelina Amouteru«, verkündete einer von ihnen, während sie mich auf die Füße zerrten und mir die Hände straff vor dem Bauch fesselten. »Im Namen des Königs verhaften wir dich…«
»Es war ein Unfall«, protestierte ich schwach, »der Regen, das Pferd–«
Doch die Inquisitoren hörten mir gar nicht zu. »…wegen des Mordes an deinem Vater, Sir Martino Amouteru.«
»Ihr habt versprochen, sie gehen zu lassen, wenn ich Euch helfe«, fauchte Violetta. »Ich schwöre, sie ist unschuldig!«
Die Männer hielten kurz inne, als meine Schwester meinen Arm ergriff. Mit Tränen in den Augen blickte sie mich an. »Es tut mir so leid, mi Adelinetta«, flüsterte sie verzweifelt. »Es tut mir so leid. Sie waren schon hinter dir her. Ich wollte sie nicht zu dir führen…«
Aber genau das hast du getan. Ich wandte mich von ihr ab, umklammerte jedoch gleichzeitig unwillkürlich ihren Arm, bis die Inquisitoren uns mit Gewalt voneinander trennten. Ich wollte sie anflehen: Hilf mir. Du musst einen Weg finden. Aber ich brachte kein Wort heraus. Ich, ich, ich. Vielleicht war ich einfach genauso selbstsüchtig wie mein Vater.
Das ist nun Wochen her.
Jetzt wisst ihr, wie ich hier gelandet bin, an die Wand eines feuchten Verlieses gekettet, ohne Fenster, ohne Licht, ohne einen fairen Prozess, ohne eine Menschenseele, die sich um mich kümmert. Dies ist die Geschichte, wie ich zum ersten Mal meine Kräfte gespürt habe und nun mit dem Blut meines Vaters an den Händen meinem eigenen Ende entgegensehe. Nur sein Geist leistet mir Gesellschaft. Jedes Mal, wenn ich aus einem Fiebertraum erwache, sehe ich ihn in der Ecke meiner Zelle lauern und mich auslachen.
Du hast versucht, mir zu entkommen, sagt er dann, aber ich habe dich gefunden. Du hast verloren und ich habe gewonnen.
Ich sage ihm, wie froh ich darüber bin, dass er tot ist. Sage ihm, er soll mich in Ruhe lassen. Aber er bleibt.
Das alles spielt nun ohnehin keine Rolle mehr. Denn morgen früh werde ich sterben.
ENZO VALENCIANO
Die Taube kommt spät in der Nacht. Sie landet auf seiner Hand. Er kehrt dem Balkon den Rücken und trägt sie ins Zimmer. Dort bindet er die winzige Papierrolle von ihrem Bein los, streichelt ihr mit seinem blutbefleckten Handschuh über den Hals und liest die in hübscher, geschwungener Schrift verfasste Botschaft.
Ich habe sie gefunden. Komm unverzüglich nach Dalia.
Dein treuer Kundschafter.
Seine Miene zeigt keine Regung, als er die Nachricht zusammenfaltet und in seinen Armschutz schiebt. Nachts sind seine Augen nichts als Dunkelheit und Schatten.
Sie glauben, dass sie mir den Zutritt verwehren können. Aber wie viele Schlösser die Tür auch versperren – es gibt immer einen anderen Weg hinein.
Die Diebin, die die Sterne stahl von Tristan Chirsley
ADELINA AMOUTERU
Schritte auf dem Gang. Sie enden direkt vor meiner Zelle und ein Inquisitor schiebt eine Schale Mehlsuppe durch die Luke am unteren Ende der Tür. Sie schlittert geradewegs in eine dunkle Pfütze in der Ecke und ein Schwall schmutziges Wasser schwappt in mein Essen. Wenn man es denn als solches bezeichnen kann.
»Deine letzte Mahlzeit«, ruft er durch die Tür. Ich höre, dass er sich schon wieder entfernt, als er hinzufügt: »Lang schnell zu, Malfetto. Keine Stunde mehr, dann kommen wir dich holen.« Seine Schritte werden leiser und verklingen schließlich ganz.
In der Zelle neben meiner ertönt eine dünne Stimme. »Mädchen«, flüstert sie und mir läuft ein Schauder über den Rücken. »Mädchen.« Dann, als ich nicht antworte: »Ist es wahr? Sie sagen, dass du eine von ihnen bist. Eine Begabte.«
Stille.
»Und?«, fragt der Besitzer der Stimme. »Stimmt es?«
Ich schweige weiter.
Er lacht – es ist das Lachen eines Gefangenen, der schon so lange eingesperrt ist, dass sein Verstand zu verrotten begonnen hat. »Die Inquisitoren sagen, du hättest die Macht eines Dämons heraufbeschworen. Stimmt das? Hat das Blutfieber dich verdorben?« Seine Stimme summt ein paar Zeilen irgendeines Volkslieds, das ich nicht erkenne. »Vielleicht kannst du mich ja hier rausholen. Was meinst du? Wie wär’s mit einem kleinen Ausbruch?« Wieder gehen seine Worte in heiserem Gelächter unter.
Ich ignoriere ihn so gut ich kann. Eine Begabte. Allein die Vorstellung ist so lächerlich, dass ich kurz davor bin, in das Lachen meines kranken Zellennachbarn mit einzufallen.
Und doch versuche ich abermals, jene seltsame Illusion aus der Nacht, in der mein Vater starb, zu entfesseln. Wieder gelingt es mir nicht.
Stunden verrinnen. Das heißt, eigentlich habe ich keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen ist. Ich weiß nur, dass ich irgendwann die Schritte mehrerer Soldaten auf der engen Wendeltreppe höre. Das Geräusch nähert sich, bis es schließlich in das Knarzen eines Schlüssels im Schloss meiner Zellentür und das Quietschen rostiger Angeln übergeht.
Sie sind da.
Zwei Inquisitoren betreten meine Zelle. Ihre Gesichter sind im Schatten ihrer Kapuzen verborgen. Ich weiche auf allen vieren vor ihnen zurück, aber sie packen mich und zerren mich hoch. Sie lösen meine Ketten und lassen sie zu Boden fallen.
Ich wehre mich mit dem letzten bisschen Kraft, das mir geblieben ist. Das hier geschieht nicht wirklich. Es ist ein Albtraum. Es ist kein Albtraum. Es geschieht wirklich.
Sie schleifen mich die Treppe hoch. Ein Stockwerk, zwei Stockwerke, drei. So weit unter der Erde war ich gefangen. Langsam wird das Innere des Inquisitionsturms erkennbar – das schimmelige, feuchte Gemäuer weicht nach und nach glänzendem Marmor, die Mauern sind mit Säulen und Wandbehängen und dem kreisförmigen Symbol der Inquisition, der ewigen Sonne, verziert. Erst jetzt höre ich den Lärm, der von draußen hereindringt. Schreie, Gejohle. Mein Herz beginnt zu rasen und im nächsten Moment stemme ich mich so fest ich kann in den Boden, doch meine zerschlissenen Reitstiefel scharren bloß völlig nutzlos über den Stein.
Die Inquisitoren ergreifen mich fester bei den Armen und zwingen mich, weiter voranzustolpern. »Vorwärts, Mädchen«, blafft einer von ihnen mich an, gesichtslos unter seiner Kapuze.
Dann treten wir ins Freie und einen Moment lang versinkt die Welt in blendendem Weiß. Ich blinzele. Wir müssen uns auf dem Marktplatz befinden. Mein verschwommener Blick registriert eine riesige Masse von Menschen, die alle gekommen sind, um bei meiner Hinrichtung zuzusehen. Der Himmel ist strahlend, ja irritierend blau und die weißen Wolken erscheinen geradezu grell. Ein Stück entfernt ragt auf einem hölzernen Podest ein schwarzer Eisenpfahl in die Höhe, neben dem eine Reihe von Inquisitoren wartet. Selbst von hier aus sehe ich die runden, schimmernden Embleme auf ihren Brustpanzern, ihre behandschuhten Hände auf den Schwertknäufen. Wieder stemme ich verzweifelt die Füße in den Boden.
Schmährufe und wütendes Gebrüll werden laut, als die Inquisitoren mich auf die Hinrichtungsstätte zuführen. Einige werfen mit faulen Früchten nach mir, während andere mir Beleidigungen und Verwünschungen zuschreien. Alle tragen sie Lumpen, löchrige Schuhe und schmutzige Kittel. So viele arme, verzweifelte Menschen, so gierig, mich leiden zu sehen, um ihrem eigenen Leben voller Hunger und Elend wenigstens kurz zu entfliehen.
Ich halte den Blick gesenkt. Die Welt um mich herum ist wie von Nebel verschleiert und ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Vor mir rückt der Pfahl, der eben noch so fern schien, unaufhaltsam näher.
»Dämon!«, ruft jemand.
Etwas Kleines, Scharfkantiges trifft mich im Gesicht. Wahrscheinlich ein Kieselstein.
»Sie ist eine Ausgeburt der Hölle!«
»Unglücksbringerin!«
»Monstrum!«
»Scheusal!«
Ich schließe mein Auge so fest ich kann, in meiner Fantasie jedoch sieht jeder Einzelne auf dem Platz aus wie mein Vater und alle haben seine Stimme. Ich hasse euch. Ich stelle mir vor, wie sich meine Hände um ihre Kehlen schließen, wie sie zudrücken, sie zum Schweigen bringen, einen nach dem anderen. Ich will endlich Ruhe und Frieden. Tief in meinem Inneren regt sich etwas – ich versuche, danach zu haschen–, doch die Energie entwischt mir. Mein Atem ist nur mehr ein heiseres Keuchen.
Ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis wir das Podest erreichen, nur dass ich erschrecke, als es so weit ist. Inzwischen bin ich derart schwach, dass ich es nicht einmal die Stufen hinaufschaffe. Kurzerhand hebt mich einer der Inquisitoren hoch und wirft mich sich über die Schulter. Oben angekommen, setzt er mich wieder ab und schiebt mich auf den Pfahl zu.
Dieser ist aus schwarzem Eisen gefertigt, etwa so dick wie ein Dutzend Männerarme, und von seiner Spitze hängt eine Schlinge herab. An den Seiten sind Ketten für die Hände und Füße befestigt. Sein unteres Ende verschwindet in einem großen Stapel aus Holzscheiten. Noch immer sehe ich alles wie durch dichten Nebel.
Sie drängen mich an den Pfahl, fesseln meine Hände und Füße mit den Ketten und legen mir die Schlinge um den Hals. Einige der Zuschauer rufen mir immer noch Beleidigungen zu. Andere werfen Steine.
Beklommen blicke ich zu den Dächern hinauf. Die Ketten sind kalt auf meiner Haut. Wieder und wieder taste ich in meinem Inneren nach etwas, das ich heraufbeschwören kann, um mich zu retten. Ich zittere so stark, dass meine Fesseln klirren.
Als ich zu den anderen Inquisitoren hinübersehe, bleibt mein Blick am jüngsten von ihnen hängen. Er steht ganz vorn, in der Mitte des Podests, die Schultern gestrafft, das Kinn erhoben, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Alles, was ich von hier aus sehen kann, ist sein Profil.
»Master Teren Santoro«, kündigt einer der älteren Inquisitoren ihn nun feierlich an. »Der Erste Inquisitor von Kenettra.«
Master Teren Santoro? Wieder mustere ich ihn. Der Erste Inquisitor von Kenettra ist gekommen, um mich sterben zu sehen?
Er kommt nun gemessenen, selbstbewussten Schrittes auf mich zu. Ich weiche vor ihm zurück, bis mein Rücken sich an den Eisenpfahl presst. Meine Ketten rasseln gegeneinander. Teren neigt den Kopf, um mich zu mustern. Sein weißer Mantel ist mit mehr Gold verziert als die der anderen – definitiv ein Zeichen seines höheren Rangs – und eine filigran gearbeitete Goldkette spannt sich von einer Schulter zur anderen. Er ist überraschend jung. Sein Haar ist weizenblond, hell für einen Kenettraner, und auf eine Art frisiert, wie man es im Süden nur selten sieht: an den Seiten kurz geschoren, dafür aber voller am Oberkopf, mit einem zierlichen, mit Golddraht umwickelten Pferdeschwanz im Nacken. Sein fein geschnittenes Gesicht ist schmal und wie aus Marmor gemeißelt, schön trotz der Kälte, die es ausstrahlt. Seine Augen sind blassblau. Sehr blass. So sehr, dass sie im Licht nahezu farblos wirken. Sein Anblick jagt mir einen Schauder über den Rücken. In seinen Augen liegt etwas Wahnwitziges, Grausames, Wildes.
Mit einem seiner vornehmen Handschuhe streicht er mir ein paar blutige Haarsträhnen aus dem Gesicht und hebt mein Kinn an. Interessiert betrachtet er meine Narbe. Seine Mundwinkel heben sich zu einem eigenartigen, beinahe mitfühlenden Lächeln.
»Ein Jammer«, sagt er. »Du könntest so ein hübsches Ding sein.«
Ruckartig befreie ich mein Kinn aus seinem Griff.
»Und was für ein Temperament.« Seine Worte triefen vor Mitleid. »Hab keine Angst.« Und dann, sein Gesicht dicht an meinem, fügt er leiser hinzu: »Du wirst deine Erlösung in der Unterwelt finden.«
Er wendet sich der Menge zu und hebt die Arme, um Ruhe zu gebieten. »Haltet ein, Freunde! Ich weiß, wir sind alle aufgeregt.« Als die Menge etwas zur Ruhe kommt, strafft er den Rücken und räuspert sich. Seine Stimme hallt über den Platz. »Einige von euch mögen die Welle von Verbrechen bemerkt haben, die sich in letzter Zeit in unseren Straßen ereignet haben. Verbrechen, die von Menschen – deren krankhaften Abbildern – begangen wurden, die sich für mehr als bloß … menschlich halten. Einige von euch nennen diese neue Art von Geächteten Elite, als wären sie etwas Außergewöhnliches, als wären sie etwas wert. Ich bin heute hierhergekommen, um euch alle daran zu erinnern, dass sie gefährlich sind, böse. Sie sind Mörder, die danach trachten, ihre Nächsten zu töten. Sie haben keinerlei Respekt vor Gesetz und Ordnung.«
Teren wirft mir einen Blick über die Schulter zu. Totenstille hat sich über den Platz gesenkt. »Aber seid versichert: Wenn wir diese Dämonen in die Finger bekommen, führen wir sie ihrer gerechten Strafe zu. Denn das Böse darf nicht siegen.« Er lässt seine Augen über die Menge schweifen. »Die Inquisition ist zu eurem Schutz da. Lasst dies euch allen eine Warnung sein.«
Ich stemme mich halbherzig gegen meine Ketten. Meine Beine zittern erbärmlich. Ich will meinen Körper vor all diesen Menschen verbergen, meine Makel vor ihren neugierigen Blicken. Ist Violetta irgendwo da draußen? Ich suche in der Menge nach ihrem Gesicht, dann sehe ich zum Himmel auf. Es ist so ein schöner Tag – wie kann der Himmel nur so blau sein? Etwas Nasses rinnt mir die Wange hinunter. Meine Lippe bebt.
Gebt mir Kraft, ihr Götter. Ich habe solche Angst.
Teren nimmt nun eine brennende Fackel von einem seiner Männer entgegen. Dann dreht er sich wieder zu mir um.
Der Anblick des Feuers erfüllt mich mit noch größerer Furcht. Verzweifelt reiße ich an meinen Fesseln. Als die Ärzte mit einem glühenden Messer mein Auge entfernt haben, bin ich ohnmächtig geworden. Wie schlimm wird der Schmerz sein, wenn das Feuer meinen gesamten Körper auffrisst?
Teren legt mir seine Finger auf die Stirn wie zu einer formellen Abschiedsgeste. Dann wirft er die Fackel auf die Scheite zu meinen Füßen. Funken stieben hoch, als das trockene Holz sofort Feuer fängt. Die Menge bricht in Jubel aus.
Wilde Wut keimt in mir auf und vermischt sich mit meiner Angst. Ich werde hier heute nicht sterben.
Diesmal greife ich tief in mein Bewusstsein hinein und bekomme endlich diese seltsame Energie zu fassen, nach der ich schon die ganze Zeit gesucht habe. Verzweifelt schließt sich mein Herz um sie.
Im nächsten Moment bleibt die Welt stehen.
Das Feuer erstarrt und seine Flammen verharren reglos in der Luft wie auf einer Zeichnung in Schwarz-Weiß. Die Wolken am Himmel ziehen nicht weiter und der Wind auf meiner Haut erstirbt.
Terens Lächeln ist verschwunden, als er zu mir herumfährt. Die Menge verstummt verwirrt.
Dann reißt etwas in meinem Inneren auf. Mit einem Ruck nimmt die Welt wieder an Fahrt auf und die Flammen fressen sich tosend durch das Holz. Der strahlend blaue Himmel über uns verdunkelt sich mit einem Schlag.
Die Wolken färben sich schwarz – ihre Umrisse nehmen verzerrte, furchterregende Formen an, während über allem die Sonne weiterscheint, ein gespenstisches Leuchten vor einem mitternächtlich schwarzen Grund.
Die Menschen beginnen zu schreien, als sich die Nacht über uns senkt, und die Inquisitoren, die Gesichter zum Himmel gewandt wie alle anderen, ziehen ihre Schwerter.
Ich bekomme keine Luft mehr. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll.
Inmitten der Dunkelheit und Panik bewegt sich etwas am Himmel. Im nächsten Moment brechen die Wolken auf, zerfallen zu einem Schwarm aus Millionen winziger Fetzen, die über den Himmel schnellen und Richtung Erde jagen, hinab, hinab, hinab, auf die Menschenmenge zu. Es ist ein Albtraum aus Heuschrecken. Mit gnadenloser Präzision stoßen sie auf uns nieder und ihr Brausen übertönt sogar die Angstschreie der Menschen. Die Inquisitoren schlagen vergeblich mit ihren Schwertern nach den Insekten.
Die Flammen züngeln inzwischen nach meinen Füßen und ich spüre ihre sengende Hitze. Es kommt näher – gleich wird es mich verschlingen.
Während ich versuche, vor den Flammen zurückzuweichen, fällt mir etwas höchst Sonderbares auf: Die Heuschrecken fliegen auf mich zu und dann geradewegs durch mich hindurch. Als wären sie überhaupt nicht da. Ich beobachte die Szene, die sich mir bietet – die Insekten fliegen auch durch die Körper der Inquisitoren und die der Menschen auf dem Platz hindurch.
Sie sind eine Illusion, wird mir plötzlich klar. Genau wie die dämonenhaften Schatten, die Vater angegriffen haben. Nichts davon ist real.
Einer der Inquisitoren hat sich inzwischen wieder aufgerappelt, die Augen tränend von all dem Qualm, und richtet sein Schwert auf mich. Dann stürzt er auf mich zu.
Ich nehme alle Kraft zusammen, die mir noch bleibt, und reiße so heftig an meinen Ketten, wie ich nur kann. Warmes Blut rinnt mir über die Handgelenke. Während ich verbittert kämpfe, kommt er durch das Meer aus Heuschrecken und Dunkelheit immer näher auf mich zu.
Plötzlich–
Eine Windbö. Saphirblau und silbern. Das Feuer zu meinen Füßen verlischt mit einem letzten Flackern zu sich kräuselndem Rauch.
Etwas huscht durch mein Gesichtsfeld. Eine Gestalt erscheint zwischen mir und dem sich nähernden Inquisitor; sie bewegt sich mit tödlicher Eleganz. Ich glaube, es ist ein Junge. Wer ist das?
Dieser Junge ist keine Illusion – ich kann seine Gegenwart spüren, eine Präsenz, wie sie der schwarze Himmel und die Heuschrecken nicht haben. Er ist in einen wallenden blauen Kapuzenumhang gekleidet und sein Gesicht ist hinter einer glänzenden silbernen Maske verborgen. Er geht vor mir in Kampfstellung, die Glieder angespannt, voll und ganz auf den Inquisitor konzentriert. In jeder seiner behandschuhten Fäuste schimmert ein langer Dolch.
Der Inquisitor kommt kurz vor ihm schlitternd zum Stehen. Unsicherheit tritt in seinen Blick. »Zur Seite«, befiehlt er.
Der maskierte Junge legt den Kopf schief. »Wie respektlos«, spottet er mit tiefer samtiger Stimme. Selbst inmitten dieses Chaos höre ich seine Worte klar und deutlich.
Der Inquisitor stößt mit seinem Schwert nach ihm, doch der Junge weicht tänzelnd aus und sticht gleich darauf mit einem seiner Dolche zu. Die Klinge senkt sich tief in den Körper des Inquisitors. Der Mann reißt die Augen auf und stößt ein Quieken aus, das an ein krepierendes Schwein erinnert.
Ich bin zu verblüfft, um auch nur einen Laut von mir zu geben. Tief in mir aber glimmt ein seltsamer kleiner Funke der Verzückung auf.
Die Inquisitoren werden auf den Kampf aufmerksam und eilen ihrem gefallenen Kameraden zu Hilfe. Mit gezogenen Schwertern stellen sie sich dem Jungen entgegen. Dieser nickt ihnen zu, als wollte er sie herausfordern, näher zu kommen. Als sie es tun, gleitet er zwischen ihnen hindurch wie Wasser durch einen Felsspalt, sein Körper nicht mehr als eine verschwommene Bewegung, seine Dolche zwei silberne Blitze in der Dunkelheit. Einer der Inquisitoren hackt ihn mit einem Schwerthieb beinahe entzwei, doch der Junge schlägt dem Mann sauber die Hand ab. Das Schwert fällt scheppernd zu Boden. Der Junge lässt die Waffe mit einem Fußtritt zurück in die Luft schnellen, fängt sie auf und richtet sie auf die anderen Inquisitoren.
Als ich genauer hinsehe, bemerke ich, dass zwischen den Soldaten weitere maskierte Gestalten erschienen sind – Gestalten, die in die gleichen dunklen Umhänge gekleidet sind wie der Junge. Er ist nicht allein gekommen.
»Das ist der Schnitter!«, ruft Teren und deutet mit seinem blanken Schwert auf den Jungen. Er läuft auf uns zu und in seinen blassen Augen liegt ein fanatischer Glanz. »Ergreift ihn!«
Dieser Name. Ich kenne ihn von den Holzschnitzereien. Der Schnitter. Er ist einer von ihnen.
Immer mehr Inquisitoren stürmen nun auf das Podest. Der Junge hält einen Moment inne und blickt ihnen entgegen – von den Klingen in seinen Händen trieft Blut. Dann richtet er sich auf, hebt einen Arm hoch über den Kopf und senkt ihn mit einer präzisen, halbkreisförmigen Abwärtsbewegung.
Eine Feuersäule schießt aus seinen Händen, wälzt sich über das Podest und bildet einen Schutzwall zwischen uns und den Soldaten, der hinauf bis zum schwarzen Himmel reicht. Entsetzte Schreie dringen von der anderen Seite des Feuervorhangs zu uns.
Der Junge kommt auf mich zu. Voller Angst starre ich auf die Silbermaske unterhalb seiner Kapuze, während das Inferno in seinem Rücken ihn mit einer grellen Aura umgibt. Der einzige Teil seines Gesichts, der nicht von der Maske verdeckt ist, sind seine Augen – hart und nachtschwarz, aber von einem wilden Feuer erfüllt.
Er sagt kein Wort. Stattdessen kniet er sich vor mich und greift nach den Ketten, mit denen meine Knöchel an den Pfahl gefesselt sind. Die eisernen Glieder glühen in seinen Händen erst rot auf, dann weiß. Kurz darauf sind sie zerschmolzen und geben meine Beine frei. Der Junge richtet sich wieder auf und wiederholt dasselbe mit der Schlinge um meinen Hals und schließlich den Ketten an meinen Handgelenken.