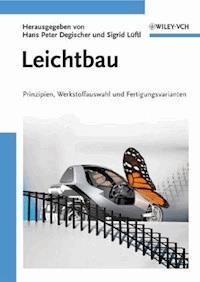
Leichtbau E-Book
154,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch bietet Ingenieuren und Werkstoffwissenschaftlern die Erklärung der komplexen Zusammenhänge zwischen zahlreichen Leichtbaumöglichkeiten. Es führt didaktisch von Anforderungsprofilen, Berechnung und Optimierung, über Bauteilentwicklung zu Materialauswahl, Formgebung und Fertigungstechniken. An mehreren Beispielen aus Transport und Rennsport werden die Methoden und wechselseitigen Abhängigkeiten der Material- und Formwahl veranschaulicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Contents
Allgemeine Einleitung
Autorenverzeichnis
Abkürzungen
1 Leichtbauprinzipien
1.1 Vorbild Natur
1.2 Berechnungs- und Design-Konzepte für den Leichtbau
1.3 Bauteilversagen
2 Werkstoffangebot für den Leichtbau
2.1 Werkstoffe
2.2 Polymermatrix-Verbundwerkstoffe
2.3 Werkstoffauswahl
3 Fertigungstechnischer Leichtbau
3.1 Gießtechnik
3.2 Pulvermetallurgische Leichtbauprodukte
3.3 Umformtechnischer Leichtbau
4 Bauteilfertigung
4.1 Bauteilfertigung – Polymermatrix-Verbundwerkstoffe
4.2 Mischbauweisen und Multimaterialkomponenten
5 Rezyklierbarkeit
5.1 Rezyklieren metallischer Werkstoffe
5.2 Rezyklieren von unverstärkten und faserverstärkten Kunststoffen
6 Bauteilbeispiele aus dem Transport
6.1 Sportwagenprototyp „Concept MILA“
6.2 Prototypfahrzeug „CLEVER“
6.3 Das „R2R“ Motorrad
6.4 Faserverstärkte Polymere im Flugzeugbau
7 Innovation und Innovationsmanagement
7.1 Innovation
7.2 Die Erfolgsfaktorenforschung und ihre Ergebnisse
7.3 Die Rolle der Selektionsumgebung und managementorientierte Innovationskonzepte
7.4 Wirtschaftlichkeitsüberlegungen
Register
Die Herausgeber
Hans Peter Degischer
Technische Universität Wien
Institut für Werkstoffwissenschaft
und Werkstofftechnologie
Karlsplatz 13/E308
1040 Wien
Österreich
Sigrid Lüftl
Technische Universität Wien
Institut für Werkstoffwissenschaft
und Werkstefftechnologie
Nichtmetallische Werkstoffe
Favoritenstraße 9–11/E308
1040 Wien
Österreich
Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung.
Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2009 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Print ISBN 9783527323722
Epdf ISBN 978-3-527-62825-4
Epub ISBN 978-3-527-65986-9
Mobi ISBN 978-3-527-65985-2
Allgemeine Einleitung
Leichtbau ist ein umfassendes Konstruktionsprinzip, welches das Ziel verfolgt, das Gewicht bzw. die Masse von technischen Produkten zu reduzieren. Angewandt auf bewegte Maschinenelemente, Transportmittel und Sportgeräte sind die Motive dafür, zum Beispiel höhere Beschleunigungen zu erzielen, die Nutzlast zu erhöhen und die aufzuwendende Energie zu reduzieren. Das Einsatzspektrum des Leichtbaus reicht vom allgemeinen Maschinenbau (z. B. Roboter, Verpackungsmaschinen, Sportartikel etc.), Energieerzeugungsanlagen (z. B. Windräder) über den Fahrzeug- und Flugzeugbau bis hin zur Gestaltung von Raumfahrzeugen und Raumstationen. Klassisch [1] wird unterschieden zwischen:
stofflichem Leichtbau (Leichtwerkstoffe),
Formleichtbau (z. B. Hohlstrukturen),
Fertigungsleichtbau (z. B. integrale oder gefügte Bauweise),
Konstruktionsleichtbau (materialsparend),
Funktionsleichtbau (z. B. Integration oder Reduzierung von Funktionen).
Die Wechselwirkung dieser Leichtbaumöglichkeiten soll folgendes Beispiel illustrieren: Die Konstruktion eines möglichst kurz gebauten PKW spart Material, die Einführung eines Mittelmotors verteilt das Gewicht gleichmäßiger, die Achsbelastungen werden kleiner und erlauben die Reduktion der tragenden Querschnitte bzw. die Substitution durch Leichtmetalle, die als funktionsintegrierte Formteile eingesetzt werden können. Damit wird nicht nur das Gesamtgewicht reduziert, sondern auch das Aussehen geprägt und die Funktionsvielfalt verändert. Die Umsetzung des Leichtbaus bedarf einer gesamtheitlichen Betrachtung der angeführten Möglichkeiten. Selbst die Substitution von Werkstoffen ist ohne Anpassung des Designs im Allgemeinen nicht effizient.
In den letzten Jahrzehnten lieferte die Weiterentwicklung aller angeführten Leichtbaumöglichkeiten starke Innovationsimpulse: Neue Werkstoffe (z. B. Hochleistungs-Verbundwerkstoffe, höchstfeste Stähle) und Werkstoffverbunde (z. B. Sandwich mit geschäumten Kernen) sowie neue Formgebungsverfahren (z.B. Innenhochdruckumformung) eröffnen effizientere Gestaltungsmöglichkeiten; zuverlässigere Messungen der Eigenschaftsprofile werden für die computerunterstützte Bauteilentwicklung, realitätsnahe Fertigungs- und Beanspruchungssimulation eingesetzt. Des Weiteren konnten die Produktfunktionen erweitert (z. B. Sicherheit) und neue Randbedingungen (z. B. Umweltverträglichkeit) berücksichtigt werden. Nicht nur die Produktfunktionen wurden umfassender, sondern auch die Wege vielfältiger, sie zu erfüllen.
Der Nutzen eines Produkts wird in der Marktwirtschaft den Kosten gegenübergestellt. Da effizienter Leichtbau im Allgemeinen höhere Werkstoff- und/oder Fertigungskosten verursacht, bedarf es eines Innovationsdrucks, etablierte Produkte durch Leichtbaulösungen zu ersetzen. Beispielsweise müsste das Gewicht der derzeit produzierten Pkws wieder so reduziert werden, dass es nicht höher ist als jenes der vor 10 Jahren produzierten. Die durch konsequenten Leichtbau erzielbare Treibstoffeinsparung von 0,3–0,5 l/100kg scheint allerdings – wegen der erhöhten Herstellungskosten am Markt – noch keine ausreichende Nachfrage zu erzeugen. Künftig werden die Energiekosten steigen und die Umweltschutzbedingungen werden sich weiter verschärfen. Somit wird auch der Innovationsdruck in Richtung Leichtbau stärker werden. In Luft- und Raumfahrzeugen und auch in etlichen Sportartikeln ist Leichtbau längst integriert. In zunehmendem Ausmaß wird auch bei der Entwicklung von Maschinen, Straßen- und Schienenfahrzeugen auf Leichtbau gesetzt. Dieses Buch will auch mit Produktbeispielen Anregungen für die Umsetzung von Leichtbau liefern. Die jeweiligen Autoren erläutern den Weg von der Problemstellung über die Konzeption der Lösung bis zur tatsächlichen Fertigstellung des Produkts.
Die Natur entwickelte Leichtbau seit Jahrmillionen, woraus die Ingenieure lernen können: Bionik [2] und Biomimetik [3] liefern richtungsweisende Anregungen, wenngleich keinesfalls einfach kopiert werden kann. Vom Entwicklungsingenieur werden umfassende Problemlösungen erwartet, um das Produktgewicht bei gleichen oder verbesserten Gebrauchseigenschaften marktkonform zu vermindern. Dafür stehen hervorragende Leichtbau-Konzepte zur Verfügung. In Ergänzung zu Fachbüchern [4–6], die die Konstruktionsaspekte betonen, will dieses Buch die Vielfalt und wechselseitige Abhängigkeit der modernen Leichtbaumöglichkeiten aufzeigen und anhand einiger Beispiele illustrieren. Aufbauend auf den Grundlagen der Konstruktions- und Berechnungsprinzipien, der Werkstoffeigenschaften (einschließlich jener der Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde) sowie der Formgebungsmöglichkeiten sollen Innovationsimpulse gegeben werden. Wegen der bisweilen anzutreffenden Marktschwelle für Leichtbauprodukte werden auch allgemeine Voraussetzungen für Innovationen erörtert, ebenso der Kostenaspekt. In der Kosten-Nutzen-Bilanz ist der gesamte Produktlebenszyklus zu betrachten, ebenso in der Umweltverträglichkeit. Die dargestellten, gegenwärtig möglichen Rezyklierverfahren für Bauteile und Werkstoffe können verstärkt zur Schonung von Ressourcen und Umwelt beitragen.
Das vorliegende Buch entstand im Anschluss an das Projekt „Austrian Light Weight Structures“ [7] und will StudentInnen der Technik, Mitarbeiterinnen in Forschung und Entwicklung, DesignerInnen, Entwicklungs- und FertigungsingenieurInnen, technischen Verkäuferinnen, Entscheidungsträgerinnen für Innovationen und allen, die an der Umsetzung von Leichtbaukonzepten interessiert sind, wissensbasierte Leichtbaulösungen vermitteln und sie zu deren kreativer Umsetzung anregen.
Wien, im August 2009
Hans Peter Degischer und Sigrid Lüftl
Literaturnachweis
1 Leichtbaustrategien, DVM-Bericht 675, DVM-Berlin, 2008
2 Nachtigall, W. (2003) Bionik: Grundlagen und Beispiel für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Springer-Verlag, Berlin.
3 Elices, M. (ed.) (2000) Structural biological materials – design and structure-property relationships, Pergamon, Amsterdam.
4 Klein, B. (2007) Leichtbau-Konstruktion, 7. Auflage, Vieweg & Sohn Verlag, Wiesbaden.
5 Hertel, H. (1980) Leichtbau, Springer-xVerlag, Berlin.
6 Wiedemann, J. (2007) Leichtbau – Elemente und Konstruktion, 3. Aufl., Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.
7 Leichtbau-Seminar im Rahmen des Forschungsprojektes „Austrian Light Weight Structures“ koordiniert vom ARC Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen GmbH (LKR), gefördert von der Österr. Nationalstiftung, 2005–2007
Autorenverzeichnis
Vasiliki-Maria Archodoulaki
Technische Universität Wien
Institut für Werkstoffwissenschaft
und Werkstofftechnologie
Nichtmetallische Werkstoffe
Favoritenstraße 9–11/E308
1040 Wien
Österreich
Andreas Bilek
KTM SPORTMOTORCYCLE AG
Motorentwicklung
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen
Österreich
Wolfgang Billinger
HTL Ried-Innviertel
Molkereistraße 4
4910 Ried/Innkreis
Österreich
Bruno Buchmayr
Lehrstuhl für Umformtechnik
Montanuniversität Leoben
8700 Leoben
Österreich
Herbert Danninger
Technische Universität Wien
Institut für chemische Technologien
und Analytik
Getreidemarkt 9/164-CT
1060 Wien
Österreich
Thomas Daxner
Technische Universität Wien
Institut für Leichtbau und Struktur-Biomechanik
Gußhausstraße 25–29/E317
1040 Wien
Österreich
Hans Peter Degischer
Technische Universität Wien
Institut für Werkstoffwissenschaft
und Werkstofftechnologie
Karlsplatz 13/E308
1040 Wien
Österreich
Beate Edl
Technische Universität Wien
Institut für Managementwissenschaften
Theresianumgasse 27/E330
1040 Wien
Österreich
Wilfried Eichlseder
Montanuniversität Leoben
Lehrstuhl für Allgemeinen
Maschinenbau
CD-Labor für Betriebsfestigkeit
Franz-Josef-Straße 18
8700 Leoben
Österreich
Bruno Götzinger
MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik
AG & Co KG
Liebenauer Hauptstraße 317
8041 Graz
Österreich
Michael Kettner
ARC Leichtmetallkompetenzzentrum
Ranshofen GmbH
Leitung Strangguss
Postfach 26
5282 Ranshofen
Österreich
Leopold Kniewallner
Georg Fischer Automotive AG
Mühlentalstrasse 65
8201 Schaffhausen
Schweiz
Richard Kretz
ARC Leichtmetallkompetenzzentrum
Ranshofen GmbH
Gießtechnik
Postfach 26
5282 Ranshofen
Österreich
Helga Lichtenegger
Technische Universität Wien
Institut für Werkstoffwissenschaft
und Werkstofftechnologie
Favoritenstraße 9–11/E308
1040 Wien
Österreich
Ulf Noster
ARC Leichtmetallkompetenzzentrum
Ranshofen GmbH
Leitung Leichtbau
Postfach 26
5282 Ranshofen
Österreich
Cecilia Poletti
Technische Universität Wien
Institut für Werkstoffwissenschaft
und Werkstofftechnologie
Karlsplatz 13/E308
1040 Wien
Österreich
Franz Rammerstorfer
Technische Universität Wien
Institut für Leichtbau und Struktur-Biomechanik
Gußhausstraße 25–29/E317
1040 Wien
Österreich
Isabella Skrna-Jakl
Technische Universität Wien
Institut für Leichtbau und Struktur-Biomechanik
Gußhausstraße 27–29/E317
1040 Wien
Österreich
AdolfStepan
Technische Universität Wien
Institut für Managementwissenschaften
Theresianumgasse 27/E330
1040 Wien
Österreich
Abkürzungen
AMA
American Motorcyclist Association
B2B
Business to Business
BMC
Bulk Moulding Compound
BMI
Bismaleinimid
CES
Cambridge Engineering Selector
CFK
Carbonfaser (Kohlefaser) verstärkter Kunststoff
CIP
Kaltisostatisches Pressen
CNG
Compressed Natural Gas
DLC
Diamond Like Carbon
DOHC
Dual Over Head Cam
DSC
Differential Scanning Calorimetry
ECRC
European Composites Recycling Services Company
EOP
End of Production
EP
Epoxid
EPMA
European Powder Metallurgy Association
EU
Europäische Union
FB
Funktionsbestätigung
FCKW
Fluorchlorkohlenwasserstoffe
FEM
Finite Element Model
FHF
Flap Hinge Fairing (Landeklappen Gelenksverkleidung)
FTF
Flap Track Fairing (Landeklappen Schienenverkleidung)
Gew.%
Gewichtsprozent
GFK
Glasfaser verstärkter Kunststoff
GMT
Glasmatten verstärkte Thermoplaste
HIP
Heißisostatisches Pressen
HM
High-Modulus
HMS
High-Modulus&Strength
HS
High-Strain
HT
High-Tensile
IM
Intermediate-Modulus
KB
Konzept
KTM
Kronreif Trunkenpolz Mattighofen
LFT
Langfaser verstärkte Thermoplaste
LT
Leistungstest
MAG
Multiaxial-Gelege
MES
Minimum Efficient Scale
MFA
Microfibril Angle (Mikrofibrillenwinkel)
MILA
Magna Innovative Leightweight Auto
MMC
Metall-Matrix-Composite
MPIF
Metal Powder Industries Federation
MPV
Multi Purpose Vehicle
NCF
Non Crimp Fabric
NVH
Noise Vibration Harshness
OEM
Original Equipment Manufacturer
PA
Polyamid
PAN
Polyacrylnitril
PBT
Polybutylenterephthalat
PDS
Progressive Damping System
PE
Polyethylen
PEEK
Polyetheretherketon
PEI
Polyetherimid
PES
Polyethersulfon
PET
Polyethylenterephthalat
PF
Phenolformaldehyd
PIM
Powder Injection Moulding (Pulverspritzgießen)
PM
Pulvermetallurgie
PMC
Polymer-Matrix-Composite
PP
Polypropylen
PPS
Polyphenylensulfid
PS
Prozesssicherheit
PSU
Polysulfon
PTO
Prototyp try out
PUR
Polyurethane
R2R
Ready to Race
RAT
Ram Air Turbine (Staudruckturbine)
RRECOM
Recycling and Recovery from Composites Materials
RS
Rasche Erstarrung
RTM
Resin Transfer Molding
S2
Sekundärwand 2
SMC
Sheet Moulding Compound
SOP
Start of Production
SUV
Sport Utility Vehicle
TLA
Total Life Cycle Assessment
TOC
Total Organic Carbon
UD
Unidirektional
UHM
Ultra-High-Modulus
UP
Ungesättigtes Polyester
UP-Harze
Ungesättigte Polyesterharze
USD
Upside Down
vmax
Höchstgeschwindigkeit
VE
Vinylester
VPTC
Virtual Prototype Concept Development
VPTF
Virtual Prototype Feasibility
ZB
Zusammenbau
ZV
Zielvereinbarung
1
Leichtbauprinzipien
1.1 Vorbild Natur
Helga Lichtenegger
Kurzfassung
Leichte Konstruktionen und sparsamer Materialeinsatz spielen in der Natur eine große Rolle. Eine Methode des Leichtbaus ist der gezielte Einsatz von Hohlräumen. Beispiele auf Werkstoffebene sind zellulare Strukturen wie Holz oder trabekulärer Knochen. Zellulare Strukturen können auch kombiniert mit Vollmaterial, z. B. als Sandwich- oder Röhren-Konstruktionen auftreten. Weiter bestehen viele biologische Werkstoffe aus leichten Grundkomponenten. Als Beispiele werden die organischen Faserverbunde Holz und Knochen näher beschrieben. Ein weiteres Spezifikum biologischer Werkstoffe ist deren hierarchischer Aufbau. An vereinfachten fraktalen Strukturen konnte gezeigt werden, dass eine höhere Anzahl von Hierarchieebenen die Materialeffizienz erhöhen kann. Zusätzlich haben biologische Strukturen die Fähigkeit, sich an geänderte Belastungen anzupassen, und gegebenenfalls sogar nachträglich Material einzusparen. In Knochen beispielsweise findet durch laufenden Auf- und Abbau ständig Strukturoptimierung statt.
1.1.1 Einleitung
Aufgrund der zunehmend verfeinerten technischen Möglichkeiten erlangen Leichtkonstruktionen und Leichtmaterialien in verschiedenen Bereichen wie Architektur, Fahrzeugbau, Luft- und Raumfahrt etc. immer größere Wichtigkeit. Der Vorteil liegt auf der Hand: Bieten Leichtbaukonzepte doch einerseits Materialersparnis, andererseits aber auch Energieersparnis im Antrieb bei beweglichen Konstruktionen.
In der Natur ist dieses Konzept seit jeher weit verbreitet. Der Grund dafür ist einerseits die sehr begrenzte Verfügbarkeit von Grundbausteinen und damit verbundene Erfordernis zum sparsamen Materialeinsatz, aber auch die Tatsache, dass biologische Organismen für die Materialsynthese metabolische Energie benötigen. Weiter spielen auch funktionale Gesichtspunkte eine Rolle: Essenziell ist Leichtbau beispielsweise bei fliegenden Organismen, um überhaupt Flugtauglichkeit zu erreichen. Nicht zuletzt verbessert Leichtbau auch die Stabilität von großen Konstrukten, die ihr eigenes Gewicht tragen müssen (z. B. Baumstämme).
Zusätzlich sind biologische Organismen noch mit weiteren Anforderungen konfrontiert, die für vom Menschen hergestellte Bauteile und Konstruktionen (meist) keine Rolle spielen. Biologische Organismen müssen über die gesamte Lebensdauer voll funktionsfähig sein und bleiben, und das bei veränderlichen Umweltbedingungen. Wartung, Reparatur oder Austausch von Ersatzteilen stehen außer Diskussion, jede Beseitigung von Schäden oder Anpassung muss „bei laufendem Betrieb“ erfolgen. Die Natur begegnet diesen Anforderungen mit hochkomplexen, an typische Lastfälle äußerst gut angepasste Konstruktionen, die sich durch Selektion über sehr lange Zeiträume hinweg entwickelt haben und ihre Zusammensetzung, Struktur und damit auch mechanischen Eigenschaften laufend anpassen können. Ein guten Überblick über Struktur und Eigenschaften von biologischen Materialien erhält man beispielsweise in [1–4]. In diesem Kapitel sollen einige Beispiele biologischen Leichtbaus, vorwiegend auf Werkstoffebene, kurz erläutert werden.
1.1.2 Materialersparnis durch Hohlräume
Eine nahe liegende Strategie ein Objekt leichter zu machen ist es, Material gezielt dort wegzulassen, wo typischerweise die geringsten Belastungen auftreten. Auf diese Weise erhält man Konstruktionen in Fachwerk- bzw. Skelettbauweise. Weiter können auch Werkstoffe selbst schaumartig oder zellular strukturiert sein. Zusätzlich zu Material- und Gewichtsersparnis bietet der zellulare Aufbau die Möglichkeit Hohlräume anderweitig zu verwenden, z. B. für den Stofftransport oder für metabolische Zwecke.
1.1.2.1 Zellulare Materialien
Beispiele für zellulare Materialien in der Natur sind zahlreich, z. B. Holz, Kork, trabekulärer Knochen etc. Morphologie, typische Zellgröße und relativer Volumenanteil von Material und Hohlräumen können stark variieren. Der relative Anteil von Vollmaterial (relative Dichte */s, wobei * die scheinbare Dichte ist und s die Dichte des Vollmaterials) reicht von 0,05 bis 0,3 für trabekuläre Knochen und 0,2 für Balsaholz (Ochroma lagopus) bis zu über 0,8 für die dichtesten Holzarten (Ebenholz und Guajak). Typischerweise liegen Zellgrößen im Bereich von wenigen bis mehreren Hundert Mikrometern [5].
Abb. 1.1.1 (a) Küstenmammutbaum (Sequoia sempervirens), (b) Materialeffizienz für Druckbelastung versus relative Dichte (1 bezieht sich auf Vollmaterial), experimentelle Daten aus Modellstruktur, (c) Holzzellen im Längsschnitt, (d) Holzzellen im Querschnitt, (e) idealisierte Wabenstruktur (b–e aus [10]).
Dreidimensional: trabekulärer Knochen Knochen ist in mehrerer Hinsicht als Leichtbaumaterial einzustufen. Zunächst umgibt auf makroskopischer Ebene eine kompakte Schale einen weniger dichten Kern. Das Innere von Knochen ist mit Knochenmark und teilweise mit schwammartiger Knochenstruktur gefüllt, auch trabekulärer oder spongiöser Knochen genannt. Trabekulärer Knochen besteht aus balkenförmigen bzw. plattenförmigen Verstrebungen als tragenden Elementen und ist ein typisches Beispiel für eine dreidimensionale zellulare Struktur. Die Dicke der Trabekel liegt im Bereich von 100 bis 300 μm.
Die mechanischen Eigenschaften von trabekulärem Knochen hängen stark von dessen Dichte ab. Es konnte gezeigt werden, dass die Deformation von trabekulärem Knochen hauptsächlich mit der Biegung und – bei entsprechend hohen Lasten – Knickung der Trabekel einhergeht. Daraus lässt sich ableiten, dass E-Modul und Druckfestigkeit proportional zum Quadrat der Dichte sind [7]. Ein entsprechender Zusammenhang zeigt sich auch empirisch, allerdings ist die Streubreite beachtlich, da bei gleicher Dichte starke Unterschiede in der Trabekelarchitektur auftreten [9]. So können die Trabekel als annähernd zylindrische Balken oder als perforierte Platten vorliegen (Abb. 1.1.2c, d). Erstere Struktur findet sich hauptsächlich bei trabekulärem Knochen geringer Dichte tief im (wenig belasteten) Inneren von Knochen, Letztere oft knapp unter der kompakten Außenhaut. Weiter kann durch Vorzugsausrichtung der Trabekel in Belastungsausrichtung strukturelle und mechanische Anisotropie auftreten. Dadurch verändert sich der Zusammenhang zwischen E-Modul bzw. Druckfestigkeit und Dichte und wird bei besonders starker Vorzugsorientierung (prismatische Struktur) in Längsrichtung linear [9].
1.1.2.2 Sandwich- und Röhren-Strukturen
Eine andere weit verbreitete Variante natürlichen Leichtbaus sind Sandwich- und Röhren-Konstruktionen. Erstere bestehen aus zwei dichten äußeren Schichten und einer weniger dichten Mittelschicht, die oft mit zellularem Material gefüllt ist. Einen solchen Aufbau findet man beispielsweise in Pflanzenblättern (Abb. 1.1.3e, f) oder auch in der Schädeldecke (Abb. 1.1.3d). Die Verbindung der dichten äußeren Schichten durch eine zellulare Mittelschicht bewirkt ein erhöhtes Flächenmoment im Vergleich zum Vollmaterial und verbessert dadurch den Widerstand gegen Biegung und Knicken. Setzt man umgekehrt eine bestimmte Biegesteifigkeit voraus, so erhält man durch eine Sandwich-Konstruktion eine Reduktion des Gesamtgewichts, und zwar sowohl gegenüber einer Konstruktion aus Vollmaterial als auch einer aus zellularem Material.
Röhren-Strukturen sind vor allem bei Pflanzenstängeln zu finden. Der Stängel besitzt eine dichte äußere Hülle, das Innere besteht aus einer Waben- oder Schaumstruktur. Dabei kann die Schaumstruktur als Mittelschicht innerhalb einer Doppelwand eingesetzt werden (Abb. 1.1.3a, b) oder den gesamten Innenraum ausfüllen. Auch in der Tierwelt ist diese Konstruktion durchaus verbreitet und findet sich beispielsweise in Federkielen oder Stacheln (Abb. 1.1.3c). Dabei wirkt der zellulare Kern als elastische Unterstützung der äußeren Schale, nimmt Deformationen auf und erhöht so den Widerstand gegen Knicken [7, 10].
Abb. 1.1.2 (a) Menschlicher Oberschenkelknochen (Femur), (b) Oberschenkelkopf im Längsschnitt: außen kompakter Knochen, innen trabekulärer Knochen, (c) trabekulärer Knochen aus dem Gelenksknorren Richtung Knie: orientierte plattenförmige Struktur, (d) trabekulärer Knochen aus dem Oberschenkelkopf: stabförmige Trabekel mit zufälliger Ausrichtung (a, b aus [3]; c, d aus [7]).
1.1.3 Organische Fasern und Faserverbunde
Leichtbaukonstruktionen erfordern neben geeigneter Architektur auch möglichst leichte Grundkomponenten. In biologischen Materialien bieten sich dafür vor allem organische Faserverbunde an. Beispiele sind Haut, Haare, Sehnen oder Pflanzenzellwände. Sie bestehen aus longitudinal steifen, organischen Fasern, die in eine weichere, ebenfalls organische, Matrix eingebettet sind. Je nach Gewebe können die Fasern aus Protein (z. B. Kollagen, Keratin) oder Polysacchariden (Zellulose, Chitin) bestehen; gemeinsam ist ihnen jedenfalls die relativ niedrige Dichte im Bereich von 1,2 bis 1,4 g/cm3. Faserverbunde bieten eine Reihe von Vorteilen wie leichte Herstellbarkeit im Wachstumsprozess oder große Variationsbreite von mechanischen Eigenschaften bei gleichen Grundkomponenten. Nachteilig ist allerdings die Gefahr des Materialversagens durch Faserknicken unter Druck. In der Natur finden sich einige Strategien diese Schwächen zu beheben, wie zum Beispiel die Vorspannung der Fasern unter Zug (in Pflanzenzellwänden durch Wachstumsspannungen und Zellinnendruck) oder die laterale Unterstützung der Fasern durch eine mechanisch stabile Matrix.
Abb. 1.1.3 Beispiele für Röhren-Konstruktionen und Sandwich-Strukturen in der Natur: (a, b) Grasstängel (gewöhnliche Quecke, Elytrigia repens), (c) Stachel vom Stachelschwein, (d) menschliche Schädeldecke, (e) Querschnitt durch Blatt der Schwertlilie (Iris), (f) Querschnitt durch Blatt von Rohrkolben (Typha); angepasst aus [7].
1.1.3.1 Zellulosefaserverbund in der Holzzellwand
Ein typisches Beispiel für einen natürlichen Faserverbund stellt die Holzzellwand dar. Sie besteht aus ca. 2,5 nm dicken teilkristallinen Zellulosefibrillen, die in eine amorphe Matrix aus Hemizellulose und Lignin eingebettet sind. Die Zellwand ist aus mehreren Schichten aufgebaut, wobei die Zellulosefibrillen in verschiedenen Schichten unterschiedlich orientiert sind [6] (Abb. 1.1.4a). In der dicksten Schicht (der Sekundärwand 2, auch S2) laufen die Zellulosefibrillen spiralförmig um die röhrenförmige Holzzelle, wobei der Kippwinkel gegen die Längsrichtung (Mikrofibrillenwinkel, MFA) in ein und demselben Baum an unterschiedlichen Stellen stark variieren kann. So finden sich beispielsweise im Zentrum von Stämmen und an der Unterseite von Ästen vorwiegend Holzzellen mit Zellulosefibrillen, die eine eher flache Spirale beschreiben (großer Mikrofibrillenwinkel), während an der Außenseite von älteren Stämmen vorwiegend Holz mit kleinerem Mikrofibrillenwinkel zu finden ist [11]. Tatsächlich ergibt eine Änderung des Mikrofibrillenwinkels von beinahe null (fast senkrechte Fibrillen) auf bis zu 50 Grad bei ansonsten weitgehend gleicher Struktur und Morphologie das Absinken des makroskopischen E-Moduls um einen Faktor 10, während die maximale Dehnung um einen Faktor 12 ansteigt (Abb. 1.1.4b) [12, 13].
1.1.3.2 Insektenpanzer: von hart bis weich mit Chitinfasern
Im Vergleich zu Holz ist die Variationsbreite von mechanischen Eigenschaften in Chitinfasergewebe noch wesentlich ausgeprägter: Der E-Modul variiert über 7(!) Größenordnungen, und zwar von ca. 1 kPa für intersegmentale Membranen bis zu 20 GPa für trockenes Chitingewebe aus Flügel oder Schädeldecke (Abb. 1.1.5b) [15]. Diese Variationsmöglichkeit ist biologisch notwendig, da das gesamte Insekt – vom Außenpanzer bis zu sämtlichen Organen – aus Chitinfasergewebe besteht. Zusätzlich zur Faserorientierung (siehe oben) können noch weitere Parameter variiert werden, wie z. B. der relative Anteil von steifen Fasern (Chitin) und Matrix (Protein). Weiter können die mechanischen Eigenschaften durch die Zusammensetzung und den Vernetzungsgrad der Proteinmatrix eingestellt werden [15, 16].
1.1.4 Hierarchischer Aufbau
Viele natürliche Werkstoffe weisen ausgeprägte Strukturen auf mehreren verschiedenen Längenskalen auf, weshalb sie auch als „hierarchisch“ aufgebaut bezeichnet werden. Markante Beispiele sind Holz, Knochen oder Sehnen. Typischerweise folgen Hierarchieebenen mit sehr unterschiedlicher Architektur aufeinander und ergeben zusammen einen hierarchischen Verbund, der im Allgemeinen ein hoch komplexes Spektrum von funktionellen Anforderungen erfüllt. Inzwischen ist allgemein anerkannt, dass der hierarchische Aufbau jedenfalls für die ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften biologischer Werkstoffe eine große Rolle spielt [4, 17–19]. Allerdings ist das Zusammenspiel der Hierarchieebenen noch wenig verstanden, da die einzelnen Strukturebenen experimentell schwer getrennt werden können.
Abb. 1.1.5 (a) Chitinfasergewebe in Heuschrecken: helikoidale Faserorientierung im Außenpanzer; parallele Faserrichtung in der Heuschreckensehne, (b) Ashby-plot E-Modul versus Dichte (siehe Abschnitt 3.3) von Chitinfasergewebe in Insekten im Vergleich zu anderen biologischen Materialien [15].
Interessant im Zusammenhang mit Leichtbaukonzepten ist vor allem, ob und wie ein hierarchischer Aufbau die mechanische Effizienz steigern kann. Mathematische Ansätze basierend auf vereinfachten fraktalen Modellstrukturen liefern erste Hinweise. Fraktale Modelle besitzen strukturelle Hierarchieebenen, die – anders als in biologischen Materialien – untereinander ähnlich sind. Ein Beispiel ist eine Wabenstruktur, deren Zellwände wieder aus Waben bestehen, deren Zellwände aus noch kleineren Waben bestehen (und so weiter). Lakes [19] zeigte an einer fraktalen Wabenstruktur, dass eine höhere Anzahl der Hierarchieebenen die relative Festigkeit unter Druck (bezogen auf die Festigkeit des Vollmaterials) erhöhen kann (Abb. 1.1.6). Der Grund dürfte darin liegen, dass diese Konstruktion ein Knicken verhindert. Ebenso zeigte sich ein positiver, allerdings geringerer, Effekt bei orientierten Schaumstrukturen – einer Morphologie wie sie in trabekulärem Knochen auftritt [19]. Die mechanische Effizienz einer Platte mit hierarchischer Verstrebungsstruktur unter Biegebelastung und einer hierarchischen Schalenkonstruktion unter Druckbelastung erreicht (unter bestimmten Voraussetzungen, wie elastische Verformung unter zumindest teilweiser Druckbelastung) eine größere Effizienz für eine größere Anzahl von Hierarchieebenen [20, 21].
Die Tatsache, dass ein fraktaler Aufbau eine Materialersparnis bringen kann, lässt die Vermutung zu, dass biologische Werkstoffe mit ihren vielen, strukturell unterschiedlichen Hierarchieebenen noch ein weit größeres Optimierungspotenzial haben, da auf unterschiedlichen Längenskalen im Prinzip jeweils andere Parameter optimiert werden können. Dies könnte sich auch in einer vorteilhaften Kombination von Eigenschaften niederschlagen: Knochen beispielsweise weist eine höhere Festigkeit auf als seine Grundkomponenten (Kollagen, Hydroxyapatit-Mineral) einzeln und bietet gleichzeitig einen sehr guten Kompromiss zwischen Steifigkeit und Zähigkeit.
1.1.5 Funktionsgerechtes Wachstum und Anpassung
Im Gegensatz zu vom Menschen hergestellten Konstruktionen, deren Bauteile bei Bedarf ausgetauscht und repariert werden können, sind biologische Organismen auf die ständige Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit ihrer Teile und bei Schäden und Verletzungen auch auf deren Selbstheilungsfähigkeit angewiesen. Zusätzlich müssen sie auch für Veränderungen in den Umweltbedingungen gewappnet sein. Im Wesentlichen gibt es zwei Strategien, um mechanische Eigenschaften anzupassen: den Materialanbau und den Materialumbau. Die erst genannte Strategie findet man beispielsweise in Holz, wo Material an der Außenseite, direkt unter der Rinde des Stammes oder Astes hinzugefügt wird [22], und zwar selektiv dort, wo es benötigt wird, um die lokalen Spannungen möglichst gleichmäßig zu verteilen [23]. Relevanter für den Leichtbau – und daher im vorliegenden Zusammenhang interessanter – ist die Strategie des Materialumbaus, bei der sowohl Material hinzugefügt als auch entfernt werden kann, d.h. auch Gewicht eingespart werden kann. Materialumbau findet in vielen biologischen Geweben statt, besonders offensichtlich ist die Anpassung an geänderte Lastverhältnisse in Knochen.
Der Anatom Wolff (1836–1902) erkannte als Erster, dass lebender Knochen sich verändert, je nach Art der Spannungen und Dehnungen, die er erfährt [24]. Das kann Veränderungen der äußeren Form oder der inneren Struktur zur Folge haben, im letzteren Fall beobachtet man Veränderungen der Porosität, des Mineralgehaltes und der Dichte. Die mechanische Optimierung erfolgt nach zwei Hauptprinzipien: Minimierung der Spannungen und geeignete Verteilung des Materials, um ein möglichst geringes Gewicht zu erzielen. Der Umbau des Knochens findet laufend statt und ermöglicht so eine zwar langsame, aber kontinuierliche Anpassung [2, 25].
Zu beobachten ist dieser Prozess sehr gut an Veränderungen in trabekulärem Knochen. Roschger et al. [26] untersuchten die trabekuläre Struktur in menschlichen Wirbelkörpern in pränatalem und adultem Zustand (Alter: von 15 Wochen nach Empfängnis bis 97 Jahre). Dabei konnten die Autoren eine Entwicklung der Trabekelarchitektur von vorwiegend radialer Ausrichtung in pränatalem Wachstumsknorpel hin zu orthogonaler Architektur (vertikal in Belastungsrichtung und normal dazu Stütztrabekel) in adultem Knochen beobachten. Diese Veränderung setzt direkt nach der Geburt ein, wenn die Wirbelsäule vertikale, mechanische Belastungen durch Gravitation aufnehmen muss. Ebenso wurden Veränderungen auf Nanometerebene beobachtet: Auf dieser Längenskala ist Knochen ein Verbund von Kollagenfasern und Hydroxyapatit-Mineralplättchen. Während in pränatalen Wirbelkörpern (mineralisierter Wachstumsknorpel) zufällige Ausrichtung der Mineralplättchen [27] vorherrscht, entwickelt sich mit der Zeit eine starke Vorzugsorientierung in Trabekel-Längsrichtung (Abb. 1.1.7).
Obwohl die Veränderungen in trabekulärem Knochen in den ersten Lebensjahren am auffälligsten sind, gibt es auch Beispiele für Anpassung im fortgeschrittenen Lebensalter. Die Ausbildung atypischer, diagonal ausgerichteter Trabekel bei einem 85-jährigen Mann in einem Wirbelkörper, der aufgrund eines Knochenauswuchses (Osteophyt) unter asymmetrischer Belastung stand, wurde in [3, 28] beschrieben. Kommt es umgekehrt zu verminderter Belastung (etwa durch längeren Aufenthalt in der Schwerelosigkeit bei Astronauten oder lokal durch ein schlecht angepasstes Implantat), wird Material eingespart. Diese – aus dem Blickwinkel des Leichtbaus – „intelligente“ Reaktion kann allerdings zu physiologisch unerwünschten Resultaten, nämlich zu vermehrtem Abbau von Knochen (Knochenschwund) und damit erhöhter Bruchanfälligkeit führen.
Abb. 1.1.7 Menschlicher Wirbelknochen, Trabekelarchitektur: (a) 17 Wochen nach Empfängnis, (b) 5 Wochen nach der Geburt, (c) 8 Jahre nach der Geburt [26].
1.1.6 Ausblick für technische Konstruktionen
Zusammenfassend darf festgestellt werden, dass biologische Materialien weiterhin als nachahmenswerte Beispiele für neue Leichtmaterialien und Leichtkonstruktionen dienen können. Manche Konzepte, wie zum Beispiel die Skelettbauweise, haben schon lange in die Technik Eingang gefunden – nicht zuletzt auch durch Bauprinzipien, die Wissenschaftler und Ingenieure aus der Natur entlehnt haben. So ließ sich Gustav Eiffel für die Verstrebungen des Eiffelturms durch die Trabekulärstuktur des menschlichen Oberschenkelknochens inspirieren. Allerdings bleibt noch vieles zu verwirklichen: Etwa eine hierarchische Strukturierung oder gar die Fähigkeit der laufenden Selbstanpassung würden weitere Möglichkeiten zur Steigerung der mechanischen Effizienz bieten.
Literaturnachweis
1 Vincent, J.F.V. (1990) Structural Biomaterials, revised edn, Princeton University Press, Princeton.
2 Elices, M. (ed.) (2000) Structural Biological Materials – Design and Structure-Property Relationships, Pergamon, Amsterdam, Lausanne, NY, Oxford, Singapore, Tokyo.
3 Fratzl, P., Weinkamer, R. (2007) Nature’s hierarchical materials. Prog. Mater. Sci., 52, 1263–1334.
4 Meyers, M.A., Chen, P.Y., Lin, A.Y.M., Seki, Y. (2008) Biological materials: Structure and mechanical properties. Prog. Mater. Sci., 53, 1–206.
5 Grosser, D. (1977) Die Hölzer Mitteleuropas, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.
6 Fengel, D., Wegener, G. (1989) Wood – Chemistry, Ultrastructure, Reactions, Walter de Gruyter, Berlin, New York.
7 Gibson, L.J. (2005) Biomechanics of cellular solids. J. Biomech., 38, 377–399.
8 Ashby, M.F., Gibson, L.J., Wegst, U., Olive, R. (1995) The Mechanical Properties of Natural Materials; I. Material Property Charts. Proceedings: Mathematical and Physical Sciences, 450, 123–140.
9 Gibson, L.J. (1985) The mechanical behavior of cancellous bone. J. Biomech., 18, 317–328.
10 Gibson, L.J., Ashby, M.F., Karam, G.N., Wegst, U., Shercliff, H.R. (1995) The Mechanical Properties of Natural Materials; II. Microstructures for Mechanical Efficiency. Proceedings: Mathematical and Physical Sciences, 450, 141–162.
11 Lichtenegger, H., Reiterer, A., Stanzl-Tschegg, S.E., Fratzl, P. (1999) Variation of cellulose microfibril angles in softwoods and hardwoods – A possible strategy of mechanical optimization. J. Struct. Biol., 128, 257–269.
12 Cave, D., Walker, J.C.F. (1994) Stiffness of Wood in Fast-Grown Plantation Softwoods – the Influence of Microfibril Angle. Forest Products Journal, 44, 43–48.
13 Reiterer, A., Lichtenegger, H., Tschegg, S., Fratzl, P. (1999) Experimental evidence for a mechanical function of the cellulose microfibril angle in wood cell walls. Philos. Mag. A, 79, 2173–2184.
14 Reiterer, A., Lichtenegger, H., Fratzl, P., Stanzl-Tschegg, S.E. (2001) Deformation and energy absorption of wood cell walls with different nanostructure under tensile loading. J. Mater. Sci., 36, 4681–4686.
15 Vincent, J.F.V., Wegst, U.G.K. (2004) Design and mechanical properties of insect cuticle. Arthropod Struct. Dev., 33, 187–199.
16 Andersen, S.O., Peter, M.G., Roepstorff, P. (1996) Cuticular sclerotization in insects. Comp. Biochem. Physiol. B-Biochem. Mol. Biol., 113, 689–705.
17 Aizenberg, J., Weaver, J.C., Thanawala, M.S., Sundar, V.C., Morse, D.E., Fratzl, P. (2005) Skeleton of Euplectella sp.: Structural hierarchy from the nanoscale to the macroscale. Science, 309, 275–278.
18 Baer, E., Hiltner, A., Jarus, D. (1999) Relationship of hierarchical structure to mechanical properties. Macromol. Symp., 147, 37–61.
19 Lakes, R. (1993) Materials with Structural Hierarchy. Nature, 361, 511–515.
20 Farr, R.S. (2007) Fractal design for an efficient shell strut under gentle compressive loading. Phys. Rev. E, 76, 056608-1-7.
21 Farr, R.S. (2007) Fractal design for efficient brittle plates under gentle pressure loading. Phys. Rev. E, 76, 046601-1-10.
22 Niklas, K.J. (1992) Plant Biomechanics. An Engineering Approach to Plant Form and Function, University of Chicago Press, Chicago.
23 Mattheck, C., Kubler, H., Timell, T.E. (1995) Wood – The Internal Optimisation of Trees, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.
24 Wolff, G. (1892) Das Gesetz der Transformation der Knochen, A. Hirschwald, Berlin.
25 Huiskes, R. (2000) If bone is the answer, then what is the question? J. Anat., 197, 145–156.
26 Roschger, P., Grabner, B.M., Rinnerthaler, S., Tesch, W., Kneissel, M., Berzlanovich, A., Klaushofer, K., Fratzl, P. (2001) Structural development of the mineralized tissue in the human L4 vertebral body. J. Struct. Biol., 136, 126–136.
27 Fratzl, P., Gupta, H.S., Paschalis, E.P., Roschger, P. (2004) Structure and mechanical quality of the collagen-mineral nano-composite in bone. J. Mater. Chem., 14, 2115–2123.
28 Mosekilde, L., Ebbesen, E.N., Tornvig, L., Thomsen, J.S. (2000) Trabecular bone structure and strength – remodelling and repair. J. Muscoloskel. Neuron. Interact., 1, 25–30.
29 Kretschmann, D. (2003) Natural materials – Velcro mechanics in wood. Nat. Mater., 2, 775–776.
1.2 Berechnungs- und Design-Konzepte für den Leichtbau
Franz G. Rammerstorfer und Thomas Daxner
Kurzfassung
Dieses Kapitel befasst sich zunächst mit Leichtbau-Berechnungsmethoden und nachfolgend mit Leichtbau-Konstruktionsprinzipien. Diese Reihenfolge wurde gewählt, um im Zuge der Beschreibung der Berechnungsmethoden auf die für Leichtbaukonstruktionen typischen Versagensformen (und deren Vorhersage) eingehen zu können. Dadurch wird die darauf folgende Vorstellung konstruktiver Maßnahmen, die eine effiziente Absicherung gegen diese Versagensarten darstellen, verständlicher.
Bei der Beurteilung und der konstruktiven Auslegung von Leichtbau-Systemen sind sowohl festigkeits- als auch steifigkeitsbezogene Kriterien zu beachten. Da Leichtbau zumeist mit dünnwandigen Strukturen betrieben wird, kommen vermehrt Kriterien zum Tragen, welche die Steifigkeit der Konstruktion zum Inhalt haben, wie z. B. Vermeidung von zu großen Deformationen bzw. Vermeidung von steifigkeitsdominierten Instabilitäten, wie Knicken oder Beulen. Demgemäß wird in diesem Kapitel diesen Versagensformen besonderes Augenmerk zugewandt.
Dem Umstand entsprechend, dass im modernen Leichtbau in vermehrtem Ausmaß Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde eingesetzt werden, wird auch auf die Berechnung von Sandwich- und Laminatstrukturen eingegangen.
Unter dem Titel „Leichtbau-Konstruktionsprinzipien“ werden Empfehlungen dahingehend gegeben, wie durch bisweilen relativ kleine und einfache Veränderungen in der konstruktiven Gestaltung Masse (und damit Gewicht) eingespart bzw. die Tragfähigkeit der Konstruktion signifikant erhöht werden kann. Es werden die Vor- und Nachteile der Integral- bzw. Differentialbauweise diskutiert, und schließlich wird aufgezeigt, wie Methoden der Topologie-, Form-, Parameter- und Materialoptimierung nutzbringend im Leichtbau eingesetzt werden können.
1.2.1 Einleitung
„Leichtbau“ ist ein modernes Schlagwort geworden und in nahezu allen Gebieten des modernen Maschinenbaus als eine der vordringlichsten Zielsetzungen zu finden. Damit Leichtbau aber nicht nur ein Schlagwort ist, sind entsprechende Kenntnisse über Leichtbau-Konstruktionskonzepte und Leichtbau-Berechnungsmethoden und deren gezielter Einsatz unverzichtbar.
Was ist nun „Leichtbau“? Leichtbau ist das Gestalten von Bauteilen in der Weise, dass sie – bei Erfüllung der Anforderungen hinsichtlich ihres Einsatzes – möglichst leicht sind; exakter ausgedrückt: möglichst geringe Masse besitzen.
Wenn hier von der „Erfüllung der Anforderungen hinsichtlich des Einsatzes der Bauteile“ die Rede ist, dann bedeutet dies unter anderem, dass bei der Gestaltung auch auf die unterschiedlichen Versagensformen Bedacht zu nehmen ist. Wegen der aus den Leichtbau-Konzepten resultierenden eher dünnwandigen bzw. schlanken Konstruktionen ist keinesfalls allein auf Festigkeitserfordernisse (Materialversagen), wie sie z. B. im Kapitel 1.3 behandelt werden, sondern – in vermehrtem Ausmaß – auch auf Steifigkeitserfordernisse zu achten: Die Verformungen dürfen nicht unzulässig groß werden, und die Stabilität muss ausreichend gesichert sein. Dies bedeutet, dass die Leichtbau-Konstruktionen hinsichtlich statischer Instabilitäten, wie Knicken, Kippen, Beulen, Durchschlagen oder Erreichen der plastischen Traglast bzw. hinsichtlich Formen von dynamischen Instabilitäten, wie Flattern oder Parameterresonanzen, zu untersuchen sind. Demgemäß haben Konzepte der Stabilitätsanalyse im Leichtbau besondere Bedeutung.
Während die leichtbaugemäße Materialauswahl im Kapitel 2 und der Fertigungsleichtbau im Kapitel 3 näher betrachtet werden, beschäftigt sich das vorliegende Kapitel neben einigen grundsätzlichen Konstruktionsrichtlinien des Leichtbaus und einigen Betrachtungen zu Optimierungsstrategien vorwiegend mit Berechnungsmethoden des Leichtbaus, wie sie z. B. in [1–4] ausführlicher dargestellt sind.
Mit genaueren und zuverlässigeren Berechnungsmethoden können die Auslegungsbedingungen leichtbaugerechter gemacht werden, d. h. Sicherheitszuschläge, die aufgrund von nur ungefähren Abschätzungen oder näherungsweisen Berechnungen als masseerhöhend aufgeschlagen wurden, können reduziert werden bzw. ganz entfallen. Sicherheitsfaktoren können – wo es aufgrund genauerer Berechnungsmethoden gerechtfertigt erscheint – näher an 1,0 herangerückt werden, und über Optimierungsverfahren kann erreicht werden, dass die Auslastung des Materials weitgehend vergleichmäßigt wird und nicht mehr einzelne Details (z. B. Spannungskonzentrationen an Kerben oder Lasteinleitungsstellen) die Wanddicke auch in weniger beanspruchten Gebieten mit bestimmen.
Aufgrund des geringen Ausmaßes an verfügbarem Platz wird im vorliegenden Kapitel bewusst auf tiefergehende Betrachtungen verzichtet; bisweilen wird als Ersatz dafür auf die einschlägige Literatur verwiesen.
1.2.2 Einige Leichtbau-Berechnungsmethoden
Aus der Sicht der Strukturmechanik im Leichtbau ist grundsätzlich zwischen Deformations-/Spannungsanalysen, Stabilitätsanalysen und Schwingungsanalysen zu unterscheiden. Ferner kann zwischen analytischen Methoden und numerischen, d. h. computerunterstützten Methoden, wie z. B. die Methode der Finiten Elemente, unterschieden werden. Die Methode der Finiten Elemente (die ihren Ursprung dem Leichtbau im Flugzeugbau verdankt) ist im Leichtbau unverzichtbar; dennoch würde es den Rahmen dieses Abschnitts sprengen, die Methode zu beschreiben; dazu sei auf die Literatur verwiesen – siehe z B. [5]. Allerdings sei mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass ohne ausreichende Kenntnisse der theoretischen Hintergründe der FE-Methoden und der Grundlagen der Festigkeitslehre die Verwendung noch so benutzerfreundlicher FE-Programme in hohem Maße riskant und somit nicht ratsam ist.
Im Folgenden werden einige Aspekte der analytischen Spannungsanalyse von typischen Leichtbaustrukturen diskutiert, ohne dass vertieft auf die Methoden eingegangen wird. Den Stabilitätsbetrachtungen, der Behandlung von Sandwich-Strukturen und Laminaten sowie der Optimierung werden eigene Abschnitte dieses Buchteils gewidmet.
1.2.2.1 Die Schubfeld-Theorie
Dünnwandige Platten- oder Schalenkonstruktionen sind im Allgemeinen beulgefährdet. Die Beullast bzw. die Beulsicherheit lässt sich durch Steifen bzw. Rippen, welche – sofern sie zur Erzwingung von Knotenlinien in der Beulfigur ausreichend steif sind – die Abmessungen der relevanten Beulfelder reduzieren, beträchtlich erhöhen (siehe Abb. 1.2.1). Rippenrost-Strukturen sind oftmals nicht ausreichend steif und fest gegenüber Schubbelastung (aus Querkraftbiegung und Torsion); diesem Mangel kann durch die Aufbringung einer dünnen „Haut“, welche vorwiegend die Schubbeanspruchungen aufnimmt, abgeholfen werden, und zur Erzeugung wandartiger Leichtbaukonstruktionen werden vielfach Bauteile aus dünnen Blechen, die an relativ steife Gurte angeschlossen sind, gestaltet (vgl. Abb. 1.2.1). In all diesen Fällen entstehen Konstruktionen, welche mittels der im Folgenden skizzierten Schubfeld-Theorie zur näherungweisen Erfassung der Beanspruchungen behandelt werden können.
Die Abb. 1.2.2 zeigt am Beispiel der Querkraftbiegung eines I-Trägers mit hohem, dünnem Steg die grundsätzlichen Näherungen der Schubfeld-Theorie.
Die in Abb. 1.2.2b dargestellte Näherung setzt voraus, dass gilt: tSh und tShbtG (allg. ASAg). Die hier gezeigten Vereinfachungen lassen sich auch auf komplexere Leichtbau-Strukturen, die aus Stäben und einer verbindenden „Haut“ aufgebaut sind, übertragen. Dabei setzt die Schubfeld-Theorie für rechteckige Schubfelder näherungsweise voraus, dass (im unterkritischen Zustand) in den (als gelenkig miteinander verbunden angenommenen) Randstäben nur Normalkräfte und in den Feldern nur Schubspannungen herrschen. Damit ergibt sich, dass der Schubfluss qi entlang der Berandung des Schubfeldes i konstant ist, woraus ein linearer Verlauf der Normalkraft in den Stäben folgt. (Die Näherungsannahmen führen zu einer kinematischen Unverträglichkeit, die hier nicht näher behandelt wird.)
Abb. 1.2.1 Schubfelder im Dachaufbau eines Schienenfahrzeugs.
Abb. 1.2.2 Normal- und Schubspannungsverläufe zufolge Querkraftbiegung (a) in einem I-Träger und (b) entsprechende Schubfeld-Näherungsannahmen.
Die Anwendung der Schubfeld-Theorie sei am einfachen Beispiel des in Abb. 1.2.3 dargestellten wandartigen Trägers (Schubfeld-Träger) demonstriert.
Abb. 1.2.3 Anwendung der Schubfeld-Idealisierungen auf einen wandartigen Träger mit zwei Schubfeldern. Die Beanspruchungen der Wandstäbe (Normalkraftverteilung) sind im rechten Bild in Diagramm-Form dargestellt. Im Bild unterhalb der Prinzipskizze wird die Bedeutung der Normalkraft-Diagramme schematisch erklärt.
Folgendes sei angemerkt: Leichtbaukonstruktionen mit Schubfeldern haben im Allgemeinen auch dann noch beachtliche Tragreserven, wenn die Schubfelder (die Hautfelder, die Stegbleche etc.) schon gebeult sind. Es geht dann das Schubfeld im Nachbeulzustand mehr und mehr in ein „Zugfeld“ über (siehe Abschnitt 1.2.3.3). Allerdings muss beachtet werden, dass freistehende wandartige Träger wegen ihrer sehr geringen Torsionssteifigkeit leicht zu Instabilitäten in Form des „Kippens“ neigen.
1.2.2.2 Torsion von stabförmigen Leichtbaukonstruktionen
Bei stabförmigen Leichtbau-Strukturen mit dünnwandigen Querschnitten bestehen bei Torsionsbeanspruchung gravierende Unterschiede zwischen offenen und geschlossenen Profilen. Ohne auf Effekte aus der Wölbkrafttorsion einzugehen, seien auf der Basis der Näherungen der Saint Venant’schen Torsion hier die für den Leichtbau wichtigsten Beziehungen zusammengefasst. Vorweg seien einige der wesentlichen Unterschiede zwischen offenen und geschlossenen Profilen gezeigt (siehe Abb. 1.2.4).
Besonders zu beachten ist, dass Stäbe mit offenem Profil gegenüber jenen mit geschlossenem Profil bei sonst ähnlicher Geometrie und gleichem Materialaufwand deutlich geringere Torsionssteifigkeit besitzen.
Abb. 1.2.4 Torsion (a) offener und (b) geschlossener dünnwandiger Profile.
Stäbe mit offenem, dünnwandigem Profil Die im Allgemeinen sehr geringe Torsionssteifigkeit von Stäben mit offenem, dünnwandigem Profil kommt daher, dass ihr Drillwiderstand JT im Gegensatz zu vergleichbaren geschlossenen Profilen sehr klein ist. Die Verdrillung ϑ und die Schubspannung τmax sind somit bei sonst gleichen Verhältnissen größer als bei vergleichbaren geschlossenen Profilen. Ohne Wölbbehinderung gilt (mit l als abgewickelter Profillänge):
(1.2.1)
(1.2.2)
Das Vorgehen bei Berücksichtigung einer Wölbbehinderung ist z. B. in [1, 6, 7] beschrieben.
Die Lage des Schubmittelpunkts M (das ist jener Punkt in der Querschnittsebene, durch welchen die Wirkungslinie einer Querkraft gehen muss, wenn diese Querkraft keine Verdrillung bewirken soll) ist bei Bezugnahme auf die Trägheitshauptachsen y, z durch den Schwerpunkt S bestimmt durch (Abb. 1.2.5a):
(1.2.3)
Dabei bedeuten Jy und Jz die axialen Flächenträgheitsmomente des gesamten Querschnitts und Sy(s) und Sz(s) die statischen Momente der innerhalb s wegfallenden Flächenanteile, jeweils bezogen auf die y- bzw. z-Achse.
Anmerkung: Bei symmetrischen Profilen liegt der Schubmittelpunkt auf der Symmetrieachse. In diesem Fall kann für die Bestimmung der Lage von M ein beliebiger Bezugspunkt auf der Symmetrieachse gewählt werden (d. h. der Schwerpunkt muss nicht ermittelt werden).
In Abb. 1.2.5b ist für das geschlitzte Rohr der Schubmittelpunkt eingetragen; er liegt im Abstand R außerhalb des ungeschlitzten Scheitels. Ähnliche Verhältnisse liegen beim C-Profil usw. vor!
Abb. 1.2.5 Beziehung des Schubmittelpunkts ‘M’ zum Schwerpunkt ‘S’ des offenen, dünnwandigen Profils mit (a) konzentrierten Querschnittsanteilen und (b) Lage von ‘M’ für das geschlitzte Kreisprofil.
Stäbe mit geschlossenem, dünnwandigem Profil Wie erwähnt, ist bei geschlossenen, dünnwandigen, einzelligen Profilen (Abb. 1.2.6) der Torsions-Schubfluss entlang der Profilwand-Mittellinie, qT, konstant, und somit gilt:
(1.2.4)
mit der von der Profilwand-Mittellinie eingeschlossenen Fläche A.
Für die Verdrillung ϑ gilt mit Gl. (1.2.4):
(1.2.5)
Der Drillwiderstand ergibt sich aus:
(1.2.6)
Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass die Verdrillung eines Stabs mit geschlossenem Profil um Größenordnungen kleiner sein kann als beim Stab mit gleichartigem, aber geschlitztem, d. h. offenem Profil.
Die Torsion von Stäben mit mehrzelligem, geschlossenem, dünnwandigem Hohlprofil (z. B. bei Strangpressprofilen) wird z. B. in [7] behandelt.
Abb. 1.2.6 Dünnwandiges, geschlossenes Profil, Erläuterung zur 1. Bredt’schen Formel.
1.2.3 Stabilitätsverlust – Knicken, Kippen, Beulen, Durchschlagen
Leichtbaukonstruktionen bzw. Komponenten davon können unter statischer Belastung instabil werden durch Gleichgewichtsverzweigung (Knicken, Kippen, Beulen), durch Durchschlagen („snap-through“ stellt einen dynamischen Prozess dar), durch Erreichen der plastischen Traglast oder – im Falle nichtkonservativer Belastung – durch Flattern. Kombinationen dieser Instabilitäten sind natürlich auch möglich. Eine ausführliche Behandlung von Stabilitätsproblemen ist [8–11] zu entnehmen. Die besonderen Aspekte des Stabilitätsverlusts unter thermischer Belastung werden hier nicht behandelt; diesbezüglich siehe z. B. [12].
Die häufigste Form des Stabilitätsverlusts ist die Gleichgewichtsverzweigung. Dabei ist die Kenntnis der Art des Nachbeulverhaltens wesentlich für die Beurteilung der Imperfektionsempfindlichkeit der Bauteile; siehe dazu die generischen Formen der Last-Verschiebungskurven in Abb. 1.2.7.
Abb. 1.2.7 Last-Verschiebungsdiagramme für typische Arten des Stabilitätsverlusts von Gleichgewichtszuständen: (a–c) Gleichgewichtsverzweigungen, (d) Durchschlagen.
Schwach gewölbte oder schwach gewinkelte, polygonale Leichtbaukonstruktionen neigen zum Stabilitätsverlust durch Durchschlagen (Abb. 1.2.7d). Bei monotoner Laststeigerung schlägt beim Erreichen des Durchschlagspunkts (Maximum im Last-Verschiebungsverlauf) das Bauteil durch, um eventuell einen entfernteren Gleichgewichtszustand (der nicht unbedingt existieren muss) einzunehmen, wenn der dynamische Prozess (durch Dämpfung) abgeklungen ist. In vielen Fällen sind dabei die Verformungen so groß, dass sich plastische Deformationen einstellen bzw. die Konstruktion völlig kollabiert.
Bei der Beurteilung der Stabilitätssicherheit von Leichtbaukonstruktionen ist zu beachten, dass je nach geometrischen Verhältnissen und örtlichen Steifigkeiten unterschiedliche Formen des globalen und lokalen Stabilitätsverlusts möglich sind (Abb. 1.2.8).
Demgemäß sind alle erwartbaren Formen des Stabilitätsverlusts in Betracht zu ziehen, um die niedrigste kritische Last zu ermitteln. Tritt eine dieser Formen ein, so wird im Allgemeinen die Steifigkeit des Systems so verändert, dass bei weiterer Laststeigerung (sofern diese überhaupt möglich ist) diese Steifigkeitsveränderung zu berücksichtigen ist. In vielen Fällen ist das erste Auftreten eines Stabilitätsverlusts als Belastungsgrenze zu werten, gegen die man mit ausreichender (aber nicht unnötig hoher) Sicherheit dimensionieren sollte. Allerdings tritt bei stabilem Nachbeulverhalten der vollständige Zusammenbruch oft erst bei erheblich größeren Lasten ein (vgl. dazu den bereits erwähnten Übergang vom Schubfeld zum Zugfeld).
1.2.3.1 Stabilitätsverlust bei axial belasteten Stäben
Für den globalen Stabilitätsverlust von axial gedrückten, stabförmigen Leichtbaustrukturen stellt das Biegedrillknicken den allgemeineren Fall dar, in welchem das „klassische“ Euler-Knicken (Biegeknicken) als Spezialfall enthalten ist.
Das Biegedrillknicken Bei geraden, axial gedrückten Stäben können die Instabilitätsformen des Biegeknickens, des (gekoppelten) Biegedrillknickens und des reinen Drillknickens beobachtet werden. Für isotropes, homogenes, linear elastisches Material können diese Verzweigungsfälle bei konstantem Querschnitt in weiten Anwendungsgebieten mit folgenden, im Allgemeinen gekoppelten Differentialgleichungen für die Transversalverschiebungen v und w in y- bzw. z-Richtung und die Verdrehung χ behandelt werden [13]:
(1.2.7)
(1.2.8)
(1.2.9)
Abb. 1.2.8 Verschiedene Arten lokalen (a–e) und globalen (f, g) Stabilitätsverlustes, demonstriert an einem von-Mises-Zweistab: (a) Knicken eines Fachwerkstabs, (b) Beulen eines Hohlprofils, (c) Profilwand-Beulen, (d) Knittern von Sandwich-Deckschichten, (e) Dimpling, (f) globales Durchschlagen der Konstruktion, (g) globales Knicken des Fachwerks als Stab.
Dabei sind Jy und Jz die auf die Trägheitshauptachsen durch den Flächenschwerpunkt bezogenen axialen Flächenträgheitsmomente, P ist die im Schwerpunkt des Querschnitts angreifende, als Druck positiv definierte Axialkraft, und iM der polare Trägheitsradius des Querschnitts, bezogen auf den Schubmittelpunkt M, dessen Koordinaten vom Schwerpunkt aus gezählt werden:
(1.2.10)
Weiter sind A die Querschnittsfläche, JP das polare Flächenträgheitsmoment und CW der Wölbwiderstand.
Aus dem Satz der Gl. (1.2.7) bis (1.2.9) und den Randbedingungen können die Eigenwertprobleme für die Berechnung der Verzweigungslasten hergeleitet werden.
(1.2.11)
Der Lösungsansatz (1.2.11) erfüllt alle Randbedingungen und stellt für die Verzweigungslasten (kritische Axiallasten) eine nichttriviale Lösung des obigen Differentialgleichungssystems dar. Nach Einsetzen in (1.2.7) bis (1.2.9) erhält man das folgende algebraische Gleichungssystem für die „Lagekoordinaten“ V,W,X:
(1.2.12)
Für V ≠ 0 (Knicken um die z-Achse) und für W ≠ 0 (Knicken um die y-Achse) ergeben sich jeweils die klassischen Euler-Formeln des Stabknickens:
(1.2.13)
wogegen sich für X ≠ 0 die kritische Last für reines Drillknicken zu
(1.2.14)
ergibt.
Die zur Beurteilung der Stabilitätssicherheit maßgebliche kritische Last ist der kleinste der obigen Werte.
(1.2.15)
Die Nullstellen P1*, P2* dieser quadratischen Gl. (1.2.15) stellen die kritischen Lasten für das gekoppelte Biegedrillknicken dar. Auch hier ist die bemessungsrelevante kritische Last durch die kleinste der kritischen Lasten gegeben.
Dieses Vorgehen führt für Stäbe mit vollständig unsymmetrischem Querschnitt (mit den y- und z-Achsen als Trägheitshauptachsen durch den Schwerpunkt) auf
(1.2.16)
Die Nullstellen P1*, P2*, P3* dieser kubischen Gl. (1.2.16) stellen Biegedrillknicklasten dar, wobei wiederum der kleinste Wert die relevante kritische Axiallast ist.
Das Euler-Knicken Für Fälle, in denen Drillknicken oder Biegedrillknicken ausgeschlossen werden kann, also reines Biegeknicken betrachtet wird, ergibt sich für homogene Stäbe konstanten Querschnitts die hinlänglich bekannte Knicklast
(1.2.17)
wobei die „Knicklänge“ lK von den Randbedingungen abhängt (Abb. 1.2.9).
Die kritische Axialspannung im Querschnitt – die Knickspannung – ergibt sich zu:
(1.2.18)
Dabei ist i der Trägheitsradius für das axiale Flächenträgheitsmoment. Wenn sich für die Knickspannung ein Wert größer als die Streckgrenze des Materials ergibt (also bei gedrungenen Stäben, d. h. geringer Schlankheit λk), dann liegt kein elastisches Knicken mehr vor, und es muss mit plastischem Knicken gerechnet werden. Eine ausführliche Behandlung des inelastischen Knickens findet man in [8]; praktische Vorgehensweisen findet man auch in [1, 2].
Es gilt zu beachten, dass für die Bewertung der Sicherheit gegen Knicken jene von der Querschnittsform und von den Randbedingungen abhängige Knickachse bzw. Richtung der transversalen Verschiebung w heranzuziehen ist, welche die kleinste Knicklast ergibt.
Abb. 1.2.9 Bestimmung der Knicklänge lK für das Stabknicken bei unterschiedlichen Randbedingungen.
Die Knicklast eines homogenen, elastisch gebetteten Stabs (Winkler-Bettung) wird z. B. in [4, 6] behandelt.
Bei Berücksichtigung der Schubdeformationen liegt folgender Zusammenhang zwischen der Euler-Knicklast PK* (d. h. ohne Schubeinfluss) gemäß Gl. (1.2.17) und der Knicklast K* (mit Schubeinfluss) wie folgt vor [4, 6]:
(1.2.19)
wobei (GAs) die Schubsteifigkeit, mit dem Schubmodul G und dem Schubquerschnitt AS, darstellt. Derartige die Knicklast reduzierende Effekte sind auch bei Sandwich-Konstruktionen (siehe Abschnitt 1.2.4.1) zu beachten.
1.2.3.2 Zum Kippen von hohen, schmalen Biegeträgern
Bei stabartigen Leichtbaukonstruktionen mit Querschnitten, die durch geringe Torsionssteifigkeit und JyJz gekennzeichnet sind (Abb. 1.2.10), kann auch eine Biegemomenten- bzw. Querbelastung (Moment My, Querkraft Qz, Streckenlast pz) zu einer Instabilität, nämlich zum Kippen führen. Mit χ ist in Abb. 1.2.10 die Querschnittsverdrehung gekennzeichnet; vgl. dazu auch Gl. (1.2.7) bis (1.2.9).
Diese Instabilitätsform ist z. B. in [8] behandelt. Formeln für kritische Lasten finden sich auch in [14, 15]. Zum Beispiel ergibt sich für einen homogenen Kragbalken mit hohem, dünnwandigem Rechteckquerschnitt b × h, bei hb und lh die hinsichtlich Kippens kritische Querlast, oben am freien Balkenende angreifend, näherungsweise zu
(1.2.20)
1.2.3.3 Beulen von Platten
Platten können unter Belastungen in Plattenebene aus der trivialen (d. h. ebenen) Deformation heraus in eine nichttriviale Deformationsfigur (Transversalverschiebung w) verzweigen, d. h. beulen. Der aus der Belastung resultierende Membranspannungszustand wird durch die Schnittgrößen Nij, das sind Membrankräfte je Längeneinheit, beschrieben. Hier sei beispielhaft das elastische Beulen von isotropen Rechteckplatten skizziert; weitergehende Betrachtungen sind z. B. in [1, 3, 16] zu finden.
Abb. 1.2.10 Kippen von hohen Trägern.
Elastisches Beulen von dünnen Rechteckplatten Jener Membranspannungszustand (bzw. die zu diesem Membranspannungszustand führende Belastung) ist als „kritisch“ zu bezeichnen, bei dem – in Analogie zu der bei den Stäben beschriebenen Vorgehensweise – unter Beachtung der Randbedingungen, erstmals eine nichttriviale Lösung der linearisierten und auf reine Scheibenbelastung spezialisierten von Kármán’schen Plattengleichung (vgl. [16]),
(1.2.21)
auftritt (Druck-Membrankräfte sind hier positiv angenommen). Die Plattenbiegesteifigkeit ist für homogene, linear elastische, isotrope Platten der Dicke t durch gegeben.
Auf diese Weise gewinnt man unter Voraussetzung elastischen Beulens für festgelegte Belastungsarten und Randbedingungen die den beulkritischen Zustand charakterisierende Membranspannung zu
(1.2.22)
Darin bedeutet k den Beulfaktor, der von der Belastungsart, den Randbedingungen und dem Längen-Breiten-Verhältnis der Rechteckplatte abhängt. Auch die Querdehnungszahl v geht in k ein. Diese Abhängigkeiten sind in Diagrammform in diversen Sammlungen zu finden, siehe z. B. [1, 3]. Für konstante einachsige Membran-Druckbelastung sind beispielhaft derartige Diagramme in Abb. 1.2.11 dargestellt.
Für elastisches Beulen bei gemischten Membran-Beanspruchungen stehen Interaktionsbeziehungen (siehe z. B. [17]) bzw. Interaktionsdiagramme (siehe z. B. [3]) zur Verfügung. In Abb. 1.2.12 ist als Beispiel das Interaktionsdiagramm für zweiachsige Druck-Membranbelastung eines langen Plattenstreifens dargestellt. Darin bedeutet Rx das Verhältnis zwischen der vorliegenden Druckspannung in x-Richtung und der beulkritischen Spannung, bestimmt unter einachsiger Beanspruchung in x-Richtung; in analoger Weise ist Ry das Verhältnis zwischen Lastspannung und Beulspannung in y-Richtung. Liegt der durch (Rx, Ry) bestimmte Punkt im Inneren des von der Interaktionskurve begrenzten Bereichs, dann liegen unterkritische Verhältnisse vor; außerhalb der Interaktionskurve liegende Wertepaare stellen instabile Lastkombinationen dar.
Die Beziehungen für die Ermittlung der kritischen Membranspannungen sind unter Annahme linear elastischen Materialverhaltens gewonnen worden. Demgemäß ist zu beachten, dass Ergebnisse für kritische Spannungen, welche eine Vergleichsspannung liefern, die über der Streckgrenze liegt, ungültig sind; in solchen Fällen liegt inelastisches Beulen vor, welches hier nicht behandelt wird; siehe dazu z. B. [1, 3].
Abb. 1.2.11 Diagramm zur Bestimmung des Beulfaktors k zum Beulen von Rechteckplatten unter einachsiger Druckbelastung. Die Beulfiguren für verschiedene Längen-Breiten-Verhältnisse und Lagerungsbedingungen sind dargestellt.
Abb. 1.2.12 Interaktionsdiagramm bei zweiachsigem Druck (langer Plattenstreifen).
Analog zum Stabknicken reduziert auch beim Plattenbeulen die Berücksichtigung der transversalen Schubnachgiebigkeit die kritischen Lasten; vgl. [4, 18]. Dies ist besonders bei Sandwichplatten zu beachten!
Hinsichtlich der Behandlung des Beulens von versteiften Platten und auch deren Tragreserven nach Eintreten erster lokaler Instabilitäten (Stichwort „mittragende Breite“) sei hier auf die Literatur verwiesen, siehe z. B. [1, 3]. Das Beulen von orthotropen Platten, das auch bei Platten aus Verbundwerkstoffen eine Rolle spielen kann, ist z. B. in [16, 18] behandelt.
Lokales Beulen von Profilwänden bei gedrückten, dünnwandigen Stäben Axial gedrückte Stäbe, die aus dünnwandigem Profil gebaut sind, können instabil werden durch globales Knicken (einschließlich Biegedrillknicken) als Stab, durch elastisches Beulen der Stabwände bzw., bei vergleichsweise eher dickeren Wänden, durch plastisches Beulen der Profilwände sowie durch Kombinationen obiger Formen; siehe dazu Abb. 1.2.13.
Beulformen für das Profilwandbeulen sind schematisch in Abb. 1.2.14 dargestellt.
Dieses lokale Beulen der Stabwände kann in erster Näherung als das Beulen von einzelnen Plattenstreifen bei geeigneter (konservativer) Festlegung der Randbedingungen behandelt werden. Für eine genauere Analyse des Beulens von Stabwänden ist der Umstand zu berücksichtigen, dass die Beulmuster der an einer gemeinsamen Kante verbundenen Stabwände nicht voneinander unabhängig sind, sondern im Allgemeinen gleiche Wellenzahl haben. In [3] sind solche Probleme behandelt.
Abb. 1.2.13 Typische Formen von Instabilitäten von Stäben mit dünnwandigem Profil (Profilwandbeulen).
Abb. 1.2.14 Schematische Darstellung der Amplitudenverteilung der Beulmuster bei Profilwandbeulen.
Übergang vom Schubfeld zum Zugfeld (Zugfeldtheorie) Eine besondere Form des Plattenbeulens stellt das Beulen von Schubfeldern dar. Der Spannungszustand im unterkritisch beanspruchten Schubfeld kann durch den zentrisch liegenden Mohr’schen Spannungskreis dargestellt werden (Abb. 1.2.15).
Erreicht die durch Erhöhung der äußeren Belastung gesteigerte Schubspannung im Schubfeld die kritische Schubspannung , mit dem Beulfaktor k, der aus Diagrammen in Abhängigkeit von der Art der Einbindung des Schubfelds in die Randstäbe entnommen werden kann, siehe (z. B. [3]), so beult das Schubfeld, und in weiterer Folge bilden sich Falten in etwa normal zur Richtung der Druck-Hauptnormalspannung, also etwa 45° gegenüber den Randstäben geneigt, aus.
Die Schubspannung τ im Stegblech kann auch im überkritischen Zustand gesteigert werden. Es kann also die äußere Last bei bereits gebeultem Feld noch (im Allgemeinen sehr beträchtlich) erhöht werden. Die Hauptnormaldruckspannung kann im überkritischen Fall nur noch schwach ansteigen; somit wandert der mit τ als Radius größer werdende Mohr’sche Spannungskreis in der Abb. 1.2.15 nach rechts, und es bildet sich ein „Zugfeld“ (Wagner’sches Zugfeld; siehe [19]) aus.
(1.2.23)
Die nur im überkritischen Zustand des Felds auftretenden Normalspannungskomponenten σxx und σyy (es sind dies immer Zugspannungen!) führen zu zusätzlichen Beanspruchungen der Verbindungen zwischen den Feldern und den Stäben sowie zu zusätzlichen Beanspruchungen der Stäbe selbst: Biegung und weitere Normalkräfte.
Abb. 1.2.15 Mohr’sche Spannungskreise; Entwicklung des Zugfelds.
Abb. 1.2.16 Vollständiges Versagen eines Schubfeldträgers bei hohen Überschreitungsgraden.
Das Auftreten von Falten in den Feldern ist – je nach Bemessungsrichtlinie – im Allgemeinen noch keine Versagensform; somit müssen für Bauteilversagen nach dem ersten Auftreten von Falten in den Feldern folgende Ereignisse in Betracht gezogen werden (Abb. 1.2.16): lokales Plastizieren (bleibende Deformationen), Zugbruch des Felds (quer zu den Falten – σ1 maßgeblich), globaler Stabilitätsverlust durch Knicken der Stäbe, Beulen der Profilwände der Stäbe, Versagen der Verbindungen, globales Kippen bei wandartigen Trägern etc.
1.2.3.4 Zum Beulen von Rotationsschalen
Das Beulen von dünnwandigen Schalen stellt in den meisten Fällen ein Verzweigungsproblem mit instabilem Nachbeulverhalten dar, was auf hohe Imperfektionsempfindlichkeit hinweist (siehe Abb. 1.2.7). Schwach gekrümmte Schalen unter Flächendruckbelastung (z. B. dünne Kugelkalotten unter Außendruck) oder dünne Schalen unter konzentrierten transversalen Lasten können auch durchschlagen. Im Folgenden wird – aus Platzgründen – lediglich die axial gedrückte Kreiszylinderschale etwas näher betrachtet; weiterführende Betrachtungen zum Schalenbeulen können der Literatur, z. B. [9, 20, 21], entnommen werden.
Beulen von Kreiszylinderschalen Für die homogene, linear elastische, dünnwandige, axial gedrückte (axiale Membrandruckkraft Nxx) belastete Kreiszylinderschale kann eine theoretische (d. h. perfekte Geometrie und Lasteinleitung, linear elastisches, isotropes, homogenes Material vorausgesetzt), „klassische“ Beulspannung über die aus den Donnel’schen Gleichungen (siehe [16]) gewonnene Differentialgleichung
(1.2.24)
Abb. 1.2.17 Diagramm zur Bestimmung des Beulfaktors k zum Beulen von Zylinderschalen unter axialer Druckbelastung. Die Beulfiguren für verschiedene Geometrieparameter sind dargestellt.
(1.2.25)
mit gewonnen werden. Tiefergehende Stabilitätsanalysen, wie sie in [22] dargestellt sind, zeigen, dass Gl. (1.2.25) mit einem Beulfaktor k, der von den geometrischen Verhältnissen (R/l und t/R) gemäß dem in der Abb. 1.2.17 dargestellten Girlandendiagramm abhängt, auch für die relevanteren nicht-axialsymmetrischen Beulformen zur Berechnung der theoretischen Beulspannung herangezogen werden kann.
Es ist unbedingt zu beachten, dass bei radial verschieblichen bzw. freien Rändern die kritische Axiallast deutlich absinken kann; siehe dazu auch [21]. Wesentlich erweiterte Betrachtungsweisen unter Miteinbeziehung der nichtlinearen Beultheorie sind z. B. in [9] dargestellt.
Im Girlandendiagramm (Abb. 1.2.17) ist eine Einteilung in kurze, mittellange und lange Zylinderschalen erkennbar. Diese Zuordnung wird in Regelwerken über geometrische Parameter festgelegt; vgl. z. B. [23, 24].
(1.2.26)
berechnet, obgleich dies – insbesondere für größere -Werte – eine Näherung darstellt (wie man aus Abb. 1.2.17 erkennt).
Abb. 1.2.18 Reduktion der praktischen gegenüber der theoretischen Beulspannung aufgrund von Imperfektionen (und Rand-Biegestörungen).
Dünnwandige Schalen, und so auch die hier behandelten Zylinderschalen, sind wegen des instabilen Nachbeulverhaltens sehr imperfektionsempfindlich. Aus diesem Grund (und wegen der Rand-Biegestörungen) liegt in der Realität ein Durchschlagsproblem vor, und die praktischen Beulspannungswerte, σ*pr, sind deutlich geringer als die theoretischen, σ*th (Abb. 1.2.18).
Dieser Umstand wird durch die Einführung eines Abminderungsfaktors αA berücksichtigt, der je nach Auslegungsvorschrift und Qualitätsmaßstäben zu ermitteln ist (vgl. z. B. [21, 23]):
(1.2.27)
Da das elastische Beulen mittellanger Zylinderschalen ein eher lokales Phänomen ist, wird es auch durch den lokalen Spannungszustand bestimmt. Demgemäß kann das Beulen solcher Schalen zufolge der maximalen axialen Druckspannung bei globaler Biegung (die evtl. einer Axialbelastung überlagert ist) mit obigen Formeln untersucht werden.
Ein innerer Überdruck pi hat bei elastischem Axiallastbeulen – vorwiegend durch das Glätten von geometrischen Imperfektionen – eine stabilisierende Wirkung [24]; allerdings kann ein zu hoher Innendruck auch wegen der dadurch verursachten Umfangs-Zugspannungen, welche das Plastizieren begünstigen, destabilisierend wirken! Nähere Betrachtungen dazu sind in [21] zu finden.
Generell ist auch beim Schalenbeulen zu beachten, dass die obigen Beulformeln nur angewendet werden dürfen, wenn der berechnete beulkritische Spannungszustand ausreichend weit entfernt vom Überschreiten der Streckgrenze ist. Dabei ist zu bedenken, dass wegen der Rand-Biegestörungen nicht allein der Membranspannungszustand für den Plastizierungsbeginn maßgeblich ist. Dazu sind der Fachliteratur Angaben für die Grenzen der Anwendbarkeit der Beziehungen für elastisches Beulen und Methoden zur Behandlung des elasto-plastischen Beulens zu entnehmen, siehe z. B. [24].
Für das elastische Beulen axial gedrückter kurzer Kreiszylinderschalen ist sowohl auf Schalen- als auch auf Plattenbeulen zu prüfen: Es wird zunächst so vorgegangen wie bei der Ermittlung der kritischen Spannung für mittellange Zylinderschalen. Allerdings muss aber auch berücksichtigt werden, dass das Schalenbeulen beikurzen Zylindern mehr und mehr in das Beulen gekrümmter Platten übergeht; Genaueres siehe z. B. [9].
Die maßgebliche kritische Spannung ist dann die größere der beiden so ermittelten kritischen Spannungen.
Bei langen Zylinderschalen geht das Beulen mehr und mehr in das globale Knicken der Zylinderschale als rohrförmiger Stab über, und es ist für das elastische Beulen sowohl auf Schalenbeulen für lange Zylinder, z. B. mittels
(1.2.28)
als auch auf Stabknicken mit den Knickformeln des Stabs (mit kreisringförmigem Querschnitt), siehe Gl. (1.2.17), zu untersuchen. Hier ist nun der kleinere der beiden kritischen Axiallastwerte maßgeblich.
Außendruckbelastete, tordierte, auf Schub und kombiniert beanspruchte Zylinderschalen werden hier nicht behandelt; dazu sei auf die einschlägige Literatur verwiesen (siehe z. B. [9, 20, 21]). Dort finden sich auch Informationen zum Beulen von anderen Rotationsschalen sowie von versteiften und orthotropen Schalen.





























