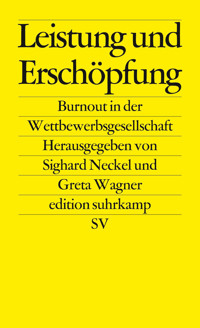
Leistung und Erschöpfung E-Book
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Burnout ist ein Modethema, selbst »Burnout ist ein Modethema«-Artikel sind inzwischen in Mode. Dennoch wirft Burnout wichtige zeitdiagnostische Fragen auf, mit denen sich renommierte Sozialwissenschaftler wie Ulrich Bröckling, Rolf Haubl, Sighard Neckel und G. Günter Voß in diesem Band befassen: In welchem Zusammenhang stehen der Wandel der Arbeitswelt und kollektive Erschöpfung? Ist Burnout eine »erfundene« Krankheit? Welche Rolle spielen Prominente, die sich »geoutet« haben? Und warum findet gerade das Bild des leeren Akkus solche Resonanz?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Burnout ist ein Modethema, selbst »Burnout ist ein Modethema«-Artikel sind inzwischen in Mode. Dennoch wirft Burnout wichtige zeitdiagnostische Fragen auf, mit denen sich renommierte Sozialwissenschaftler in diesem Band befassen: In welchem Zusammenhang stehen der Wandel der Arbeitswelt und kollektive Erschöpfung? Ist Burnout eine »erfundene« Krankheit? Welche Rolle spielen Prominente, die sich »geoutet« haben? Und warum findet gerade das Bild des leeren Akkus solche Resonanz?
Sighard Neckel ist Professor für Soziologie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Zuletzt publizierte er in der edition suhrkamp zusammen mit Claudia Honegger und Chantal Magnin den Band Strukturierte Verantwortungslosigkeit
Leistung und Erschöpfung
Burnout in der Wettbewerbsgesellschaft
Herausgegeben von Sighard Neckel
und Greta Wagner
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2013
Originalausgabe
© Suhrkamp Verlag Berlin 2013
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung,
des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung
durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form
(durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren)
ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert
oder unter Verwendung elektronischer Systeme
verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Satz: Hümmer GmbH, Waldbüttelbrunn
Umschlag gestaltet nach einem Konzept
von Willy Fleckhaus: Rolf Staudt
eISBN 978-3-518-73134-5
www.suhrkamp.de
Inhalt
SIGHARD NECKEL UND GRETA WAGNER
Einleitung: Leistung und Erschöpfung
I. Burnout als Pathologie
G. GÜNTER VOSS UND CORNELIA WEISS
Burnout und Depression – Leiterkrankungen des subjektivierten Kapitalismus oder: Woran leidet der Arbeitskraftunternehmer?
ELIN THUNMAN
Burnout als sozialpathologisches Phänomen der Selbstverwirklichung
MONICA TITTON
Erschöpfte Prominenz
II. Burnout als Diagnose
PATRICK KURY
Von der Neurasthenie zum Burnout – eine kurze Geschichte von Belastung und Anpassung
LINDA V. HEINEMANN UND TORSTEN HEINEMANN
Die Etablierung einer Krankheit? Wie Burnout in den modernen Lebenswissenschaften untersucht wird
FRIEDER VOGELMANN
Eine erfundene Krankheit? Zur Politik der Nichtexistenz
III. Burnout als Metapher
ROLF HAUBL
Burnout – Diskurs und Metaphorik
ULRICH BRÖCKLING
Der Mensch als Akku, die Welt als Hamsterrad Konturen einer Zeitkrankheit
IV. Burnout als Innovation
SIGHARD NECKEL UND GRETA WAGNER
Erschöpfung als »schöpferische Zerstörung« Burnout und gesellschaftlicher Wandel
SIGHARD NECKEL UND GRETA WAGNER
Einleitung: Leistung und Erschöpfung
In den letzten Jahren fand in Deutschland eine öffentliche Auseinandersetzung mit dem Phänomen »Burnout« statt, in der das Ausbrennen der Leistungsgesellschaft und die Beobachtung einer grassierenden Erschöpfung zum medienwirksamen Thema wurden. Kaum eine Zeitschrift, die Burnout nicht als Aufmacher hatte, kaum ein Fernsehmagazin, das darüber nicht berichtet hätte. Schon bald jedoch nahm die Debatte eine Wende, und es erschienen Artikel, die das Erschöpfungssyndrom wahlweise als Medienblase abtaten und den hierzu schreibenden Journalisten das wahre Burnout bescheinigten, Burnout als Ausdruck reiner Larmoyanz beschrieben oder als Modekrankheit entlarvten. Die Vorhaltung, Burnout sei eine pathologische Mode, zielt auf die mangelnde anthropologische Konstanz des Syndroms ab und darauf, dass sich recht unterschiedliche Beschwernisse mit ihm verbinden. Genau diese Unbestimmtheit und Zeitgebundenheit jedoch ist es, die Burnout zu einem besonders lohnenden Gegenstand soziologischer Gegenwartsanalyse macht. Mithilfe des Burnout-Syndroms wird offenbar ein Unbehagen am Leistungsdruck im heutigen Berufsleben, an der Beschleunigung von Arbeit und Kommunikation, an alltäglicher Überforderung und neu empfundenen Formen von Entfremdung artikuliert, die den persönlichen Zumutungen einer entfesselten Wettbewerbsgesellschaft den Rang einer öffentlich debattierten Pathologie verleihen.
Viel ist über die Ätiologie, über die individuellen Präventionsstrategien und Behandlungsmöglichkeiten von Burnout geschrieben worden. Wege zur Stärkung der Resilienz und zur wirksamen therapeutischen Eigenbehandlung sind gefragte Wissensgebiete. So hilfreich die Selbsttechniken der Erschöpfungsvermeidung auch sein mögen, so erkennbar folgen sie einer Ideologie der Eigenverantwortung, die Krankheit als Mangel an Selbstsorge und Scheitern als persönliche Schwäche deklariert. »Als würde man den Arbeitern einer Asbestfabrik empfehlen, zu Hause besser Staub zu wischen, um ihre Lungen vor Krebs zu schützen« (Minkmar 2012), richten sich die öffentlichen Empfehlungen zur Stressprophylaxe auf eine vermeintlich persönliche Misere, die ihre Ursachen ebenso in den sozialen Lebensmodellen der Gegenwart hat wie ihre Lösungen gesellschaftliche Veränderungen erforderlich machen.
Gleichwohl ist zur Vorbeugung und Therapie von Burnout inzwischen ein neuer Markt entstanden, auf dem mithilfe der blühenden Ratgeberliteratur ein präventives Verhaltensregime angepriesen wird. Auffallend ist dabei vor allem die Symbolik des Burnout-Begriffs. Obgleich sich Burnout-Symptome klinisch nicht wesentlich von denen einer Depression unterscheiden, scheint die Popularität des Burnout nicht zuletzt damit erklärbar zu sein, dass sich seine Diagnose als »eine Art Verwundetenabzeichen« (Schmidbauer 2012, S. 159) der Leistungsgesellschaft tragen lässt. Wer ausgebrannt ist, muss zuvor für etwas gebrannt haben, was die Erkrankung vom Stigma des individuellen Versagens befreit. Wo Märkte immer weitere Möglichkeiten des Wachstums erschließen, die Person umfassend ökonomisch in Wert gesetzt werden muss und die Konkurrenz um die an der subjektiven Lebensführung zerrt, da erscheint der Erschöpfte als leidender Antiheld einer Erfolgskultur, deren alleiniges Maß der eigene Vorrang im Wettbewerb ist.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























