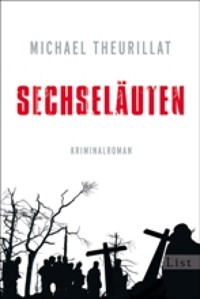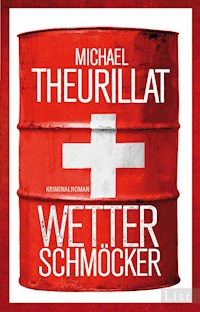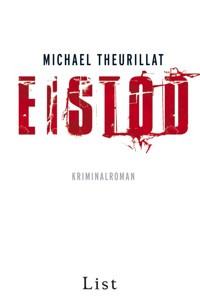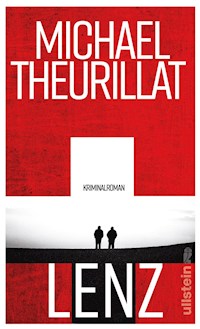
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
»Michael Theurillat beherrscht die hohe Kunst des Kriminalromans wie kaum ein Zweiter.« Berner Zeitung Lenz ist ein großartiger universeller Kriminalroman über das drängendste Thema unserer Zeit: den Terrorismus. Kommissar Eschenbach gerät zwischen die Fronten und kämpft für die Wahrheit in einer Welt aus dubiosen Hintermännern, falschen Fährten und hochgefährlichen Verdächtigungen. Als Kommissar Eschenbach aus seiner Auszeit zurückkehrt, ist die Welt eine andere. Tochter Kathrin ist bei ihm ausgezogen, seine Vertretung - die kühle, distanzierte Ivy Köhler - bleibt im Dezernat und sagt ihm den Kampf an. Der größte Schock ist jedoch, dass sein alter Freund und Kollege Ewald Lenz verschwunden ist - und unter Terrorverdacht steht. Lenz soll mit seinem enormen Insiderwissen und seinen technischen Fähigkeiten die Seiten gewechselt haben. Ivy Köhler hat ihn geradezu zum Abschuss freigegeben. Da wird ein Toter in Zürich gefunden, Walter Habicht, 62, soll aus Einsamkeit Selbstmord begangen haben. Doch der Kommissar glaubt nicht daran und beginnt sich mit dem Toten fast obsessiv zu beschäftigen, ist er doch im selben Alter wie er. Als Eschenbach ein rares Goldstück aus der Wohnung des Toten ihn Ivy Köhlers Schreibtisch findet, stellt er sich gegen das Dezernat und ermittelt auf eigene Faust.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Lenz
Der Autor
Michael Theurillat, geboren 1961 in Basel, studierte Wirtschaftswissenschaften, Kunstgeschichte und Geschichte und arbeitete jahrelang erfolgreich im Bankgeschäft. Die Romane mit Kommissar Eschenbach sind eine der beliebtesten Krimiserien der Schweiz. 2012 wurde Rütlischwur mit dem Friedrich-Glauser-Preis ausgezeichnet. Michael Theurillat lebt mit seiner Familie in der Nähe von Zürich.
Das Buch
Als Kommissar Eschenbach aus seiner Auszeit zurückkehrt, ist die Welt eine andere. Nach drei Monaten in den USA ist er nicht mehr derselbe. Oder doch? Auch in Zürich ist vieles anders: Tochter Kathrin ist aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen und seine Stellvertreterin – die kühle Ivy Köhler – spielt nicht mit offenen Karten. Eschenbach nimmt die Herausforderung in aller Gelassenheit an. Er rollt einen Fall neu auf, der kurz vor dem Abschluss steht. Bald schon merkt er, dass er geschnitten wird, weil sein Freund Lenz zu den Verdächtigen gehört. Eschenbach muss sich entscheiden – und ermittelt gegen alle Widerstände. Er ahnt nicht, dass dieser Fall weit über die Grenzen der Schweiz hinausreicht.
Michael Theurillat
Lenz
Kriminalroman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
© 2018 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: Cornelia Niere, München Umschlagmotiv:Artwork/Cornelia Niere, Zwei Männer: plainpicture/Millennium/Anthony Hatley Autorenfoto: Christian LichtenbergE-Book-Konvertierung powered by pepyrus.com
ISBN 978-3-8437-1848-6
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
1Alfred Nobel zum Dritten
2Nur einen Gefallen
3Wieder zurück
4Beginn einer Reise
5Ein Blick in die Runde
6Plan B
7Royal Flush
8Was heißt schon der Alte?
9Syrien
10Laut und deutlich
11Twenty Dollars
12Der Flug der Libelle
13Weltuntergang und ein Befehl von oben
14Habicht, Walter
15Es ist nur Gold
16Liberty und andere Göttinnen
17Der Tod und das Gas
18In Teufels Küche
19Rebel Without a Cause
20Eins und eins
21An was denkst du?
22Strohhalme
23Au clair de la lune
24Ein Freund, ein lieber Freund
25Herr: Es ist Zeit
Epilog
Dank
Bemerkungen des Autors
Quellen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Widmung
Für Alexandra
Motto
Sie lachen mich aus, weil ich anders bin.Ich lache über sie, weil sie alle gleich sind.
Heath Ledger
3Wieder zurück
ZÜRICH, MONTAG, 6. AUGUST – 09:15 UHR
Kommissar Eschenbach hatte sich seine Rückkehr anders vorgestellt.
Nicht dass er einen roten Teppich erwartet hätte, das nicht. Öffentliche Empfänge waren ihm ein Gräuel. Auf Blaskapellen (auch die der Polizei) reagierte er allergisch. Einfach nur ruhig und beschaulich, das wäre schon gut gewesen. Noch einmal richtig ausschlafen, ein gemütliches Frühstück bei Sprüngli und ein anschließender Morgenspaziergang ins Büro. Das hätte ihm gepasst, und eigentlich wäre es auch mehr als recht gewesen, nach einer Auszeit von über drei Monaten.
»Sind Sie schon wach, Kommissario?«
»Es geht«, antwortete er und sah auf das Display seines Handys. Null-Neun-Fünfzehn stand dort, in digitalen Lettern. Aber was bedeutete das schon? AM oder PM – Tag oder Nacht?
Am Nachmittag zuvor war er in Zürich gelandet, in einem Flugzeug der Swiss, auf dem Sitz Nummer 48 in der Holzklasse. Mit halbtauben Beinen hatte er sich danach in die S2 gezwängt und war, zusammen mit einem Heer von verschwitzten rückkehrenden Urlaubern, Tagesausflüglern und jugendlichen Mitgliedern eines Fußballvereins, bis zum Hauptbahnhof gefahren. Erst in der Bahnhofstrasse, den schweren Rollkoffer vor sich herschiebend, hatte er realisiert, dass es ein wunderschöner Tag war, auch in Zürich, an diesem Sonntag Anfang August.
»Frau Köhler hat mir eigentlich verboten, Sie anzurufen«, sagte Rosa Mazzoleni zögerlich am Telefon. »Aber jetzt sage ich zuerst einmal: Herzlich willkommen zu Hause.«
»Danke.«
»Weil … also.« Rosa räusperte sich. »Frau Köhler hat gemeint, die Sache sei so sonnenklar, dass Claudio sie nun zügig abschließen solle.«
»Welche Sache?«
»Die am Kreuzplatz …« Rosa zögerte einen Moment. »Ich habe es Ihnen doch geschrieben.«
»Geschrieben?«
»Per E-Mail.«
Eschenbach schwang seine Beine aus dem Bett und stand auf. »Ich bin erst gestern gelandet«, grummelte er.
»Gestern?«
»Aus Los Angeles, Frau Mazzoleni …«
»Das weiß ich doch«, unterbrach sie ihn. »Aber wir dachten, Sie wären schon seit Donnerstag wieder hier?«
»Dann hätte ich mich doch gemeldet.«
Eine Pause entstand.
Der Kommissar ging ins Wohnzimmer, zog die Vorhänge auf und blinzelte. Eine strahlende Augustsonne wärmte sein Gesicht. Was für ein herrlicher Morgen, dachte er und fuhr sich mit der Hand durchs dunkle Haar. »Es tut mir leid, Frau Mazzoleni. Blöd, saublöd … ich hätte kurz anrufen sollen. Ich habe meinen Rückflug auf Sonntag verschoben. Also auf gestern. Weil Kathrins Studienprogramm an der UCLA, also sie hatte noch ihre Prämierung.«
»Ach so.«
»In Los Angeles.«
»Ja.«
»Sie hat übrigens mit First Grade bestanden. Und jetzt macht sie noch ein paar Wochen Ferien mit zwei ihrer Kommilitonen.«
»First Grade …«, sagte Rosa leise. »Das ist gut, nehme ich an.«
»Sehr gut.«
»Prima.«
»Ja.«
Wieder entstand eine Pause. Und weil Eschenbach inzwischen wach war und seine Sekretärin nur zu gut kannte, ahnte er, dass es im Präsidium alles andere als prima lief. »Ist es schlimm?«, fragte er.
»Was?«
»Wie’s so läuft, meine ich.«
»Hier?«
»Wo denn sonst, Frau Mazzoleni.«
»Machen Sie sich selbst ein Bild«, sagte sie halblaut. »First Grade jedenfalls ist es nicht.«
»Und am Kreuzplatz«, hakte der Kommissar nach, »was ist dort?«
»Sie haben einen Toten gefunden … und wie ich Ihnen geschrieben habe – egal.« Rosa seufzte. »Ein alter Mann ist es, auf jeden Fall. Der ist beziehungsweise war schon ein paar Tage dort gelegen. Suizid … mein Gott, ich schreibe Ihnen eine ausführ-liche E-Mail, und jetzt muss ich das alles noch mal erzählen.«
»Ich schaue mir die Sache an«, sagte Eschenbach. Er hatte die Tür zur Terrasse geöffnet und trat in Unterhosen und mit einem weißen T‑Shirt bekleidet ins Freie. »War es eigentlich die ganze Zeit so schön hier?«
»Wie meinen Sie das jetzt?«
»Schon morgens über zwanzig Grad … ein Hammerwetter!«
»Ach, das.«
Eschenbach winkte einer Nachbarin zu, die schräg gegenüber auf ihrem Balkon Wäsche abnahm.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.
Prolog
»Mein lieber Freund,
ich weiß nicht, wohin man kommt, wenn man tot ist. Auch als Biologe ist mir das immer ein Rätsel geblieben. Was ich aber weiß, ist, dass mir die Diskussionen mit dir fehlen werden. Wir haben uns immer verstanden. Ist dir das auch aufgefallen? Ich glaube, es liegt daran, dass wir beide anders sind.
Wenn ich am Pausenhof einer Schule vorbeigehe, was heute selten mehr vorkommt, schaue ich, ob irgendwo ein Kind alleine herumsteht. Ich finde immer eines. Abseits verdrückt es eine Banane oder ein Sandwichbrot und gehört nicht dazu. Warum? Ich bleibe stehen und beobachte, was passiert. Manchmal kommt ein Lehrer, erkennt die Situation und kümmert sich um den Solitär. Er spricht mit dem Kind und führt es zu einer Gruppe Schüler, die ausgelassen und fröhlich miteinander spielen. Das Kind lächelt den Lehrer dankbar an und freut sich. Innerlich schließe ich dann eine Wette mit mir selbst ab, dass der Versuch scheitern wird, dass am nächsten Tag alles wieder beim Alten ist.
Es gibt Leute, zu denen geht man nicht hin, wenn sie alleine an einem Tisch sitzen. Insbesondere dann nicht, wenn man ihnen schon von Weitem ansieht, dass sie anders sind. Es ist ein interessantes Phänomen, das ich seit meiner Kindheit beobachte. Menschen sind nicht wie Magnete, deren unterschiedliche Pole sich anziehen. Bei uns ist es umgekehrt: gleich und gleich. Seit einigen Jahren hat sich diese Tendenz verstärkt, denke ich. Was vordergründig als Toleranz und Offenheit daherkommt, mit Homo-Ehe, Multikulti-Verständnis und einer ausufernden Gender-Diskussion, ist in Wirklichkeit nur eine brüchige Tapete von Lippenbekenntnissen. Das Andersartige bleibt fremd – und es wird zunehmend fremder. Und wenn es stört, versucht man es leise loszuwerden. Die heutige Gesellschaft ist wieder dazu übergegangen, anders Denkende auszuschließen. Der Mainstream setzt sich durch, und das hat verheerende Folgen.
Wer von der Herde ausgestoßen wird, ist leichte Beute. Bei den Tieren ist das gut zu beobachten; sie werden gerissen und sterben, als Opfer eines Kollektivs, das bemüht ist, seine Stärke nicht preiszugeben. Bei der menschlichen Spezies funktioniert dieser Aussonderungsmechanismus anders. Wir sind zivilisiert, die Ausgestoßenen überleben. Verletzt und gekränkt verschwinden sie in Verstecken jenseits gesellschaftlicher Kontrollen. Einige von ihnen kommen wieder an die Oberfläche, landen in den einschlägigen Karteien der Polizei – oder sie werden tot gefunden, irgendwo an einem dunklen Ort, mit einer Überdosis Crystal Meth oder einer Kugel im Kopf.
Das ist schrecklich.
Richtig gefährlich ist es allerdings deshalb, weil die meisten von ihnen nirgends mehr auszumachen sind. Sie scheinen wie vom Erdball verschwunden zu sein. Bis sie es in die Schlagzeilen schaffen, eine Kalaschnikow in der Hand, oder sie rasen, verrückt geworden durch den Schmerz und den Hass, den ihre einsamen Seelen hervorgebracht haben, mit einem Lastwagen durch eine Fußgängerzone.
Das ist es, was uns wirklich Sorgen bereiten sollte. Der Verrat ihrer Sippe lässt sie zum Spielball radikaler Strömungen werden.
Schlafende Hunde unserer Zeit.
Ich denke oft daran, wie wir uns zum ersten Mal begegnet sind.
Geht es dir auch so, dass die Erinnerung mit zunehmendem Alter an Klarheit gewinnt? Schwierig zu sagen, weshalb das so ist. Viele sagen, es habe mit der Distanz zu tun, die man über die Jahre gewinnt. Manche sagen, es sei die Erfahrung. Vielleicht ist es auch nur selektives Vergessen. Das hieße aber, dass wir einer Täuschung aufsitzen. Die Dinge erscheinen uns einfacher, als sie wirklich sind. Das mögen wir. Einfache und klare Zusammenhänge, die wir ohne Weiteres verstehen können. Rasch gewöhnen wir uns daran. Wenn wir uns die Fernsehnachrichten ansehen oder die Zeitung lesen, treffen wir eine entsprechende Auswahl: Wir glauben das, was sich mühelos in unser Weltbild fügt. Immer mehr vom Gleichen kommt hinzu, und wir sehen uns bestätigt in unserer Gedankenwelt.
Aber ist es wirklich meine Welt, oder hat sie jemand anders für mich zusammengestellt? Mein Online-Buchladen kennt mich, er trifft für mich eine Vorauswahl. Er spricht Empfehlungen aus in der Hoffnung, dass ich die Bücher kaufe. Mit dem Internet ist mein Konsum-, Lese- und Wahlverhalten öffentlich geworden. Mein Denkverhalten auch.
Wer kennt mich besser als ich mich selbst?
Vereinfachungen machen die Dinge aber nicht richtiger oder wahrer. Komplexität hat seinen Reiz, als Biologen können wir ein Lied davon singen. Das Pflanzen- und Tierreich hat über Äonen diffizile Strukturen und Hierarchien aufgebaut, und die Wechselwirkungen, die sie erzeugen, sind schwer zu durchschauen. Das ist genauso beeindruckend wie problematisch. Denn die Flexibilität des Systems ist begrenzt. Geringfügige Änderungen haben fatale Folgen. Fällt die Lebensgrundlage einer Gattung weg, stirbt sie aus. So einfach ist das. Und es ist geradezu typisch für unsere Zeit, dass sich die Arten auf unserem Planeten in noch nie da gewesenem Maße dezimieren. Die Klimaforscher meinen, die Ursache zu kennen, und malen Schreckensbilder an die Wand, fordern den Menschen auf, sich zu ändern.
Hier beginnt der Schwachsinn.
Der Mensch ändert sich nicht. Warum auch? Er ist als siegreiche Spezies aus der Evolution hervorgegangen. Das ist eine erhebliche Leistung. Dass er selbst ein Egoist ist, hat ihm dabei mehr genützt als geschadet. Dessen ist er sich bewusst. Wie kein anderes Lebewesen versteht er es, sich anzupassen. Das ist sein eigentlicher Vorteil. Der Mensch kann sein Land verlassen, aber auch unliebsame Herrscher stürzen und Systeme verändern. Er kann Kriege führen und sich die Welt untertan machen. Und wenn am Ende alles zerstört ist, dann kann er zu den Sternen fliegen und das Universum erschließen. Daran glaubt er. Und er ist ein Meister darin, andere für sich einzunehmen. Das ist sein Steckenpferd. In seinem tiefsten Kern ist der Mensch ein Manipulator.
Es ist vielleicht ungewöhnlich, das zu sagen, aber es ist die Wahrheit. Und ich glaube, ich bin zu dem geworden, der ich bin, weil ich als Biologe gescheitert bin.
Informationen sind mein wahres Gebiet.«
Der Mann drückte auf den Knopf seines Diktiergeräts und legte den Apparat auf das kleine Tischchen neben sich. Ein paarmal atmete er tief durch. »Ich mache gleich weiter«, sagte er.
»Nehmen Sie sich Zeit«, sagte die Frau. Sie war Anfang vierzig, klein und kräftig, und hatte weiche Gesichtszüge. Mit einem Lächeln setzte sie sich auf die Kante des ungewöhnlich kurzen Bettes und tupfte ihm mit einem Stofftaschentuch die Schweißperlen von der Stirn.
1Alfred Nobel zum Dritten
AUKTIONSHAUS CHRISTIE’S, NEW YORK, 3. DEZEMBER – 8.34 PM
Als der Auktionator Christopher Madson jr. am Donnerstagabend den Hammer zum dritten Mal auf die kleine Metall-unterlage sausen ließ, war es für einen Moment still im Saal. Ein kurzes Raunen setzte ein, dann folgte donnernder Applaus.
Ein paar Leute erhoben sich begeistert von ihren Sitzen.
Was war geschehen?
Der anonyme Bieter, der telefonisch an der Versteigerung teilnahm, hatte sein Angebot auf vier Millionen und siebenhundertsechzigtausend Dollar erhöht. Vermutlich wäre er auch bereit gewesen, fünf Millionen zu zahlen. Aber es gab niemand anderes, der für die kleine vergoldete Medaille mit Alfred Nobels Kopf als Reliefprägung mehr bezahlen wollte.
»It’s a world record«, rief Madson sichtlich gerührt, und als sich der Lärm im Saal wieder gelegt hatte, wiederholte er ein weiteres Mal den sagenhaften Betrag. Christie’s habe mit maximal 3,5 Millionen gerechnet, gab er später in einem kurzen Interview mit der New York Times bekannt. Und es sei ein Novum in der Geschichte, denn noch nie habe ein Nobelpreisträger zu Lebzeiten seine Medaille verkauft.
Wenn jemand mit knapp neunzig Jahren die wichtigste Auszeichnung seines Lebens verkauft, wirft dies Fragen auf.
Wieso tut er das?
Natürlich gibt es verschiedene Gründe, weshalb Menschen tun, was sie tun. Zu diesem Thema wurde viel geforscht, und es wurde auch hochtrabend darüber philosophiert. Interessantes ist dabei herausgekommen: Wir tun Dinge aus innerer Überzeugung, aufgrund unseres Glaubens oder weil wir anderen helfen wollen. Das hört sich gut an. Aber die Wahrheit ist es nicht, nicht immer. Wir sind wahre Meister, wenn es darum geht, unsere wirklichen Beweggründe zu vertuschen. Wir möchten geliebt werden und besser sein, als wir eigentlich sind. Das ist es, was uns antreibt. Und vieles tun wir einzig des Geldes wegen. Das ist so unschön wie wenig überraschend.
Die wirklich schwierigen Entscheide hingegen ist der Mensch nur dann bereit zu fällen, wenn er in existenzieller Not ist. Was uns schmerzt, tun wir nicht aus freien Stücken. Es liegt nicht in unserem Naturell. Darin unterscheidet sich der Mensch nicht vom Tier.
Ewald Lenz hörte den Applaus, der durch die Muschel seines altertümlichen Telefonapparats an sein Ohr drang, schüttelte kurz den Kopf und legte auf. Er mochte das schwarze alte Ding mit der Drehscheibe, das er seit den Siebzigerjahren besaß und für verschlüsselte Anrufe speziell hatte umrüsten lassen. Innen fix und außen nix – das gefiel dem bald Siebzigjährigen, der oberhalb von Zürich eine alte Mühle bewohnte.
Nachdem er ein paarmal paffend an seiner Bruyèrepfeife gezogen und den Rauch zur Decke geblasen hatte, wählte er erneut.
»Four million and seven hundred and sixty thousand dollars«, sagte die Männerstimme am anderen Ende der Leitung. Und in nicht ganz akzentfreiem Englisch fuhr sie fort: »Ich hab’s gehört. Es ist nun doch etwas mehr geworden, als Sie gedacht haben.«
»Ja, ich weiß. Verrückt, nicht wahr?«
»Allerdings«, sagte die Stimme.
»Ist das ein Problem?« Lenz wurde plötzlich unsicher. »Ich meine, ich kann unmöglich …«
»It’s okay«, sagte der Mann und lachte. »Ihre Freundin hat mich darum gebeten. Es ist eine gute Sache. Und was Christie’s angeht, die haben eine Deckungszusage. Ich werde den Betrag heute noch überweisen.«
»Danke«, sagte Lenz. »Jetzt warten wir ein paar Tage, dann melden Sie sich mit dem Statement.«
»Wie wir es besprochen haben«, sagte der Mann. »BBC News am Samstagabend. Schauen Sie es sich doch an.«
»Werde ich«, sagte Lenz. Noch einmal bedankte er sich bei dem Mann.
»You’re welcome, Mr Lenz. Cheers.«
»Cheers.«
Der greisenhafte Mann, dem die Medaille über fünfzig Jahre lang gehört hatte, saß in der zweiten Reihe. Er hatte den Mund weit offen, als der Auktionator den Preis in die Menge rief. Seine Frau und die beiden Söhne, die ihn an diesem Abend begleitet hatten, umarmten ihn. »Paps«, sagte sein Ältester, der rechts von ihm saß und den Arm um seine Schulter gelegt hatte. »Glaub mir, es ist gut so. Du bist frei und hast keine Sorgen mehr.«
»Frei, tatsächlich?« Der alte Mann sah seinen Sohn an, seine verbitterten Gesichtszüge hellten sich für einen Moment auf, und er lächelte: »Dann sollen sie sie doch haben … Ich brauche sie nicht mehr.«
Dann versank er wieder in Schweigen. Als junger Zoologe hatte seine Aufmerksamkeit den Kleinsten der Kleinen gegolten – den Viren und Bakterien. Er verfasste eine viel beachtete Doktorarbeit über Bakteriophagen. Das war 1950. Eine erste Anerkennung als Wissenschaftler folgte in Form eines Stipendiums, das ihn ein Jahr später ans Cavendish-Laboratorium der Universität Cambridge brachte. Ein verdammt renommiertes Institut für einen, der gerade dreiundzwanzig geworden war.
Alles ging sehr schnell. Die Doppelhelix – seine Jahrhundertentdeckung – und der Nobelpreis, den er in Stockholm entgegennehmen durfte, zusammen mit seinen zwei Kollegen. Dreiunddreißig war er damals gewesen.
Über Geld hatte er nie nachgedacht. Und jetzt, da er ein Star war, erst recht nicht.
Es war ihm wichtig gewesen, unabhängig zu sein – frei in seinen Gedanken und in dem, was er sagte. Sein Ruhm, der Nobelpreis und seine Professur an der Harvard University würden ihm diese Freiheit geben, dachte er. Aber das war ein Irrtum. Das pure Gegenteil war der Fall. Seine Abhängigkeit wuchs proportional zu den Mitgliedschaften in den wissenschaftlichen Akademien und mit der Übernahme der Ämter, mit denen er sich schmückte.
Zuoberst ist die Luft dünn – und jeder Schritt führt nach unten. Darüber hatte er nie wirklich nachgedacht. Wer einmal auf den Sockel gehoben worden war, musste stillhalten, sonst fiel er. Das Time Magazine zählte ihn zu den einhundert einflussreichsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Jetzt war er nur noch ein alter Narr, den man von Weitem be-lächelte und mit dem seine früheren akademischen Freunde nichts mehr zu tun haben wollten.
»Ja, ich bin mit dem Ergebnis zufrieden«, sagte er dem Reporter der New York Times. Und bevor er sich mit seiner Familie auf den Heimweg machte, ergänzte er noch, er werde einen Teil des Betrags wohltätigen Organisationen und der Forschung zukommen lassen.
Fünf Tage nachdem bei Christie’s in New York ein anonymer Bieter die Nobelpreismedaille ersteigert hatte, saß Ewald Lenz bei Kommissar Eschenbach auf der Couch.
Weil Lenz selbst kein Fernsehgerät besaß, hatte er seinen alten Freund gefragt, ob er sich bei ihm die Abendsendung von BBC News ansehen könne.
Wann war das schon einmal vorgekommen, dass Lenz ihn, Eschenbach, besuchte? Der Kommissar freute sich. Er hatte bewusst keine Fragen gestellt, sondern etwas Käse, Bündnerfleisch und Brot aufgetischt. Lenz mochte es einfach.
Anscheinend hatte die bevorstehende Sendung mit jenen wenigen aufreibenden Tagen im Sommer zu tun, über die sie so viel gesprochen hatten. Ein Abschluss, wie Lenz gemeint hatte. Eschenbach war neugierig.
Auf dem Bildschirm erschien das Logo von BBC News. Der Sprecher, ein adretter junger Mann mit übertrieben britischem Akzent, -erklärte, dass sich im Zusammenhang mit dem Verkauf der Nobelpreismedaille von James Watson überraschend der russische Oligarch Alisher Usmanov zu Wort gemeldet hatte. Er bestätigte, dass er der anonyme Käufer der Medaille sei. »Ich war sehr betrübt, als ich hörte, dass er wegen finan-zieller Probleme seine Medaille verkaufen musste«, bekundete er. »Dass ein derart herausragender Wissenschaftler diese Medaille, die ihn für seine Entdeckung der DNA-Struktur auszeichnet, verkaufen muss, ist meiner Auffassung nach in-akzeptabel. James Watson ist einer der größten Biologen in der Geschichte der Menschheit. Diese Nobelpreismedaille gehört einzig und allein ihm. Ich werde sie ihm zurückgeben.«
Lenz und Eschenbach sahen sich schweigend an. Und jeder für sich dachte daran, wie alles mit einem Anruf angefangen hatte.
2Nur einen Gefallen
ZÜRICH, SAMSTAG, 28. JULI – 21:45 UHR
Lenz erkannte den Anrufer, die hohe, leicht metallene Stimme. Sie telefonierten regelmäßig in größeren Abständen. Trotzdem beschlich ihn ein seltsames Gefühl, denn normalerweise war er es, Lenz, der anrief, und nicht umgekehrt. »Bist du’s?«, fragte er deshalb etwas unsicher.
»Ja, warum … störe ich?«
»Nein, natürlich nicht.« Lenz ließ sich auf seiner Chaiselongue nieder und wusste nicht recht, ob er sich nun freuen sollte oder nicht. Seltenes weckte bei ihm immer eine gewisse Skepsis. Was Lenz noch mehr verwunderte, war, dass ihn der Anrufer über das normale Telefonnetz kontaktierte. Seit sie miteinander telefonierten, hatten sie eine abhörsichere End‑to-End-Verbindung benutzt.
»Ich weiß nicht, ob du dich an den Tag erinnerst, an dem wir uns das allererste Mal begegnet sind.«
»Ja, schon …«, sagte Lenz zögerlich. Obwohl er über ein geradezu fotografisches Gedächtnis verfügte, sah er die Bilder ihres ersten Zusammentreffens nur verschwommen. »Das war an der ETH und ist schon sehr lange her.«
»Es war ein Donnerstag, morgens um zehn«, sagte die Stimme am Telefon. »Wir hatten eine Freistunde. In der Mensa, ganz hinten in der Ecke, bin ich gesessen, an meinem Tisch. Ich dachte jedenfalls, es wäre meiner, weil sich bis dahin niemand zu mir gesetzt hatte. ›Störe ich?‹, hast du gefragt. Ich habe -sofort den Kopf geschüttelt. Wir haben beide gelacht. Wir haben miteinander gelacht, bevor wir richtig miteinander geredet haben. Das war im Frühling 1970.«
»Eine Ewigkeit ist das her.«
»Du sagst es.«
Eine Pause entstand.
Lenz wunderte sich. Wenn er den Mann anrief, ging es meistens um Informationen, die er, Lenz, im Zusammenhang mit kriminalpolizeilichen Ermittlungen brauchte. Der Anrufer war eine von Lenz’ Quellen. Und wie seine anderen Quellen auch, hatte Lenz sie nie offengelegt. Auch nicht gegenüber seinem Freund Kommissar Eschenbach, dem Leiter der Zürcher Kriminalpolizei.
Oft hatten Lenz und der Mann auch über gesellschafts-politische und philosophische Themen diskutiert, über Dinge, die sie beide interessierten. Manchmal hatten sie über Belangloses gesprochen. Selten zwar, aber es war vorgekommen. Nie jedoch war die Vergangenheit in ihren Gesprächen ein Thema gewesen.
»Ich möchte dich um einen Gefallen bitten«, sagte der Mann am anderen Ende der Leitung. »Du weißt ja, ich verlasse meine Wohnung nicht mehr. Ich meine, abgesehen von den Besuchen bei meinem Zahnarzt. Ich habe wirklich schlechte Zähne. Eine schlechte Milz auch, Lunge miserabel. Leber und Nieren zum Kotzen. Aber warum erzähle ich dir das überhaupt.«
Lautes Husten erklang.
»Eigentlich ist es ein Wunder, dass ich noch da bin«, fuhr die Stimme am Telefon fort. »Heute denke ich, dass mein Zahnarzt schuld daran ist. Wegen ihm muss ich mich bewegen, und das auch noch an der frischen Luft. Über eine Stunde brauche ich jedes Mal bis zu seiner Praxis an der Höschgasse, zu Fuß natürlich, und das mit meinen kurzen Beinen. Er weigert sich partout, zu mir zu kommen. Sturer Hund. Wegen seinen läppischen paar Geräten, sagt er. So ein Witz. Die paar Bohrer und Spritzen hätte ich auch noch anschaffen können. Ich habe ja auch sonst alles hier: Dialysegerät. Eine halbe Intensivstation ist es mittlerweile geworden. Du weißt ja, wie es bei mir aussieht.«
»Ja, weiß ich«, sagte Lenz. »Es geht um einen Gefallen, hast du gesagt. Also schieß los.«
Ein kurzes, helles Lachen erklang. »Ich bin heute ausschweifend und umständlich, stimmt’s? Aber ich belästige dich nicht gern, drum habe ich …«
»Hör auf«, unterbrach Lenz. »Du hast mir mehr als einen Gefallen getan.«
»Stimmt auch wieder«, erwiderte der Mann. »Meine Angestellte, Franziska, besorgt mir ja sonst alles, was ich brauche – erledigt das, wofür man selbst im Zeitalter der totalen Vernetzung noch aus dem Haus muss. Aber jetzt müssen wir hier räumen …«
»Wer sagt das?«, fuhr Lenz dazwischen. »Es ist so gut wie dein Haus. Du kannst bleiben, solange du willst.«
»Ja, klar …« Eine kurze Pause entstand. »Wir müssen nur etwas Platz schaffen, mehr nicht.«
»Die Wohnung ist riesig. Was willst du da Platz schaffen?« Lenz beschlich ein ungutes Gefühl. »Wenn du ins Krankenhaus musst … Das würdest du mir doch sagen, oder? Ich könnte dich begleiten.«
»Jetzt mach mal halblang«, meinte der Anrufer. »Ich lebe in einem Krankenhaus, muss ich dir nicht erzählen. Es geht nur um etwas Kleines. Ein Päckchen. Ich wäre froh, wenn du für mich einen Botendienst erledigen könntest.«
»Kein Problem. Wohin soll das Päckchen gehen?«
»Nach Freiburg im Breisgau«, sagte der Mann. »Meinst du, das geht?«
»Klar geht das.«
»Es ist für Isabel. Ich weiß, dass du …« Der Mann beendete den Satz nicht. »Ich wäre dir wirklich sehr dankbar.«
»Isabel?«, murmelte Lenz erstaunt.
»Ja.«
»Ich weiß nicht …« Lenz hielt einen Moment inne. »Isabel und ich haben uns eine Ewigkeit nicht mehr gesehen.«
»Über vierzig Jahre«, sagte die Stimme am Telefon.
Eine Pause entstand.
»Sag mal«, meinte Lenz. »Kaust du gerade Fingernägel oder knackt es in der Leitung?«
Beide lauschten in die Stille.
»Lass uns auf Signal wechseln«, sagte der Anrufer.
»Okay.«
Ein paar Minuten später, mit einer sicheren End‑to-End-Verschlüsselung, telefonierten sie weiter.
»Glaub mir, Isabel freut sich … Wirklich, das hat sie mir gesagt. Wir haben darüber gesprochen.«
Lenz schwieg.
»Es ist nur ein kleines Päckchen«, fuhr der Anrufer unbeirrt fort.
»Okay«, sagte Lenz leise. Nachdenklich strich er sich mit Daumen und Zeigefinger über den Schnurrbart. »Ich mach’s dir zuliebe. Wann soll ich das Päckchen abholen?«
»Du musst es nicht abholen. Franziska bringt es vorbei. Morgen um neun ist sie bei dir.«
»Das geht jetzt aber rasant.«
»So ist es«, sagte der Anrufer. »Sie wird dich genau instruieren, wie es weitergeht. Wohin du das Päckchen bringen sollst und wann. Es ist wichtig, dass du dich genau an den Zeitplan hältst.«
»Wenn du meinst.«
»Und dann ist da noch etwas.«
»Ja?«
»Ich gebe Franziska auch noch eine Kassette mit ein paar persönlichen Dingen mit. Ich wäre froh, wenn du sie für eine Weile an einem sicheren Ort verwahren könntest.«
Lenz biss sich nachdenklich auf die Unterlippe. Irgendetwas stimmte nicht. Er stand auf und ging ein paar Schritte mit dem altertümlichen schwarzen Telefonapparat. Er musste achtgeben, dass er nicht über das Kabel stolperte. »Das klingt alles ein wenig seltsam, findest du nicht? Bist du in Schwierigkeiten? Du kannst offen mit mir sprechen.«
»Ewald«, unterbrach ihn der Anrufer. Sein Tonfall war schärfer geworden. »Frag mir jetzt bitte keine Löcher in den Bauch. Tu’s einfach.«
Eine Weile sagten beide nichts.
»Okay«, willigte Lenz schließlich ein. Mit einem Seufzer ließ er sich erneut auf die Chaiselongue fallen. »Ich mach’s. Und die Sache mit der Kassette auch. Entschuldige, wenn ich ein wenig ungehalten war.«
»Kein Problem.«
»Ich werde ein hübsches Versteck dafür finden.«
»Sicher?«
»Absolut sicher.«
»Das Versteck meine ich.«
»Hab’s schon verstanden«, grummelte Lenz. »Egal, was drin ist. Man wird es frühestens bei archäologischen Ausgrabungen finden. In tausend Jahren vielleicht.«
»Zweitausend Jahre wären besser«, sagte der Mann.
Am nächsten Morgen Punkt neun klopfte es an der Wohnungstür. Lenz hatte kaum geschlafen. Lange hatte er über das seltsame Telefongespräch nachgedacht, und es hing ihm am Gemüt wie ein dunkler Schatten. In aller Frühe war er aufgestanden, hatte einen kleinen Spaziergang unternommen und etwas Kleines gefrühstückt. Seit einer Stunde sah er immer wieder ungeduldig auf seine Uhr.
»Darf ich einen Moment hereinkommen?«, fragte die Frau. Sie trug einen weißen Kittel, war klein und strotzte vor Energie. Ihr kurzes, dunkles Haar glänzte in der Morgensonne.
»Sehr gerne«, sagte er.
»Ich bin übrigens Franziska. Wir sind uns noch nie begegnet, nicht wahr?«
Lenz schüttelte den Kopf. Er führte den Besuch in die große Wohnstube, die direkt an die offene Küche grenzte und auch als Esszimmer diente. »Hier lebe ich«, sagte er mit einem Achselzucken.
»Sehr schön.« Franziska hievte die Einkaufstüte, die sie mitgebracht hatte, schwungvoll auf einen der Esstischstühle und begann sie auszupacken: Eine Metallkassette mit Vorhängeschloss kam zum Vorschein, ebenso ein weißer, luftgepolsterter Umschlag, Größe DIN-A5, wie man ihn in jeder Poststelle kaufen konnte. »Das sind die Sachen, die Herr Habicht erwähnt hat.«
»Ich seh’s«, sagte Lenz. »Das Kleine kommt mit nach Freiburg, das andere an einen sicheren Ort.«
»So, wie Sie es mit Herrn Habicht abgemacht haben«, meinte Franziska zufrieden. Sie zog als Letztes eine kleine runde Blechbüchse aus der Einkaufstüte. »Sie rauchen doch Pfeife, nicht wahr?«
»Hat er Ihnen das erzählt?«
»Sie hätten bestimmt eine Tabakdose, hat er gemeint.« Franziska hob die Büchse hoch und lächelte. »Early Morning. Das ist doch Ihre Sorte, oder?«
Lenz grinste. »Allerdings.«
»Ist es Ihnen recht, wenn ich den Tabak gleich einfülle?«
»Absolut.« Lenz deutete in die andere Ecke der Wohnstube. »Die Tabakdose ist dort drüben. Wenn Sie mögen, mache ich uns inzwischen einen Kaffee.«
»Gerne«, sagte Franziska. Sie ging zur Chaiselongue und füllte den Tabak in das hübsch verzierte Behältnis aus Holz auf dem Beistelltisch daneben. »Nun sind die Vorräte wieder auf Höchststand.«
»Sehr gut«, rief Lenz aus der Küchenecke und bedankte sich.
Beim Kaffee, den Franziska nur kurz und im Stehen trinken wollte, gab sie Lenz Walter Habichts Instruktionen weiter.
»In einer Woche geht es los«, sagte sie. »Frau Cron wartet am Sonntag um zwei Uhr im Hotel Colombi in der Lobby.«
»In einer Woche erst?«, fragte Lenz erstaunt.
»Ist das für Sie denn ein Problem?«
»Nein, das nicht …« Lenz schüttelte den Kopf. »Es hat nur so geklungen, als sei die Sache dringend. Aber wenn es nun Zeit hat, umso besser.«
»Es ist wichtig«, fuhr Franziska fort. »Heute in einer Woche also. Sie nehmen die Strecke über Bad Zurzach, fahren bis Koblenz und passieren den Zoll. Zwischen zehn und elf Uhr wird man Sie dort durchwinken. Bitte halten Sie sich genau an diesen Zeitplan. Schreiben Sie nichts auf und erzählen Sie niemandem davon.«
»Okay.«
»Soll ich Ihnen alles nochmals wiederholen?«, fragte Franziska etwas unsicher.
»Ich glaube, ich kann es mir merken«, sagte Lenz.
»Entschuldigen Sie.« Franziska griff sich an die Stirn. »Ich hätte Sie das nicht fragen sollen. Dass Sie über ein phänomenales Gedächtnis verfügen, ist auch mir zu Ohren gekommen.«
Nachdem der Besuch gegangen war, hing Lenz seinen Gedanken nach. Er hätte Franziska gerne begleitet und seinem Freund einen Besuch abgestattet. Aber die kleine stämmige Frau mit den imposanten Oberarmen war stur geblieben. »Vielleicht ein andermal«, hatte sie ihn vertröstet. Sie habe die klare Anweisung, niemanden zu ihm zu lassen.
Lenz, für jede Ablenkung dankbar, sah sich in aller Ruhe die Metallkassette an. Sie war kaum größer als ein Schuhkarton. Bis zum Anbruch der Dunkelheit ging Lenz im Geiste alle möglichen Verstecke durch, dann begab er sich in hohen Gummistiefeln mit Spitzhacke und Schaufel in den Garten und vergrub die Kassette. An einem hübschen Ort, so, wie er es versprochen hatte.
Nach getaner Arbeit schmerzten Lenz die Gelenke. Er nahm ein Bad, legte sich anschließend ins Bett und lauschte erschöpft dem Regen, der auf das Vordach prasselte. Hie und da rüttelte eine Windböe heftig an den Fensterläden. Der Himmel hatte seine Schleusen geöffnet. Lenz war es recht, denn so wurden auch die letzten Spuren, die zu dem Versteck führen könnten, für immer verwischt.
Bereits um sechs Uhr stand Lenz wieder auf und machte sich Frühstück. Entgegen den Anweisungen von Franziska entschied er sich, den edlen Spender des Tabaks noch einmal anzurufen und ihm persönlich seinen Dank auszusprechen.
»Ist nicht der Rede wert«, sagte dieser am Telefon. »Es wird dich vermutlich über die Runden bringen.«
Lenz lachte. »Das hoffe ich doch. Hast du gut geschlafen?«
»Ich schlafe nur noch stundenweise«, sagte die metallene Stimme am Telefon. »Schaue zu, wie der Tag langsam seine Stunden abstottert und die Nächte immer länger werden.«
»Hm«, machte Lenz mit einem Stück Toast im Mund.
»Hab ich dich eigentlich jemals gefragt, wie du zu dieser Stelle bei der Kantonspolizei gekommen bist?«
Lenz nahm einen Schluck Kaffee und spülte den letzten Bissen hinunter. Erneut eine der höchst seltenen Fragen zur Vergangenheit. »Betreuung des Archivs«, sagte Lenz leise und dachte daran, wie er sich damals beworben hatte. Er räusperte sich. »Das war, nachdem du in die USA gegangen warst. Ich glaube, ich war der Einzige, der sich für diese Stelle überhaupt interessiert hat.«
»Kunststück«, kam es lachend. »Untergeschoss, kein Tageslicht, keine Menschen. Nur Regale, mit staubigen Akten vollgestopft.«
»Und eine Kaffeemaschine«, sagte Lenz. »Die hatte ich allerdings selbst mitgebracht. Aber was soll’s. Für mich war es ein Glücksfall. Nur konnte ich denen das dort nicht gleich auf die Nase binden. Außerdem gab’s einen Eignungstest.«
Schallendes Gelächter am anderen Ende der Leitung. »Wann war das noch mal, Mitte der Siebziger? Die Tests damals waren großartig, finde ich. Warst du auch ein Team-player?«
»Nein«, sagte Lenz. »Was diesen Punkt angeht, war ich ehrlich. Das passte ja auch zu dem Stellenprofil. Bis auf einen einzigen Menschen hat mich niemand bei der Kantonspolizei je für mehr gehalten als für diesen verschrobenen und etwas unterbelichteten Typen im Archiv.«
»Das war Kommissar Eschenbach, oder?«
Lenz schwieg.
»Und was ist mit Rosa und Jagmetti?«
»Okay. Am Ende waren es drei«, sagte Lenz. »Drei in über vierzig Jahren.«
»Bei mir war es James Watson«, sagte der Anrufer. »Hat mich gleich Zwerg genannt. Das hat vorher noch niemand getan – außer ein paar Kindern. Aber die sagen sowieso geradeheraus, was sie denken. Ich habe mich damals gefragt, ob Watson auch ›Neger‹ zu mir gesagt hätte, wenn ich schwarz gewesen wäre.«
»Vermutlich schon«, meinte Lenz und lachte. »Gibt es eigentlich auch schwarze Zwerge?«
»Haha. Sehr lustig.«
»Warum bist du eigentlich nicht bei der Biologie geblieben?«, fragte Lenz. »Mit Watson hattest du eine Ikone der Forschung als Mentor. Du hättest Professor werden und Karriere machen können.«
»Auf Kosten der Freiheit«, sagte die Stimme. »Ich habe erlebt, was es bedeutet, wenn man Teil der akademischen Welt ist. Watson ist am Ende auch nicht glücklich geworden. Verbittert war er zum Schluss. Ich solle lieber zurück in den Zirkus, hat er mir einmal geraten – in den richtigen Zirkus. Da wäre man wenigstens frei.«
Die beiden unterhielten sich noch eine Weile. Ein paarmal versuchte Lenz den alten Geschichten auszuweichen und mehr über die gegenwärtige Situation des Mannes, den Hintergrund seiner ungewöhnlichen Bitte herauszufinden. Aber der Anrufer wich ihm geschickt aus:
»Ich werde dir später alles erzählen, keine Sorge. Ich melde mich wieder.«
»Sicher?«
»Absolut.«
»Was ich dich noch fragen wollte«, sagte Lenz langsam. »Das Päckchen, das ich Isabel bringen soll …«
»Was drin ist, meinst du?«
»Genau. Es interessiert mich.«
»Und ich habe mich schon gewundert, warum du nicht danach gefragt hast. Es sind ein paar Luxemburgerli von Sprüngli und Pentobarbital.«
»Jetzt machst du Witze, oder?«, fragte Lenz kopfschüttelnd.
»Du kannst ja nachsehen, wenn du willst.«