
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Spuk auf hoher See! Berlin 1933. Der elfjährige Zeitungsjunge Leo wandert mit seiner Familie nach Amerika aus. Auf dem Schiff lernt er Luise aus der 1. Klasse kennen, der er seinen geheimen Fund anvertraut: ein Tagebuch! Gemeinsam lesen sie darin über die Öffnung des Grabes der altägyptischen Prinzessin Amunet, bei der ein Fluch freigesetzt wurde. Prompt taucht deren Mumie an Bord auf und versetzt die Passagiere in Angst und Schrecken. Gemeinsam mit dem Schiffsjungen Wilhelm und Émile stürzen sich Leo und Luise in ein aufregendes Abenteuer, in dem Archäologie und Nazideutschland eine Rolle spielen. Hochspannender, fesselnder Kinder-Krimi vor historischer Kulisse! Die Schauplätze: Berlin, New York, das Tal der Königinnen in Ägypten und das Dampfschiff MS Columbus Atmosphärisch dicht eingefangen von der Autorin der erfolgreichen »Oskar«-Reihe Mit Illustrationen von Constanze Spengler Zu diesem Buch finden Sie Quizfragen auf antolin.de
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Alina, die mir immer großzügig ihre Geschichten schenkt und stets mit mir sucht, wenn’s mal nicht weitergeht.
Inhalt
BERLIN, 7. JUNI 1933
Vaterlandsverräter!
Dritter Hinterhof
BREMERHAVEN, 13. JUNI 1933
Abschied
An Bord der Columbus
ERSTER TAG AUF DEM MEER, 13. JUNI 1933
Liebes Tagebuch
Die Warnung des Anubis
Gewissensbisse
Der Fluch der ägyptischen Prinzessin
Klabautermänner und andere Kobolde
ZWEITER TAG AUF DEM MEER, 14. JUNI 1933
Jede Menge Seemannsgarn
Madame Margaux
Geisterbeschwörung
DRITTER TAG AUF DEM MEER, 15. JUNI 1933
Unheil bringende Fracht
Alte Bekanntschaften
Mrs Greenbush
Jagd nach der Mumie
Geisterstunde
Nächtliche Gestalten
VIERTER TAG AUF DEM MEER, 16. JUNI 1933
Der Racheplan
Buletten-Bolle
Rächende Geister
FÜNFTER TAG AUF DEM MEER, 17. JUNI 1933
Schwimmende Ungetüme
Das Zollsiegel
Mann über Bord!
Ende gut, alles gut?
Das Kapitänsdinner
SECHSTER TAG AUF DEM MEER, 18. JUNI 1933
Letzte Hürden
Welcome to America!
Abschied von der Columbus
NEW YORK, 20. JUNI 1933
Manhattan
Wiedersehen
Wo ist Benji?
Amunets Geheimnis
Gefangen
Die Belohnung
NEW YORK, 21. JUNI 1933
Abschied
Nachwort
BERLIN, 7. JUNI 1933
Vaterlandsverräter!
»Schmuckraub im Schlossmuseum! Schmuckraub im Schlossmuseum! Diamanten im Wert von 100 000 Reichsmark gestohlen. Von den Dieben fehlt jede Spur. Hohe Belohnung für Hinweise! Lest mehr dazu! Kauft die Berliner Morgenpost!«
Leo war schon ganz heiser vom lauten Schreien. Wer als Zeitungsjunge Geld verdienen wollte, musste nicht nur gut zu Fuß sein oder jedem Wetter trotzen, sondern vor allem schreien können. Nur so machte man die Leute auf sich aufmerksam. Und natürlich gehörte auch eine ordentliche Schlagzeile dazu und die gab es heute zum Glück.
»Kauft die Berliner Morgenpost! Sensationeller Museumsraub! Lest mehr dazu! Nur zehn Pfennige.«
Seit sechs Uhr stand Leo schon am Alexanderplatz direkt neben einer Litfaßsäule. Um die Schulter hatte er einen Stoffbeutel hängen, in dem die Zeitungen lagen, auf seinem Kopf trug er die für Zeitungsverkäufer typische Schirmmütze mit einem selbst gebastelten Werbepappstreifen, auf dem »Berliner Morgenpost« stand. Ansonsten war er gekleidet wie alle Arbeiterkinder. Weil es am Alex lausig zog, hatte er einen dicken kratzigen Pullover an. Dazu eine knielange Hose und Strümpfe, die immer rutschten. Wenigstens durfte Leo während der Arbeit Schuhe tragen. In der Schule und beim Spielen musste er sie wieder ausziehen, um sie zu schonen, es sei denn, es war draußen schon zu kalt. Nur dann konnte sie seine Mutter wieder beim Trödler gegen andere gebrauchte Klamotten eintauschen.
Zumindest war das bisher so gewesen.
Vor einem Jahr hatte Leo damit begonnen, Zeitungen zu verkaufen. Damit trug er zum Unterhalt der Familie bei, die das Geld dringend brauchte. Wen scherte da das Arbeitsverbot für Kinder? Sein Vater hatte einfach das falsche Alter angegeben, ihn zwölf Jahre alt gemacht, obwohl er letzten Monat erst elf geworden war. Wieder schrie Leo: »Diamantenraub im Schlossmuseum! Lest mehr dazu!«
Noch eine halbe Stunde, dann musste er zur Schule. Wenn er Glück hatte, würde er bis dahin alle Zeitungen los sein. Wenn nicht, musste er noch einmal am Nachmittag herkommen. Dann liefen die Geschäfte aber schlechter, weil die meisten Leute die Zeitung schon gekauft hatten oder auf die neuesten Nachrichten der Abendzeitung warteten.
Aber hier am Alex war immer etwas los. Hunderte Passanten liefen an ihm vorbei, Männer und Frauen, alle hatten es eilig und drückten ihm im Vorbeihuschen einen Groschen in die Hand, um sich die Zeitung zu greifen. Die meisten waren auf dem Weg zur Arbeit, drängten zu den gelben Elektrischen, zu den Autobussen und zu den Fernzügen, die am Bahnhof haltmachten, oder hasteten die Stufen zur Untergrundbahn hinab. Der Alexander platz war der Verkehrsknotenpunkt in Berlin. Von hier aus konnte man sternförmig in alle Richtungen fahren. Riesige Leuchtreklametafeln an den Hausfassaden machten die Nacht zum Tag. Das Leben pulsierte hier rund um die Uhr. Rechts und links zweigten Straßen ab, auf deren Kopfsteinpflaster die Hufe der Pferdefuhrwägen klapperten, die modernen Autos ungeduldig hupten und die Straßenbahnen ihren festen Wegen folgten. Und über allem, unbeeindruckt vom Gewühle, fuhr die Hochbahn und hinterließ ihre Rauchschwaden. Oben in den Häusern wohnten Leute, unten gab es Geschäfte, Kolonialwaren und Feinkost, Damenkonfektionen, Friseursalons und Zigarrenläden, Obst- und Gemüsehandlungen, Gaststätten und Kaffeehäuser. An Straßenständen konnte man hübsch gebundene Blumensträuße kaufen oder sich von Schuhputzern die Schuhe auf Hochglanz polieren lassen. Und dann gab es noch die großen Kaufhäuser, deren Schaufenster nur so funkelten, und in denen man einfach alles bekam, was man sich nur wünschen konnte. Wenn man das Geld dazu hatte!
»He, Leo, wie läuft das Geschäft?«
Ein älterer Herr riss den Jungen aus seinen Gedanken. Es war Otto, der Schuhputzer, der sich eine kurze Rauchpause gönnte.
»Stell dir vor, den Stumpen hab ich von ’nem feinen Pinkel als Trinkgeld bekommen.« Otto strahlte, denn in den Genuss einer edlen Zigarre kam er selten. »Hab gehört, du stehst nur noch diese Woche hier. Dann biste weg.«
Leo nickte nur. Er wollte jetzt nicht darüber reden.
»Mein Neffe sucht ’nen guten Job. Will wie du Zeitungen verkaufen. Willste ihm nicht den Alex Ecke Tietz abgeben? Du weißt doch, wie das ist. Die Geier lauern schon darauf.«
Leo kannte die Probleme nur zu gut. Er wusste, wovon Otto sprach. Der Alex war unter den Zeitungsverkäufern heiß begehrt. Sobald Leo weg war, würde ihn sich ein anderer unter den Nagel reißen, es sei denn, er gab ihn an jemanden weiter. Selbst Leo hatte ihn von seinem großen Cousin »geerbt«.
»Klar. Er soll einfach morgen früh herkommen und mir die Woche über helfen. Dann kann er das Geschäft einfach so übernehmen. Ich bring ihm alles bei. Aber Geld kriegt er nicht dafür. Das brauch ich selbst.«
»Du hast ein gutes Herz, Leo Bermann«, erwiderte der Schuhputzer fröhlich und machte sich wieder an die Arbeit.
Leos Blick dagegen suchte den Platz nach der Konkurrenz ab. Auch andere Zeitungen wollten an den Mann gebracht werden. Manchmal gab es Probleme mit erwachsenen Zeitungsverkäufern, die ihm seinen Platz streitig machen wollten. Aber er konnte es ihnen nicht verübeln. Die Zeiten waren schlecht. Viele Leute waren arbeitslos, viele hungerten. Doch angeblich sollte es ja jetzt besser werden, zumindest für diejenigen mit der richtigen Gesinnung. Leos Blick fiel auf die roten Hakenkreuzfahnen, die seit Ende Januar an vielen Häusern hingen. Seit Hitler an der Macht ist, war das Leben für politisch Andersdenkende und Juden die Hölle. In manchen Schaufenstern hingen Schilder, auf denen stand: Deutsche! wehrt Euch! kauft nicht bei Juden! Von seinem Vater wusste Leo, dass jüdische Arztpraxen und Betriebe immer wieder geplündert und deren Besitzer verprügelt werden. Erst neulich waren in seinem Stadtviertel zahlreiche jüdische Bewohner von Nazis brutal zusammengeschlagen worden. Sogar in der Schule war es anders geworden. Leo musste seine Lehrer jetzt immer mit »Heil Hitler, Herr Lehrer!« grüßen und dabei die Hand heben. Und in den Gängen wurden von Schülern Nazilieder gegrölt, obwohl es verboten war, auf den Fluren zu singen. Aber kein Lehrer traute sich, etwas zu sagen oder es gar zu verbieten. Leos Vater machte der ganze Nazimist krank. Sie hörten zu Hause auch nur noch selten Radio, seit Hitlers Reden aus dem Lautsprecher drangen. Sein Vater wurde dann ganz rot vor Zorn und schimpfte. Seine Mutter aber hatte Angst, dass es die Nachbarn hörten und weitererzählten. Seit die Nazis an der Macht waren, durfte jeder entlassen werden, der nicht national gesinnt war. Und sein Vater war bekennender Sozialdemokrat und hatte sich geweigert, der Nazipartei beizutreten. Nun war er arbeitslos.
»Dem Herrn sei Dank, wenigstens haben sie ihn noch nicht abgeholt«, hatte Leo schon öfter seine Mutter sagen hören.
Wer ihn hätte abholen sollen, wusste er aber nicht so ganz.
»Diamantenraub im Schlossmuseum! Hohe Belohnung ausgesetzt! Lest mehr dazu!«, rief Leo den Passanten entgegen.
Von der Friedrichstraße her sah er Fritz und Paule auf sich zukommen. Sie stammten aus dem gleichen Mietshaus wie er, viertes Hinterhaus, feucht und ohne Tageslicht. Fritz und Paule waren Brüder. In die Schule gingen sie schon lange nicht mehr, doch die Arbeit lag ihnen auch nicht. Sie machten nur Ärger. Schon zweimal hatte die Polizei wegen den beiden kommen müssen.
Misstrauisch beäugte Leo die zwei.
»He, du Vaterlandsverräter!«, begrüßte ihn Paule. »Nimmst hier den ehrlichen Deutschen ihre Arbeit weg!«
»Vielleicht sollten wir ihm auch etwas wegnehmen«, schlug Fritz vor.
»Ich bin mindestens ein so guter Deutscher wie ihr«, blaffte Leo zurück.
»Ach ja? Da haben wir aber etwas anderes gehört. Die Tschierske aus der Kellerwohnung hat gesagt, dass ihr nächste Woche das Land verlasst.«
»Na und? Was geht euch das an?«, entgegnete Leo, der es inzwischen leid war, sich vor allen zu rechtfertigen. »Die Zeiten sind nun mal so. Wir sind nicht die Einzigen. Mein Vater sagt, Hitler führt uns noch alle in den Krieg.«
Paule trat nun drohend an Leo heran. »Pass auf, was du sagst, du Kommunistenschwein!«
»Lieber ein Kommunistenschwein als ein Dreckschwein.«
Kaum waren die Worte ausgesprochen, packte Paule Leo am Kragen, die rechte Faust zeigte direkt auf sein Gesicht. »Rück schon dein Geld raus, du Verräter! Deutsches Geld den Deutschen!«
Leo griff in seine Hosentasche, wo er die Einnahmen verwahrte, als neben ihm eine Gestalt in blauer Uniform auftauchte. Es war der Schutzmann, der auf dem Alex Streife ging.
»Was ist denn hier los?«, fragte er knurrend, wobei er mit seiner rechten Hand gegen den Gummiknüppel klatschte, der an seiner Seite baumelte.
Paule ließ sofort los.
»Nichts«, antwortete Fritz kleinlaut. »Nur eine kleine Meinungsverschiedenheit. Wir sind auch schon weg.«
Der Schutzmann sah Leo fragend an. »Stimmt das, mein Junge?«
Leo nickte schnell, als er Paules drohenden Blick wahrnahm.
»Na schön. Dann könnt ihr beiden ja jetzt gehen. Aber ’n bisschen plötzlich!« Er sah die älteren Jungen streng an, die daraufhin artig einen Diener machten und verschwanden. Dann tippte der Mann mit dem Zeigefinger gegen seinen Tschako, nickte Leo kurz zu und verschwand.
Leo atmete auf. Das war gerade noch mal gut gegangen. Und in zwei Wochen war er diese Idioten endgültig los. Dann würde er im Schatten der Wolkenkratzer von New York Zeitungen verkaufen. Von seinem Lehrer wusste er, dass die Zeitungsverkäufer dort paperboys genannt wurden und ihr Spitzname newsies war. Er hatte auch noch ein paar andere englische Sätze gelernt wie Thank you, Sir!, Good morning, Sir! oder Have a nice day!. Und sein Vater würde in Amerika auch wieder Arbeit haben. Ein Parteifreund von ihm, der schon vor einem Jahr ausgewandert war, hatte für ihn einen Job als Taxifahrer und eine günstige kleine Wohnung gefunden. Er übernahm auch die Bürgschaft für die Familie. Sie hatten nur noch zur amerikanischen Botschaft in Berlin gehen und den Antrag stellen müssen. Nachdem der Amtsarzt die gesamte Familie für gesund erklärt hatte, bekamen sie das begehrte Einreisevisum. Dieses Glück hatten nicht viele. Manche mussten monatelang warten und wurden dann doch abgelehnt. In seiner Klasse war Leo nicht der Einzige, der auswanderte. Vor allem Juden und politisch Andersdenkende verließen Deutschland. Die meisten gingen aber in Nachbarländer wie nach Frankreich, in die Schweiz oder die Niederlande. Über den riesigen Atlantik – so wie Leos Familie – wagten sich die wenigsten, oder sie hatten niemanden, der für sie bürgte.
Wie es sich wohl anfühlte, zu den Wolkenkratzern hinaufzusehen? Das höchste Gebäude, das er kannte, war der Funkturm. Aber das Empire State Building war dreimal so hoch und hatte über 100 Stockwerke. Leo konnte sich das gar nicht vorstellen. Den Leuten, die darin wohnten, musste doch den ganzen Tag schwindlig sein.
Dritter Hinterhof
Nach der Schule lief Leo direkt nach Hause. Er hatte alle Zeitungen verkauft. Dafür war er zwar etwas zu spät gekommen, aber der Lehrer hatte noch mal beide Augen zugedrückt. Er wusste, dass Leos Familie das Geld für New York brauchte. Die Tickets für die Überfahrt waren teuer gewesen, auch wenn sie nur in der dritten Klasse reisen würden. Sämtliche Freunde und Verwandte hatten eine Kleinigkeit dazugegeben. Jeder, was er entbehren konnte. So hatten seine Eltern in kürzester Zeit das Unmögliche möglich gemacht. Für großes Grübeln oder gar Bauchweh war keine Zeit geblieben. Das hatte sich erst jetzt kurz vor der Abreise bemerkbar gemacht. Seine Mutter weinte nun täglich. Jeden Tag trauerte sie um eine andere Freundin oder Cousine, die sie zurücklassen musste. Wenigstens lebten ihre Eltern nicht mehr, denn dann, da war sich Leo sicher, wären sie niemals fortgegangen.
Mit dem Wissen, schon nächste Woche nicht mehr hier zu sein, sah Leo sich sein Wohnviertel auf dem Nachhauseweg viel genauer an als sonst. Nichts davon wollte er vergessen. Nicht, weil es so schön war, sondern weil alles besser werden sollte. Schmale Gassen, in denen man Angst bekam, eng stehende Häuser, an denen der Putz abblätterte, Werkstätten und Kellerläden bestimmten das Bild des Scheunenviertels. Hier lebten viel zu viele Menschen auf viel zu engem Raum. Auch Leo wohnte hier. Das Viertel zu verlassen, war das Beste, das ihm passieren konnte. In den Spelunken feierten entlassene Häftlinge aus den Zuchthäusern ihre neu gewonnene Freiheit. Wer zu wenig Geld hatte, lungerte draußen herum. Schlägervisagen unter Ballonmützen und Narbengesichter starrten ihn beim Vorbeigehen an. Das Scheunenviertel gehörte zu den verrufenen Stadtteilen Berlins, ebenso wie der Wedding, die Luisenstadt, Neukölln oder Friedrichshain. Überall gab es Mietskasernen, in denen das sogenannte Lumpenproletariat wohnte.
Leo bog in die Hofeinfahrt eines sechsstöckigen Wohnhauses ein. Aus der Schusterwerkstatt im ersten Hinterhof war gleichmäßiges Hämmern zu hören, wo gerade ein paar Schuhe wohl eine neue genagelte Sohle erhielten. Die Mülltonnen, die sich entlang der Hauswände reihten, quollen bereits über und verströmten einen säuerlich faulen Geruch, den aber keines der Kinder wahrzunehmen schien, die hier spielten. Die Mädchen sprangen Seil und ein paar kleinere Jungen schnippten Murmeln in Löcher. Der ungepflasterte Boden war ideal dafür.
Ein kahl rasierter, magerer Junge sprang sofort auf, als er Leo sah.
»Komm, spiel mit uns, Leo!«, bettelte er. »Du erzählst immer so spannende Geschichten. Hast du heute aus deiner Zeitung eine neue gehört?«
»Hallo Knutchen, ich hab leider keine Zeit. Du weißt doch, dass wir wegziehen. Da gibt es noch viel zu tun«, winkte Leo ab. »Nun mach nicht so ein trauriges Gesicht. Vielleicht habe ich ja morgen Nachmittag Zeit.« Er kitzelte den Kleinen, der quiekend davonhüpfte und Leo seines Weges gehen ließ.
Und der führte nicht ins Vorderhaus. Wer sich hier eine Wohnung leisten konnte, galt im Viertel als reich. Leo ging durch den nächsten und übernächsten Hausdurchgang. Mit jedem Hinterhof wurde es enger, stickiger und düsterer. Schließlich war er im dritten Hinterhof angekommen, der gerade mal fünf auf fünf Meter groß war und somit viel zu eng zum Spielen. Die Sonne schien auch nie herein, was sich vor allem im Haus bemerkbar machte. Drinnen war es feucht und Husten war das häufigste Geräusch hier, sommers wie winters.
Leo sprang die ausgetretene Treppe hinauf, immer zwei Stufen auf einmal. Was störten ihn jetzt noch der Schimmel an den Wänden und der Gestank der Gemeinschaftstoilette im Hof? Ende der Woche ließ er all das hinter sich.
»Na, Kumpel! Wie lief das Geschäft?«, begrüßte ihn sein Vater bestens gelaunt.
»Gut!«, antwortete Leo. »Ich hab alle Zeitungen verkauft.«
Die Wohnung bestand nur aus einem beheizbaren Raum, der zugleich Wohnstube, Küche und Schlafzimmer war. Für fünf Personen war das etwas eng, aber wenn man es nicht anders gewohnt war, konnte man es auch gemütlich nennen. Die großen Möbel, den Kleiderschrank, das Büfett, die Kommode und die Betten hatte sein Vater schon verkauft. Dunkle Schatten zeichneten sich auf der fleckigen Tapete ab, wo früher die Möbel gestanden hatten. Wichtig war nur die Nähmaschine, ein Erbstück. Damit verdiente Leos Mutter etwas Geld. Und damit das so blieb, nahmen sie sie mit nach Amerika. Alles andere würde am letzten Tag verkauft werden. Das waren die Matratzen, der Tisch, die Stühle und der Herd.
Im Zimmer stand ein Holzbottich mit noch dampfendem Wasser. Leos kleine Schwestern, Mariechen und Klärchen, gerade mal drei und vier Jahre alt, planschten darin vergnügt herum. Um den Bottich herum hatte sich schon eine große Pfütze gebildet, aber Leos Mutter lachte nur darüber.
»Du kannst gleich danach baden. Schadet dir nichts.« Zärtlich strich sie ihrem Sohn das struppige blonde Haar glatt.
»Sieh mal, was ich hier habe!«, rief sein Vater und kramte etwas aus seiner Geldbörse. »Fahrkarten nach Bremerhaven.«
Seine Begeisterung steckte alle an.
»Nun kann uns nichts mehr aufhalten, oder?«, sagte Leo strahlend und in Gedanken verkaufte er schon Zeitungen im Schatten der Wolkenkratzer.
BREMERHAVEN, 13. JUNI 1933
Abschied
Die Zugfahrt von Berlin nach Bremen war das Aufregendste gewesen, das Leo bisher erlebt hatte. Noch nie in seinem Leben war er aus Berlin hinausgekommen. Wiesen, Felder, Wälder, Dörfer und andere Städte waren an ihm vorbeigerauscht. Nicht eine Sekunde hatte er seinen Blick vom Fenster abwenden können. Erst als es draußen dunkel geworden war, fielen ihm die Augen zu.
Kurz nach Mitternacht kamen sie in Bremen an. Der Bahnhof war bereits voller Menschen, die alle auf den Sechs-Uhr-Zug nach Bremerhaven warteten, von wo aus das Schiff nach Amerika ablegte. Es war nicht leicht, einen ruhigen Platz zum Schlafen zu finden. Leo setzte sich neben seinen Vater auf ein freies Fleckchen am Boden und lehnte sich gegen dessen breite Schulter.
Um kurz vor fünf wurde er geweckt. Sein Vater musste noch zur Handelsniederlassung der Reederei Lloyd gehen, um die zurückgelegten Schifftickets für die Überfahrt abzuholen. Die Restsumme war noch zu begleichen, die Anzahlung war von Berlin aus erfolgt. Leo begleitete seinen Vater. Zum Weiterschlafen war er sowieso viel zu aufgeregt. Seine Mutter blieb mit den Geschwistern und dem Gepäck am Bahnhof zurück. Mariechen und Klärchen schliefen beide tief und fest auf den Koffern.
Punkt sechs Uhr ging es dann mit dem Zug weiter nach Bremerhaven.
Und nun stand Leo hier am Hafenbecken. Um ihn herum drängten Tausende von Menschen. Sie rempelten ihn an und machten einen Lärm, dass das Treiben auf dem Alex vergleichsweise wie ein Flüstern klang. Die Verladearbeiter brüllten Kommandos, aber von all dem nahm Leo nichts wahr. Sprachlos starrte er auf das majestätische Ungetüm aus Stahl. Es war viele Stockwerke hoch und einen ganzen Straßenzug lang. Der Rumpf, von dem nicht viel aus dem Wasser ragte, war rot, die unteren Decks mit ihren runden Bullaugen schwarz, das Haupt- und Promenadendeck mit den Aufbauten erstrahlten in einem blendenden Weiß und die beiden mächtigen Schornsteine ragten leuchtend gelb in den blauen Himmel.
Vor ihm lag die Columbus, eines der modernsten Dampfschiffe, das Deutschland zu bieten hatte.
Doch nicht jeder hatte Augen für das prachtvolle Schiff. Viele weinten und umarmten das letzte Mal ihre Angehörigen. Frauen wickelten sich fest in ihre wollenen Schultertücher ein, als hätten sie Angst, verloren zu gehen. So viel mussten sie in ihrer alten Heimat zurücklassen. Weinend flehte eine Frau ihren Mann an: »Ludwig! Nein! Noch ist Zeit. Bitte lass uns umkehren!«
Leo warf einen Blick auf seine Mutter. Auch sie rang deutlich um ihre Beherrschung. Mariechen zog ihren Bruder an der Jacke. »Du, Leo, warum weint die Frau? Hat sie Bauchweh?«
»Nein. Sie hat einfach nur Angst.«
Mariechen starrte ihn mit erschrockenen Augen an, und Leo merkte, dass die Antwort falsch war. Erwachsene durften keine Angst haben. Schnell fügte er hinzu: »Sie hat halt keinen starken Papa und großen Bruder, so wie du.«
Jetzt strahlte die Vierjährige wieder, und Leo wusste, dass er die richtigen Worte gefunden hatte.
Doch sich selbst konnte Leo nichts vormachen. Zum ersten Mal machte sich so etwas wie Panik in ihm breit. Die merkwürdige Atmosphäre um ihn herum hinterließ ihre Spuren.
Leo sah sich die Menschen genauer an. Sie schienen aus allen Teilen Europas zu stammen. Um ihn herum herrschte das reinste Sprachwirrwarr. Verschiedenste deutsche Dialekte, Jiddisch, Russisch und Polnisch waren zu hören. Einfache Arbeiterfamilien, Bauern, Juden mit Schläfenlocken und langen Bärten, feine Damen und Herren, einfach jeder war hier vertreten.
»Vater, sind die Leute hier alle Flüchtlinge?«, wollte Leo wissen.
»Nein. Die einen sind Touristen, die anderen haben ihre alte Heimat besucht und der Herr dort drüben mit der Zigarre könnte ein Geschäftsreisender sein.«
»Sind wir denn die einzigen Flüchtlinge?«, hakte Leo nach.
»Wir sind doch keine Flüchtlinge. Schau, mein Junge, diese jüdischen Familien dort hinten sind Flüchtlinge. Sie fliehen aus Nazideutschland. Sie haben keine andere Wahl. Sie müssen gehen, wenn sie wieder ein normales Leben führen wollen. Wir aber haben eine Wahl. Mitmachen, Dagegenhalten oder Gehen.«
So hatte Leo das noch nicht gesehen.
»Also gehen wir«, stellte er fest und sein Vater nickte.
»Wegen Geld?«, hakte Leo nach.
»Auch. Als Sozialdemokrat find ich so schnell keine Arbeit. Und von irgendetwas müssen wir doch leben. Außerdem ertrag ich dieses Nazipack keinen Tag länger.«
»Werden wir in Amerika reich?«
»Vom Tellerwäscher zum Millionär, was?« Leos Vater lachte. »Ich habe schon viele dieser Geschichten gehört. Das mag es ja geben, aber darauf bauen würde ich nicht. Amerika ist kein Schlaraffenland.«
»Nein?«
»Nun schau nicht so enttäuscht. Ich bin mir sicher, dass man durch Fleiß zu etwas kommen kann. Halt dich nur von Leuten fern, die nichts taugen, mach deine Arbeit und lern in der Schule, dann wird es dir eines Tages sicher besser gehen als heute.«
Leos Vater deutete mit der Hand um sich. »Sieh dir all die Menschen an. Voller Hoffnungen und Träume sind sie. Und warum auch nicht? Wer keine Träume mehr hat, der hat ausgelebt. Was willst du eines Tages werden, mein Junge?«
Leo musste nicht lange darüber nachdenken. »Journalist oder Schriftsteller«, platzte es aus ihm heraus. Sein großes Vorbild war Jack London. Seine Bücher »Wolfsblut« und »Ruf der Wildnis« hatte er verschlungen. Sein Lehrer hatte sie ihm geliehen. Zum einen weil er wusste, dass Leo gerne las, zum anderen weil Jack London auch mal Zeitungsjunge gewesen war, bevor aus ihm ein berühmter Journalist und Schriftsteller wurde.
»Also auf nach Amerika, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten!«, rief sein Vater übermütig. »Mein Sohn wird dort ein großer Schriftsteller werden.«
Beide lachten und die umstehenden Leute drehten sich irritiert nach ihnen um.
Jetzt ging es Leo wieder besser. Voller Hochgefühl sah er nun beim Verladen des Gepäcks zu. Kisten, Koffer, Proviant, sogar Autos wurden mit Kränen aufs Schiff gehievt. Und sicher war auch ihr Gepäck in einem der Lastennetze. Während er versuchte, ihre Sachen in der Luft auszumachen, riss plötzlich eines der Lastenseile. Er konnte sehen, wie das Seil sich aufdröselte und nur noch von einem Strang zusammengehalten wurde. Die Leute schrien auf und sprangen ängstlich zur Seite. Leo wurde von einem Mann mitgerissen, dann fielen Dutzende Koffer und Kisten zu Boden, die Leo nur knapp verfehlten.
Um ihn herum herrschte jetzt Chaos. Verladearbeiter und Matrosen eilten herbei und versuchten, die aufgeplatzten Koffer und Kisten so gut es ging samt verlorenem Inhalt zu bergen. Manche der Umstehenden schimpften und riefen »Schlamperei!«.
Leos Blick fiel auf einen blauen Gegenstand, der etwas abseits der verlorenen Ladung lag. In verschnörkelten goldenen Buchstaben stand darauf das Wort »Tagebuch«. War es aus einem der Koffer gefallen? Niemand schien es zu beachten. Schließlich bückte sich Leo und hob es auf.
»Gehört das Ihnen?«, fragte er eine Frau neben sich, dann noch ein paar weitere Umstehende, aber keiner der Anwesenden gab sich als Besitzer zu erkennen.
Also besah sich Leo das Buch genauer. Der Einband bestand aus blauem Leder und war an den Ecken schon etwas abgewetzt, die Goldschrift glänzte aber immer noch prächtig in der Morgensonne. Ehrfürchtig bewegte er die vergoldete Buchschließe, die aber zum Glück beschädigt war. Hoffnungsvoll schlug er das Büchlein auf. Wenn es nämlich unbeschrieben war, könnte er ja seine ersten Schreibversuche darin festhalten. Doch es war bis zur letzten Seite beschrieben.
Na, dann eben nicht, dachte Leo enttäuscht. Wenigstens hab ich für die Überfahrt etwas zum Lesen. Vielleicht steht darin ja ein Geheimnis. Geheimnisse fand Leo gut. Und so steckte er das Büchlein unter seinen Pullover. Wer weiß, welches Abenteuer zwischen den Buchdeckeln schlummerte?
An Bord der Columbus
Inzwischen hatte die Bordkapelle auf dem Promenadendeck angefangen zu spielen. Beschwingte fröhliche Musik empfing die Passagiere der ersten Klasse. Über eine Zugangsbrücke bestiegen sie das Schiff, fein gekleidet und mit stolz erhobenen Köpfen. Offenbar reisten auch ein paar Berühmtheiten mit der Columbus, was die Schar Reporter und Fotografen erklärt hätte.
Oben auf dem Schiff empfingen sie der Kapitän und sein Erster Offizier. Unter den Passagieren entdeckte Leo einige Kinder. Er beäugte sie neugierig in ihren edlen weißen Sonntagskleidern und passend sitzenden Anzügen. Und als hätte eines der Mädchen seinen Blick gespürt, drehte es sich um und streckte ihm rotzfrech die Zunge heraus. Das alles geschah so schnell, dass niemand sonst es bemerkt hatte. Sofort wandte sich das Mädchen wieder um und reichte oben angekommen dem Kapitän artig die Hand und machte einen höflichen Knicks. Dem Mädchen folgten zwei gleich aussehende Jungen, vielleicht ein oder zwei Jahre älter und offenbar Zwillinge. Beide hatten identische Anzüge an, selbstverständlich mit langen Hosenbeinen, und eine rote Schülermütze mit weißem Band und schwarzem Schirm.
Eingebildete Lackaffen!, dachte Leo sofort. Die bilden sich bestimmt was darauf ein, dass sie eine teure Oberschule besuchen.
Nachdem auch die Passagiere der zweiten Klasse an Bord waren, durften Leo und die Mitreisenden der dritten Klasse das Schiff betreten. Natürlich gab es für die vielen Menschen mehrere Zugänge, die aber alle nicht zum Hauptdeck hinaufführten, sondern zu den unteren Decks mit den kleinen Bullaugen. Am Eingang stand auch kein Kapitän, sondern nur ein Unteroffizier, der den Passagieren den Weg zu den Kabinen wies.
Leos Knie zitterten vor Aufregung, als er die Zugangsbrücke hinaufschritt. Jetzt gab es kein Zurück mehr. Ob er Berlin jemals wiedersehen würde?
Ein mulmiges Gefühl überkam ihn, als er die Columbus betrat. Es war, als würde er den dunklen Bauch eines Stahlungetüms betreten. Die Maschinen stampften bereits wie eine Herde wütender Stiere. Der Lärm von Hunderten, aufgeregt jaulenden Passagieren hallte durch die schmalen Gänge. Jeder war auf der Suche nach seiner Kabine. Leo ließ seine Eltern nicht aus den Augen. Seine Mutter hatte Mariechen fest an der Hand und sein Vater Klärchen. Manchmal drängte sich ein Fremder zwischen sie, dann konnte Leo nur noch die Mütze seines Vaters ausmachen, dessen Kopf über alle hinausragte. Zum Glück war er so groß.
Rechts und links der Gänge lagen die Kabinen. Die äußeren waren etwas teurer, denn sie hatten Bullaugen, die inneren hatten keinerlei Fenster. Am billigsten waren die im untersten fünften Deck, noch dazu im Vorschiffbereich. Hier befanden sich auch die Kabinen von Leos Familie. Warum das so war, merkte Leo, sobald er sich ihnen näherte. Unten war es nicht nur heißer und lauter, weil sie dem Maschinenraum am nächsten lagen, in der Nähe des Bugs hob und senkte sich das Schiff viel stärker als in der Mitte oder hinten. Und obwohl sie noch im Hafenbecken lagen, war der Seegang schon jetzt deutlich zu spüren.
»Zimmer 517 und 519! Hier ist unser Zuhause für die nächsten sechs Tage!«, rief Leos Vater und öffnete eine Tür.
»Die Damen sind hier untergebracht, wir Männer gleich daneben.«
Da es sich um Vierbettkabinen handelte, musste sich die Familie aufteilen. Zwar hätten Leos Schwestern gut in einem Bett schlafen können, das taten sie ja zu Hause auch, aber die Reederei bestand darauf, dass jeder zahlende Passagier auch ein eigenes Bett bekam. Also teilten sich Leos Mutter und seine Schwestern die Kabine mit einer fremden Frau, während er und sein Vater mit zwei fremden Männern vorliebnehmen mussten. Leo hoffte inständig, dass sie keine Schnarcher waren oder stinkende Füße hatten.
Noch war keiner der Zimmergenossen eingetroffen. Leo und sein Vater konnten sich also die Betten aussuchen. Es waren zwei schmale Stockbetten mit blauen Vorhängen zum Zuziehen. Am Kopfende stand ein Waschschrank mit Porzellanschüssel, am Fußende rechts und links ein Kleiderschrank. Leo besetzte einfach das rechte obere Stockbett.
Nach der langen Zugfahrt und der Nacht auf dem Bahnhof tat es gut, sich auszustrecken. Leo schloss die Augen. Das sanfte Auf und Ab des Schiffes war spürbar, ebenso ein eigenartiges Kribbeln im Bauch. Das gleichmäßige Stampfen der Maschinen lullte ihn schnell ein.
Vermutlich waren nur fünf Minuten vergangen, als ihn eine fröhliche Stimme aus dem Schlaf riss. Leo öffnete verwirrt die Augen. Zuerst wusste er überhaupt nicht wo er war, dann fiel es ihm allmählich wieder ein.
Er setzte sich auf und blickte in die schwarzen Augen eines gleichaltrigen Jungen. Seine Locken waren dunkel wie die Nacht.
»Hallo!«, sprach ihn der Junge vergnügt an. »Ich bin Émile. Und du?«
»Leo«, antwortete er kurz angebunden. Irgendwie hatte er gerade auf Gesellschaft keine Lust. Stattdessen sprang Leo vom Bett herunter. »Ich seh mich mal um«, sagte er nur und verschwand aus der Kabine.
Leo wusste, dass er unhöflich gewesen war, aber er wollte jetzt lieber allein sein. Der Grund dafür war das Tagebuch unter seinem Pullover. Das Geheimnis, das sich darin vielleicht verbarg, wollte er vorerst mit niemandem teilen. Émile konnte er später immer noch kennenlernen.
Da es im Schiffsinneren so stickig war, wollte Leo an die frische Luft. Nach einigem Herumirren und vielen engen Treppen aufwärts fand er schließlich das Sonnendeck für die Passagiere der dritten Klasse. Es war vorne am Bug des Schiffes, nur halb so groß wie das der ersten und zweiten Klasse und den Wellen und deren Gischt bei starkem Seegang gnadenlos ausgesetzt.
Ein Wald aus schwarzen Lüftungsröhren und gelben Masten mit stählernen Tauen bestimmten das Bild. Dazwischen drängten sich Hunderte Reisende. Die meisten zog es an die Reling, um einen letzten Blick Richtung alte Heimat zu werfen. Vom Promenadendeck der ersten Klasse ertönte die Musik der Bordkapelle. Sie spielten »Muss i denn zum Städtele hinaus«.
Leo verschaffte sich einen Platz am Geländer und sah nach unten. Die Columbus war so riesig, dass die Leute, die unten am Kai standen, wie Ameisen wirkten. Zum Abschied winkten sich alle gegenseitig mit weißen Taschentüchern zu. Und wieder weinten die Frauen. Dann setzte der laute durchdringende Ton des Schiffshorns ein. Es war das Zeichen, dass alle, die nicht mit nach Amerika wollten, das Schiff verlassen mussten. Nun lösten die Matrosen die Schiffstaue und zogen die Zugangsbrücken ein. Die Columbus setzte sich langsam in Bewegung, umkreist von gefräßig kreischenden Möwen.
Leo stand stundenlang an der Reling. Sie fuhren an einem rotweiß gestrichenen Leuchtturm vorbei und an einem Fort, dessen Türme zur Verteidigung der Küstenlinie aus dem Wasser emporragten. Dicke schwarze Rauchwolken stiegen aus den beiden mächtigen Kaminen. Die Columbus hatte volle Fahrt aufgenommen. In einem weiten Bogen fuhr das Schiff auf die Nordsee hinaus. Irgendwann lagen in der Ferne die Inseln Norderney, Juist und Borkum und dahinter die Küste Holsteins. Leo sah viele andere Schiffe, kleine schwarze Kohlendampfer, Frachtschiffe, Segelboote, Fisch- und Krabbenkutter. Stolz und lautlos glitt ein großes Segelschiff vorüber. Leo zählte 22 Segel, blendend weiß, an drei Masten aufgereiht. Am meisten aber faszinierte ihn die unendliche Weite. In der dicht bebauten Großstadt Berlin mit seinen Millionen Menschen kannte er das gar nicht. Er wusste noch nicht mal, dass ein Mensch so weit schauen konnte. Nichts als Himmel und Wasser. Und nicht zu vergessen der allgegenwärtige Wind. Leo hielt seine Schirmmütze fest umklammert und ließ sich die salzige Luft ins Gesicht wehen.
ERSTER TAG AUF DEM MEER, 13. JUNI 1933
Liebes Tagebuch
Vor lauter Begeisterung hatte Leo das Tagebuch ganz vergessen. Erst als er sich am Meer sattgesehen hatte, machte er sich auf die Suche nach einem ruhigen Plätzchen. An Deck hatten sich inzwischen Grüppchen gebildet. Die einen spielten Karten, die anderen würfelten. Ganz vorne hatten zwei Männer ihre Fiedel und ihr Schifferklavier ausgepackt und machten Musik. Ein paar Männer und Frauen tanzten ausgelassen dazu. Leo entdeckte darunter seine Eltern. Mariechen und Klärchen standen daneben und klatschten vergnügt in ihre Hände.
Es war gar nicht so einfach, einen freien Platz zu finden. Die Leute lagen kreuz und quer an Deck und sonnten sich. Voller Neid blickte Leo zum höher gelegenen Bereich der ersten Klasse empor. Dort oben war es nicht so eng. Einige Reisende standen am Geländer und blickten gelangweilt zu ihnen hinunter. Als wären sie in einem Zoo und die armen Menschen hier unten eine interessante Spezies. Leo ließ seinen Blick über die Gaffer schweifen. Ihm fiel auf, dass sich die meisten umgezogen hatten. Die Damen trugen enge weiße Freizeitkleider, die knapp über die Knie reichten, passend dazu eng anliegende, weiße Glockenhüte oder weiße Tücher, die sie elegant um den Kopf gewickelt hatten. Die Männer hatten ebenfalls überwiegend weiße Sporthosen und weiße Hemden an. Einen fröhlich bunten Kontrast bildeten die roten, gelben, blauen und grünen Krawatten, Fliegen, Schleifen und Bänder. Sie wirkten wie Farbtupfen in einem Meer aus Weiß. Trostlos waren dagegen die abgetragenen dunklen Klamotten der Auswanderer. Die meisten besaßen nur das, was sie am Körper trugen.
Jetzt war es Leo, der frech die Zunge rausstreckte. Manche der Frauen, die es gesehen hatten, drehten sich beschämt weg, wieder andere schnappten empört nach Luft. Und dazwischen stand ein Mädchen in weißem Sommerkleid, die langen lockigen blonden Haare mit einem blauen Band zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Es streckte ebenfalls die Zunge raus.
Da ist sie wieder!, durchfuhr es Leo. Noch ehe er »blöde Gans« nach oben rufen konnte, war das Mädchen von einer jungen Frau gerügt worden. Der Kleidung nach war es bestimmt das Kindermädchen. Und so blass, wie sie um die Nase war, litt sie vermutlich schon jetzt unter der Seekrankheit. Die Ersten hingen bereits über der Reling, obwohl das Meer hier ruhig war. Der Atlantik mit seinen Stürmen lag erst noch vor ihnen.

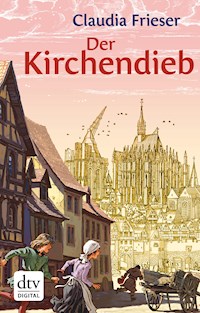














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












