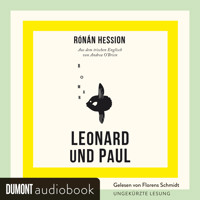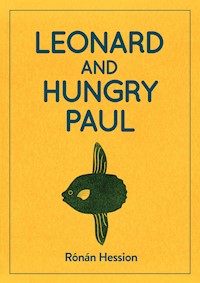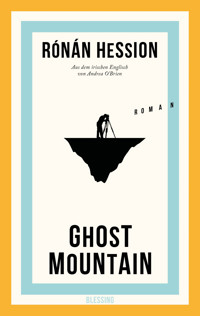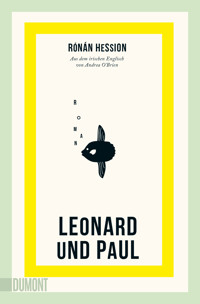
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Leonard und Paul sind allerbeste Freunde. Während Leonard als Ghostwriter Kinderenzyklopädien verfasst, arbeitet Paul als Aushilfspostbote. Das Leben der beiden verläuft in ruhigen, wohlgeordneten Bahnen – bis jedem von ihnen etwas widerfährt, das eine ganze Reihe von Veränderungen in Gang setzt. Dieser hochgelobte Debütroman rückt jene Menschen in den Mittelpunkt der Erzählung, die im Alltag oftmals übersehen werden. Leonard und Paul beteiligen sich nicht am Lärmen der Welt, sondern zeichnen sich durch Eigenschaften aus, die immer seltener anzutreffen sind: Freundlichkeit, Sanftmut und Bescheidenheit. Eine hinreißend charmante Lektüre voller Humor, die nachdrücklich vor Augen führt, wie bereichernd es sein kann, sich auf den Nebenstraßen des Lebens zu bewegen. »Wenn Sie in diesem Jahr nur ein einziges Buch lesen, dann bitte dieses. Und wenn Sie fertig sind, dann gehen Sie in Ihre Buchhandlung und kaufen noch ein Exemplar für einen lieben Menschen. Denn jeder sollte einen Leonard oder einen Paul haben – und wenn nur in Buchform.« WDR 5 SCALA
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Leonard und Paul sind allerbeste Freunde. Während Leonard als Ghostwriter Kinderenzyklopädien verfasst, arbeitet Paul als Aushilfspostbote. Das Leben der beiden verläuft in ruhigen, wohlgeordneten Bahnen – bis jedem von ihnen etwas widerfährt, das eine ganze Reihe von Veränderungen in Gang setzt.
Dieser hochgelobte Debütroman rückt jene Menschen in den Mittelpunkt der Erzählung, die im Alltag oftmals übersehen werden. Leonard und Paul beteiligen sich nicht am Lärmen der Welt, sondern zeichnen sich durch Eigenschaften aus, die immer seltener anzutreffen sind: Freundlichkeit, Sanftmut und Bescheidenheit.
Eine hinreißend charmante Lektüre voller Humor, die nachdrücklich vor Augen führt, wie bereichernd es sein kann, sich auf den Nebenstraßen des Lebens zu bewegen.
Rónán Hession ist ein irischer Schriftsteller und Musiker, der in Dublin lebt. ›Leonard und Paul‹ ist sein hochgelobter Debütroman, der u.a. auf der Shortlist der Irish Book Awards rangierte und für die British Book Awards nominiert war. In Deutschland stand er 2023 auf der Shortlist ›Lieblingsbuch der Unabhängigen‹.
Andrea O’Brien übersetzt seit vielen Jahren zeitgenössische Literatur aus den englischen Sprachen und wurde für ihre Arbeit bereits mehrfach ausgezeichnet. Sie lebt und arbeitet in München.
Roman
Aus dem irischen Englisch von Andrea O’Brien
Die Übersetzung dieses Buchs wurde von Literature Island gefördert.
E-Book 2024
DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Die deutsche Erstausgabe von ›Leonard und Paul‹ erschien 2023 bei WOYWOD & MEURER, ein Imprint des Torsten Woywod Verlags, Kerpen.
© Rónán Hession 2019
All rights reserved.
German translation rights arranged with
Melville House Publishing
46John Street
Brooklyn, NY 11201, USA
Die englische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel
›Leonard and Hungry Paul‹ bei Bluemoose Books, Hebden Bridge.
Vermittelt durch Agentur Brauer, München.
Übersetzung: Andrea O’Brien
Lektorat: Claudia Alt
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: © Perystey/Depositphotos
Satz: Angelika Kudella, Köln
E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN E-Book 978-3-7558-1044-5
www.dumont-buchverlag.de
Dieses Buch ist Kathleen Smyth gewidmet,
1
LEONARD
Leonard wurde von seiner Mutter unter fröhlich überspielten Mühen allein großgezogen; sein Vater war auf tragische Weise während der Geburt gestorben. Obwohl eisernes Durchhaltevermögen nicht ihrem Naturell entsprach, hatte Leonards Mutter ihrem Sohn beigebracht, das Leben als einen Reigen kleiner Ereignisse zu betrachten, von denen sich jedes auf eigene Weise bewältigen ließ. Für sie war Güte etwas völlig Normales. Hinten im Garten kein Vogelhäuschen zu haben war ihrer Meinung nach nur dadurch zu rechtfertigen, dass man schon eins im Vorgarten hatte.
Wie es manchmal ist bei Jungen, die Brettspiele lieber mögen als Sport, hatte Leonard wenige Freunde, aber viele Ideen. Seine Mutter verstand intuitiv, dass Kinder wie Leonard einfach einen interessierten Gesprächspartner brauchten. Also plauderten sie auf dem Weg zum Einkaufen über Meeraale und tauschten sich auf dem Rückweg intensiv über die Monde des Saturn aus, während Leonards Bad redeten sie über Flutwellen und vor dem Zubettgehen noch schnell über den Mann, der es mit den längsten Fingernägeln der Welt ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft hatte. Aber Leonard wuchs in einer Zeit auf, da man stille, verträumte Kinder nicht einfach als harmlos betrachtete und gewähren ließ, sodass seine Mutter ihn oft gegenüber engstirnigen Lehrern verteidigen musste, die behaupteten, sie könnten einfach nicht zu ihm durchdringen. Bei Elternsprechtagen saß sie allein vor ihnen und erklärte mit unverdrossener mütterlicher Geduld, dass ihr Sohn, wie sein verstorbener Vater, eben einfach kein »Blitzmerker-Gesicht« habe.
Selbst als Leonard die Dreißig überschritten hatte, umhegte sie ihn weiterhin liebevoll, kaufte ihm Schinkenbraten zum Mittagessen, schön mager, wie er es mochte, stellte ihm morgens eine Tasse Tee auf den Nachttisch und versah seine Jeans sorgfältig mit Bügelfalten, die Leonard hinterher stillschweigend wieder rausbügelte. Er revanchierte sich für ihre Zuwendung, indem er ihr im fortgeschrittenen Alter Gesellschaft leistete und sie an seinem in relativ ruhigen Bahnen verlaufenden Alltag teilhaben ließ.
Leonard wusste nicht, wann genau sich ihre Mutter-Sohn-Beziehung hin zu einer eher partnerschaftlichen entwickelt hatte. Obwohl das gesellschaftliche Urteil über das Zusammenleben von erwachsenen Söhnen mit ihren verwitweten Müttern noch aussteht, gilt diese Situation nicht als erstrebenswert. Diejenigen, die davon Notiz nahmen, hielten sie vermutlich für eine Glucke oder ihn für antriebslos, generell und vielleicht auch sexuell, doch in Wahrheit lag es beiden fern, sich gegenseitig einzuschränken oder sich in die Belange des anderen einzumischen. Beide waren unabhängige Menschen, die ihre Privatsphäre schätzten und einfach gut miteinander auskamen. Leonard erinnerte sich allerdings an einen Moment, als sie es beide seltsam gefunden hatten. Damals war es darum gegangen, ob sie gemeinsam in den Urlaub fahren sollten, doch er hätte jetzt nicht mehr sagen können, wer von ihnen den Vorschlag gemacht hatte. Mutter-Tochter-Urlaube waren natürlich völlig normal, und Vater-Sohn-Reisen galten als Teil des Reifeprozesses. Bei der Konstellation Mutter und Sohn hingegen dachten alle sofort, dass eine Person der anderen zur Last fallen müsse. Doch ehrlich gesagt waren die beiden ideale Reisegefährten. Sie war gut zu Fuß und konnte stundenlang durch Galerien und Museen bummeln, ohne sich wie andere, halb so alte Frauen erschöpft den Verlockungen des Museumsladens hinzugeben. Beide mochten Kirchen, Leonard war zwar nicht religiös, aber ein Großteil der Kunst eben schon. Während er sich also in europäischen Kathedralen an berühmten Bildern und Skulpturen erfreute, zündete seine Mutter in einer der Seitenkapellen eine Kerze für ihren schwachen, lang verstorbenen Ehemann an.
Nie fragte sie Leonard über Freundinnen aus, schließlich war das Thema heikel und sie außerdem unsicher, ob es ihrem anscheinend zölibatär lebenden Sohn an Interesse oder an Gelegenheit mangelte. Für Leonard hatte der Umstand, dass er zu Hause bei seiner Mutter wohnte, allein aus praktischen Gründen zu einer gewissen Zurückhaltung geführt. Er hatte sich gefragt, wie es wäre, wenn er ein Mädchen mitbrächte und am nächsten Morgen auf einmal zwei Tassen Tee auf dem Nachttisch stünden.
Seine Mutter starb mitten in der Woche im Schlaf, sorgfältig zugedeckt, ihre Kleidung war für den nächsten Tag fein säuberlich zurechtgelegt, diese Sorgfalt ein Zeichen ihrer Wertschätzung für die kleinen Dinge des Lebens. Als Ursache nannte der Arzt Herzinfarkt, betonte aber, dass er keinerlei Anzeichen für Leiden oder Dramatik habe feststellen können. Ihr Herz, erklärte er, habe einfach »den letzten Schlag getan«.
Da Leonard das schüchterne einzige Kind zweier ebenfalls schüchterner Einzelkinder war, kamen nur wenige Leute zur Beerdigung. Die vorderen Reihen in der Kirche waren so gut wie leer, Leonard saß allein, da Trauergäste ihre Beziehung zu Verstorbenen oft falsch einschätzen und sich weiter nach hinten setzen, als sie sollten. Ohne nennenswerten Familienkreis blieb Leonard nichts anderes übrig, als die verschiedenen Aufgaben während der Trauerfeier selbst zu übernehmen: Er trug die Fürbitten vor, führte die Kollekte durch und kümmerte sich um all die anderen Nebensächlichkeiten, die sonst die Verwandtschaft erledigt hätte. Der Pfarrer tummelte sich in seiner Predigt auf den Gemeinplätzen Tod und Hoffnung, sehr zu Leonards Erleichterung, denn seine Mutter mochte es überhaupt nicht, wenn Menschen das Leben eines Verstorbenen auf eine Karikatur reduzierten. Hätte Leonard den Mut gehabt, wäre er aufgestanden und hätte allen erzählt, dass seine Mutter die Menschen in ihrem Leben umhegt hatte wie die Vögel in ihrem Garten: mit bedingungsloser Freude und Großherzigkeit.
Im Krematorium, als ihr Sarg auf Schienen unter dem roten Vorhang hindurchruckelte, fühlte sich Leonard an die Geisterbahn auf dem Jahrmarkt erinnert, die seine Mutter sehr gemocht hatte. Aufgrund ihrer Höhenangst und Scheu vor Gerangel waren Jahrmärkte für sie eine echte Herausforderung gewesen, die sie nur Leonards wegen angenommen und so eine Vorliebe für die Geisterbahn entwickelt hatte, im Grunde ja nichts anderes als eine langsame Fahrt durch eine dunkle Galerie voller angestrahlter Kunstobjekte. Nachdem der Vorhang hinter dem Sarg gefallen war und die letzten Klänge von »Nothing Rhymed« ihres Lieblingssängers Gilbert O’Sullivan verstummt waren, wischte Leonard sich eine Träne von der Brille und machte sich auf den Weg zu seinem Elternhaus, das er von jetzt an als Waise allein bewohnen würde.
Wenn ein Einzelkind seinen zweiten Elternteil verliert, wird im Generationenkalender eine neue Seite aufgeschlagen. Abgesehen von allerlei praktischen Dingen, die zu erledigen und zu regeln sind, muss man sich auch noch dem Alltag stellen. Er kommt auf einen zu, ob man bereit ist oder nicht. Und so verquickten sich Trauer und Verwirrung. In diesem Gemütszustand, eine Oktave tiefer gestimmt, verbrachte Leonard die ersten Wochen nach der Beerdigung: Er schaute dem Auflauf im Ofen beim Überbacken zu, verharrte mit einer Tüte voller Futterherzen aus Sonnenblumenkernen vor dem Vogelhäuschen oder mit erhobenem Textmarker über der Fernsehzeitung. Hätte man ihn in diesen Momenten gefragt, woran er gerade dachte, oder ihn mit herkömmlichen Mitteln aus seiner Trance zu reißen versucht – ihn also ohne Grund beim Verharren unterbrochen –, er hätte keine Antwort parat gehabt, und sein Bewusstsein wäre zu ihm zurückgekehrt wie eine Katze nach ein paar Tagen unerklärter Abwesenheit.
Nach dem Abendessen saß er auf dem Sofa, wie viele alleinstehende Männer, denen Zeit nicht als Geschenk, sondern als Lücke galt. Dann schlug er eine der historischen Biografien auf, die geduldig im Regal warteten, viele davon schon nach den ersten Seiten mit einem Lesezeichen versehen, der Porträtierte den Kinderschuhen noch nicht entwachsen. Buchhandlungen empfand Leonard als tröstliche Orte, Bücher kaufen als tröstliche Beschäftigung, aber seit einiger Zeit konnte er sich nicht mehr aufs Lesen konzentrieren, es kam ihm einsamer vor, jetzt, da seine Mutter nicht mehr im Haus herumwerkelte. Immer wieder setzte er sich an den Tisch und versuchte, Skizzen aus dem Jahrbuch des Vogelbeobachters abzumalen – ein am Strand entlangtippelnder Sanderling oder eine Lumme mit ihren Eiern, die birnenförmig verzogen sind, damit sie nicht von hohen Klippen kullern –, doch da er sie niemandem zeigen konnte, hudelte er bei Einzelheiten im Gefieder oder vernachlässigte feinere Farbnuancen. Und natürlich war da immer der Fernseher: die beste aller Alternativen, wenn auch seltsam entfremdet, weil sonst niemand auf dem Sofa saß, mit dem er sich darüber hätte austauschen können.
Wäre Leonard ein anderer Mensch gewesen, hätte er sich vielleicht im Pub mit ein paar Freunden zum Darts, Domino, Karten- oder anderen Knastspielen getroffen, doch nichts vermittelte ihm derzeit ein intensiveres Einsamkeitsgefühl als die Vorstellung, sich in Gesellschaft von extrovertierten Menschen aufhalten zu müssen. In Zeiten wie diesen erkennen wir unsere wahren Freunde oder, wie in Leonards Fall, wenden wir uns unserem einzigen Freund zu. Und so, getrieben vom Wunsch, diesen trostlosen Teil des Abends zu vermeiden oder zu vertreiben, suchte Leonard regelmäßig Zuflucht in der Gesellschaft von Paul.
2
PARLEY VIEW
Paul wohnte noch mit seinen Eltern in dem Haus, wo er aufgewachsen war. Er hatte bereits mehr als dreißig seiner biblisch verbrieften siebzig Lebensjahre hinter sich, und Fremde, die gern ungefragt ihre Meinung kundtaten, mochten behaupten, ihm fehle es an »Elan« oder er wolle lediglich seine Eltern überdauern, um so ohne eigenes Zutun zum Hausbesitzer zu werden. Aber Paul war ein Mensch, an dem Tratsch dank seiner generellen Selbstvergessenheit komplett vorbeiging. In Wahrheit war er nie aus seinem Elternhaus ausgezogen, weil er Teil einer glücklichen Familie war und dies zu schätzen wusste, was vielleicht seltener vorkommt, als es sollte.
Sein Vater Peter hatte jahrelang als Ökonom gearbeitet, war aber jetzt im Ruhestand und lebte von der Rente, die ihm die unsichtbare Hand des Marktes zumaß. Sein Schädel war kahl, doch es sah aus, als hätte die Schwerkraft die seinem Haupt fehlenden Haare über die Kopfhaut zurück in seinen Körper gezogen, denn nun sprossen sie ihm stattdessen aus den Ohren, der Nase und den Brauen. Pauls Mutter Helen war Lehrerin und arbeitete in Altersteilzeit nur noch zwei Tage die Woche. Helen hatte Leonard zwei Jahre lang in der Grundschule unterrichtet. Damals hatte sie ihn oft für seine Zeichnungen gelobt und ihm versichert, er hätte »richtig Grips«, wenn er ihn nur anstrengen würde, eine der nettesten Arten, jemanden faul zu nennen. Wie alle Lehrerinnen, die ihren ehemaligen, mittlerweile erwachsenen Zöglingen begegnen, begrüßte sie Leonard stets mit aufrichtiger Freude.
Ihren Mann Peter hatte sie auf der Straße kennengelernt, als er ihr den Weg zu einer Kunstausstellung beschrieben und sie schließlich dorthin begleitet hatte. Sie hatten sich spontan so ineinander verliebt. Die Chemie bahnte den Weg zur Physik, dann zur Biologie, und schließlich wurden die beiden mit ihrem ersten Kind gesegnet, Pauls älterer Schwester Grace. Paul kam erst nach zwei schwierigen Fehlgeburten zur Welt, weshalb Helen ihn verständlicherweise als besonderes Geschenk betrachtete. Helen und Peter teilten immer noch die Nähe zweier Menschen, die viel miteinander durchgemacht hatten.
Auf Pauls Vorschlag hin hatten sie ihrem Haus den Namen »Parley View« gegeben, nach einem französischen Chanson, das er mal beim Rugbyspiel im Fernsehen gehört hatte. Helen war es wichtig, den Garten hinten vogelfreundlich und vorn bienenfreundlich zu gestalten, während Peter sich um das kümmerte, was er »häusliche Instandhaltung« nannte: Bilder aufhängen, Glühbirnen auswechseln und all die anderen Dinge, die man einem bedürftigen Haus angedeihen lassen konnte, ohne ernsthaft in Werkzeug zu investieren. Grace war schon lange ausgezogen und bereitete sich auf ihre bevorstehende Hochzeit vor, ein Projekt, das sie mit ihrer Mutter in allabendlichen Telefonaten abarbeitete, wobei Helens mütterlicher Beitrag meist daraus bestand, Grace zu lauschen und gelegentlich beruhigend »Ich weiß, Schatz, ich weiß« einzuwerfen.
Als Leonard an diesem Abend vor der Tür stand, begrüßte Peter ihn wie üblich mit freudestrahlender Miene.
»Nur herein, Leonard, nur herein.«
Vor dem Eintreten putzte sich Leonard unnötigerweise die Schuhe auf der Fußmatte ab, eher aus Anstand als aus hygienischen Gründen. Im Wohnzimmer legte Helen auf einem Teetablett ein Puzzle. Es sollte wohl ein impressionistisches Kunstwerk werden, aber bisher waren nur die Ränder fertig, weshalb es sich nicht genau erkennen ließ. Ihre Teetasse stand wackelig auf der Sofalehne, etwas, das Leonards Mutter nie erlaubt hätte. Peter und Helen setzten sich wieder auf ihre angestammten Plätze auf dem Sofa, auch sie fügten sich zusammen wie zwei Puzzleteile.
»Wie geht es dir, Leonard? Hast du zum Alltag zurückgefunden? Es gibt sicher noch eine Menge zu regeln«, sagte Helen, bemüht, die sensiblen Themen sofort sachte aus dem Weg zu räumen.
»Ich komme klar«, antwortete Leonard, ohne sich speziell auf den Alltag, die Trauer oder die zu regelnden Dinge zu beziehen.
»Schön, dich zu sehen … greif zu.« Helen zeigte auf ein drei Wochen zu früh geschlachtetes Schokoladen-Osterei, offenbar suchte sie ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen, indem sie es mit anderen teilte. Leonard nahm sich ein großes Stück, versuchte, sich davon eine bescheidenere Portion abzubrechen, beschloss dann aber doch, alles zu essen, nachdem es in seinen Schoß zerbröselt war. Im Fernsehen lief eine von Leonards Lieblingssendungen, die Quizsendung University Challenge, sie war auf Pause gestellt.
Peter saß für gewöhnlich in Habachtstellung davor und feuerte lautstark mögliche Lösungen ab, kaum dass ein Spieler den Buzzer betätigt hatte: »Thomas Cromwell, NEIN, Oliver Cromwell, NEIN …«, und das alles, bevor ein unfassbar aufgeräumter Zwanzigjähriger »Kardinal Wolsey« antworten konnte. Das Gegenstück zu Peters Maschinenpistole war Helens Heckenschützengewehr. Sie beschäftigte sich gern mit anderen Dingen – Kreuzworträtsel, Sudoku oder Puzzle, wie heute Abend – und tat, als würde sie nicht zuhören. Doch dann, bei irgendeiner obskuren Frage, die beide Teams ins Rudern brachte, lieferte sie aus dem Hinterhalt die richtige Antwort, ohne auch nur aufzuschauen. Für gewöhnlich handelte es sich dabei um etwas, das man nicht erraten konnte, wie ein Ereignis, das in einem Schaltjahr stattgefunden hatte, oder der Umstand, dass König Irgendwer der Soundsovielte einen Zwillingsbruder hatte. Sie tat, als wäre es ihr egal, dass sie mit ihrer kühl vorgetragenen Antwort gleich ein ganzes Dutzend von Peters hektisch hervorgestoßenen Rateversuchen abgeschossen hatte. Einmal hatte Peter eine Sendung aufgezeichnet und die ersten zwanzig Antworten auswendig gelernt, damit Helen später beim gemeinsamen Ansehen so richtig von den Socken wäre, was ihm dann auch gelungen war, obwohl wir nie erfahren werden, ob Helen tatsächlich darauf hereingefallen war oder sich einfach gefreut hatte, dass er sich nach so vielen Jahren noch immer solche Mühe machte, sie zu beeindrucken. Vor allem interessierten sich Peter und Helen aber für die Sendung, weil sie beide an die Jugend glaubten. Sie fieberten mit und verziehen den Teilnehmenden jegliche Selbstüberschätzung, denn in jedem intelligenten jungen Menschen, der das Beste aus einer guten Schulbildung machte, sahen sie etwas Reines, Makelloses.
»Wie läuft’s auf der Arbeit, Leonard?«, fragte Peter. Als Rentner, der alles hinter sich hatte, bewahrte er sich noch ein gewisses Interesse an der Arbeitswelt.
»Ganz gut. Viel zu tun.«
»Welches Thema ist gerade dran? Dinosaurier? Meerestiere? Höhlenmenschen? Die Griechen?«
»Fast – die Römer. Und besonders ihre Zeit in Britannien und in den umliegenden Provinzen. Ist wirklich interessant. Die Schotten haben ihnen ganz schön zugesetzt.«
Leonard verfasste Lexika und andere Sachbücher für Kinder. Er schrieb sie zwar, galt aber nicht als ihr Autor. Diese Ehre wurde wie die Namensnennung auf dem Cover nur dem Akademiker zuteil, der letztlich für den Inhalt verantwortlich zeichnete. Leonards Aufgabe bestand darin, die wichtigsten Eckpunkte in knappen, prägnanten Sätzen zu vermitteln. Einigen Illustratoren gefiel Leonards Art, die Dinge kurz und bündig zusammenzufassen, und er hatte sich mittlerweile den Ruf erarbeitet, Fakten aus kindlicher Perspektive zu erklären. Die Arbeit passte zu ihm, er interessierte sich für alles, das Interesse verdiente, und spielte lieber eine Nebenrolle in der Geschichte der anderen, als in deren Mittelpunkt zu stehen. Außerdem vermittelte ihm der Status als Underdog, ungenannt und unbesungen, eine gewisse Glaubwürdigkeit, selbst wenn sein Einkommen etwas geringer ausfiel, als er es sich in seinem Alter gewünscht hätte. Er arbeitete für sich in einem riesigen Großraumbüro, das er sich mit Verlagsfremden und mit dem firmeneigenen, aber nicht minder verlagsfremden Verwaltungspersonal teilte. Das alles vermittelte ihm ein Gefühl und den Anschein von gesellschaftlicher Zugehörigkeit, obwohl er in Wirklichkeit zumeist allein arbeitete und seinen Gedanken nachhing. Die Illustratoren, die dem Verlag letztlich die Profite bescherten, fügten ihre Bilder erst hinzu, wenn Leonards Arbeit schon getan war, weshalb er so gut wie keinen Kontakt zu ihnen hatte. Seine Beziehungen zu den verantwortlichen Autoren waren rein beruflich und distanziert. Sie schickten ihm höfliche, aber wenig herzliche Mails mit ihren Kommentaren und Änderungswünschen. Leonard machte das nichts aus. Er hatte nicht vor, mit den Alphatieren des Unternehmens berufliche Freundschaften zu schließen.
»Du solltest die Illustrationen selbst übernehmen, Leonard – darin warst du immer gut. Dann musst du nur noch deinen tyrannischen Chef loswerden und die Bücher selbst verlegen. Du könntest auf die Bahamas auswandern und am Strand schreiben«, schlug Helen vor, die es sich zur Lebensaufgabe gemacht hatte, anderen behutsame Steilvorlagen zu liefern, die diese nur noch verwandeln mussten.
»Irgendwann vielleicht«, sagte Leonard. »Leider sind alle Sachbücher schon zigmal geschrieben worden, da gibt es kaum noch was Originelles zu sagen. Die Illustratoren sind immer auf dem neuesten Stand, während ich dazu verdonnert bin, die alten Themen zu beackern. Aber ich bin trotzdem recht zufrieden – die Vorstellung, dass Kinder diese Bücher lesen und sie spannend finden, macht mich froh.«
»Es gibt nichts Schöneres als ein lesendes Kind«, sagte Helen. »Ich weiß noch, wie Grace bäuchlings lesend auf dem Läufer lag und sich weder vom Fernseher noch von uns ablenken ließ. Ich habe noch kein Kind getroffen, das nicht gerne gelesen hätte, sofern es die Gelegenheit dazu hatte. Manchmal haben Eltern sich bei mir beklagt, ihr Kind würde keine Bücher lesen, und mein Rat an sie war stets derselbe: Wenn die Eltern lesen, folgt das Kind ihrem Beispiel. Wenn du sie zu etwas animieren willst, mach’s ihnen vor.« Sie zeigte auf die Studierenden in der angehaltenen Quizsendung. »Ich wette, ihre Eltern haben Bücher gelesen«, fügte sie hinzu.
»Wo wir gerade bei Hochbegabten sind, kann es sein, dass Ihr Lieblingssohn nicht zu Hause ist?«, fragte Leonard.
»Oben – er hat uns gebeten, dich hochzuschicken«, sagte Peter, die Hand bereits zur Fernbedienung ausgestreckt. Als Leonard aus dem Zimmer war, lief die Sendung weiter, und er hörte Peter rufen: »Magnesium!«
Oben war zwar Pauls Schlafzimmer, aber von Paul fehlte jede Spur. Unsicher, ob es Regeln für das Betreten des Schlafzimmers eines Erwachsenen in rein platonischer Absicht gab, blieb Leonard im Türrahmen stehen und verharrte dort so entspannt, wie es eben möglich war, wenn man mitanhören musste, wie der beste Freund nur ein paar Meter weiter seinen Darm entleerte. Er nutzte die Gelegenheit, sich Pauls Schlafzimmer genauer anzusehen, in dem er noch nie so richtig gewesen war. Nach dem zwölften Lebensjahr gibt es für Männer eigentlich keinen plausiblen Grund mehr, sich im Schlafzimmer eines Freundes aufzuhalten. Pauls Zimmer bestand aus einem bunten Mix verschiedener Lebensphasen, vereinzelte Faszinationsobjekte aus seiner Kindheit und Jugend sabotierten den halbherzigen Erwachsenenanstrich. Actionfiguren standen in Actionpose auf Regalen, auf denen Pauls Eltern sicher gern Weltliteratur gesehen hätten. Ein selbst gebasteltes Mobile mit einer Spitfire aus Pappe baumelte von der einzigen Lampe im Zimmer. Die Wände waren pastellgrün gestrichen, ein Farbton, den man fürs Kinderzimmer wählte, wenn man das Geschlecht des Nachwuchses nicht kannte. Vorhänge und Tagesdecke trugen ein Muster, wie es bei herkömmlichen Heimtextilien zu finden war: Blätter und dergleichen in verschiedenen Blau- und Grautönen. An den Wänden hingen Pauls eigene Kunstwerke, darunter ein leicht verwischtes Malen-nach-Zahlen-Porträt vom Lachenden Kavalier und ein anspruchsvolles Puzzle aus der Reihe Wo ist Walter?, zur Dokumentation seiner Leistung gerahmt und aufgehängt. Obwohl nicht unaufgeräumt, wirkte das Zimmer unordentlich, wie es oft vorkommt, wenn erwachsene Kinder noch zu Hause wohnen.
Paul kam aus dem Bad, in einen weißen flauschigen Bademantel gehüllt, den er mit einem weißen Gürtel zugebunden hatte, darunter trug er eine Jogginghose und Flipflops, an denen etwas Klopapier klebte. Er schüttelte die Handgelenke aus und trug jenen Gesichtsausdruck intensiver Konzentration, den man von Menschen kennt, die mit nassen Händen nach einem Handtuch suchen. Der Umstand, dass seine Kleidung ebenfalls aus Frottee bestand, hätte einen Geringeren vielleicht zu einem Kompromiss verleitet, aber Paul, der bereits die Herausforderung einer Toilettensitzung in Weiß gemeistert hatte, machte keine Anstalten, vor dieser weniger anspruchsvollen Hürde zu kapitulieren. Er löste sein Problem, indem er ein T-Shirt aus dem Wäschekorb fischte und sich die Hände daran abtrocknete, wobei er wohl davon ausging, dass Kleidungsstücke, die gerade noch sauber genug zum Tragen gewesen waren, sicher so schnell nicht schmutzig wurden, dass man sie vorm Waschen nicht zwischennutzen konnte. Erleichterung macht Freude, und so kam es, dass Paul seinen Freund, als er ihn bemerkte, mit aufrichtiger Herzlichkeit begrüßte.
»Hi, Leonard. Sie haben dich hochgeschickt. Sehr schön. Wie geht’s?«
»Gut, danke. Was hat es mit dem Bademantel auf sich?«, fragte Leonard.
»Ach, ich habe mit Kampfsport angefangen. Wie sehe ich aus?«
»Täuschend echt, würde ich sagen. Wie bist du denn auf einmal da drauf gekommen? Gewalt passt irgendwie nicht zu dir.«
»Nee, meine Einstellung zur Gewalt ist immer noch dieselbe, aber Kampfsport ist ja auch eher Stillstand in Aktion. Ruhe mitten im Kampf. Klar ist körperlicher Einsatz gefragt, aber der Verstand bleibt ruhig und friedlich. Keine mentale Gewalt, keine böse Absicht, und die ist schließlich das Schlimmste an der Gewalt. Außerdem handelt es sich um Judo, da schlägt man niemandem ins Gesicht oder so was.«
»Und wie ist es so, sich mit Neandertalern herumzuwälzen? Ich dachte, du magst es nicht, wenn Leute dich anfassen, und erst recht nicht, dir die Knochen zu verbiegen.«
»Ja, da ist was dran. Ich hatte tatsächlich gehofft, auf diese Weise meine Angst vor körperlicher Nähe zu überwinden. Wie du sagtest, es handelt sich um eine der intimeren Kampfsportarten, deswegen tragen wir ja auch Übernachtungsklamotten statt beispielsweise schwarzer Krawatte. Aber ehrlich gesagt muss ich noch an meiner Fitness arbeiten. Mich macht ja schon die Treppe fertig, stell dir vor, was ein Schwarzgurt mit mir anstellt.«
Kaum hatte Paul den Satz beendet, ging er zu Boden und vollführte ein paar Liegestütze auf den Fäusten. Es knackte bedenklich, er fluchte, dann begann er von vorn, ein Breakdancer, der die Raupe macht.
»Wie viele davon musst du schaffen?«, fragte Leonard.
»Mein Sensei sagt, ich soll meine Grenzen überwinden. Wie Wasser soll ich sein. Im Kurs war es leichter, auf diesen weichen Matten, aber hier auf dem Holzboden ist das ziemlich schwierig. Vielleicht versuche ich es mal mit Antirutschsocken statt Flipflops.«
»Die Kluft steht dir aber. Ein weißer Gurt – das ist ziemlich beeindruckend. Was für Techniken hast du bis jetzt gelernt?«
»Bis jetzt kann ich nur sagen: Umgekehrt wird ein Schuh draus. Zuerst bringen sie dir bei, wie du eine Verzichtserklärung unterschreibst, und dann zeigen sie dir, wie du einen Sturz abfängst, damit du dich nicht verletzt, denn ob ich mich verletze oder nicht, hängt eher von mir selbst ab als von meinem Gegner. Dann haben wir Partnerübungen gemacht. Die meisten in meiner Gruppe sind größer als ich, deswegen war ich meist mit Verteidigung beschäftigt.«
»Damit schulst du sicher auch deine mentale Stärke. Kampfsport ist ja bekanntermaßen gut für das Einssein von Geist und Körper«, bemerkte Leonard, der für ein Kinderlexikon über die Olympischen Spiele mal was über die Kampfsportdisziplin geschrieben hatte, allerdings nur einen kurzen Absatz am Ende, irgendwo zwischen Schießen, Gewichtheben und einem Infokasten über Steroide.
»Witzig, dass du das sagst. Nach der Stunde hatte ich tatsächlich so ein Leichtigkeitsgefühl im Kopf, wie immer, wenn ich was Neues ausprobiere. Das war aber auch mein erstes Mal. Ich habe den Sensei gefragt, wie er mein Potenzial einschätzt, und er meinte, wenn ich Bademantel und Jogginghose gegen einen Gi – so nennt man einen echten Judoanzug – tauschen würde, wäre das schon mal ein erster Schritt. Ich vermute stark, dass man eine Menge Wettkämpfe gewinnen muss, bis der Mann einem Respekt zollt.«
Leonard bewunderte Paul dafür, dass er sich auf etwas einließ, das einer derart fremden Kultur entstammte, und nach einigem Nachdenken stimmte er ihm zu, dass es vermutlich besser wäre, einen echten Judo-Gi zu kaufen, denn so ein Bademantel war einfach zu flauschig, um einen erfahrenen Judoka zu beeindrucken.
»Wenn du noch trainierst, soll ich dann besser unten warten?«, fragte Leonard.
»Nein, ich mach später weiter. Lass uns auf ein Schwätzchen nach unten gehen.« Paul verknotete den weißen Frotteegürtel auf die gleiche Weise, wie er seine Schnürsenkel band.
Statt des Wohnzimmers wählte er die Küche, was er seine Eltern gleich wissen ließ. »Wir sind hier drin!«, rief er, woraufhin Helen fröhlich »Okay, Schatz!« antwortete. Er schaltete den Wasserkocher ein und verschwand in einer Nische, die sich an die Küche anschloss, vermutlich für die Speisekammer vorgesehen, doch in diesem Haus wurden darin nur Brettspiele aufbewahrt. Wie ein Sommelier auf der Suche nach dem passenden Jahrgang ließ Paul seinen Kennerblick über die abgewetzten Kanten der übereinandergestapelten Kartons wandern. Damit ließ er sich so lange Zeit, wie der Wasserkocher zum Brodeln brauchte, doch schließlich streckte er die Hand mit einem Karton aus dem Kabuff und rief von drinnen: »Das hier?« Es handelte sich um Yahtzee, was sie schon sehr lange nicht mehr gespielt hatten.
»Gut ausgesucht. Heute Abend bist du ja so richtig in fernöstlicher Stimmung. Willst dir einen Gi kaufen, kochst grünen Tee, wenn ich das richtig sehe, und jetzt spielen wir auch noch Yahtzee. Schlägst du eine neue Richtung ein im Leben? Findest du die westliche Zivilisation nicht mehr anregend genug? Ach, und ich hätte gern einen normalen Tee, bitte.«
»Ich glaube, ich muss ein bisschen tiefer in den kulturellen Kontext eintauchen, wenn ich beim Judo nächste Woche nicht wieder von ein paar sechzehnjährigen Mädchen vermöbelt werden will. In dieser ersten Stunde hat mir was Entscheidendes gefehlt. Mir ist noch nicht ganz klar, was einen Judoka eigentlich ausmacht, also abgesehen von Balance und den motorischen Fähigkeiten«, sagte Paul. »Tja, es ist schon eine Weile her, seit wir Yahtzee gespielt haben. Wie ging das noch mal?«
Paul breitete das Zubehör auf dem Tisch aus: eine casinorot bespannte, runde Würfelmatte mit erhöhten Rändern, vier (der eigentlich fünf) Würfel, ein schwarzer Becher, der beim Schütteln der Würfel das typische hohle Klackern erzeugte, und ein Satz unglaublich komplizierter Spielblöcke, auf denen aufgelistet war, welche Augenkombinationen die Spieler erwürfeln mussten.
»Das kommt mir alles sehr fernöstlich vor«, sagte Leonard über das Spiel, das in Kanada erfunden und von den USA kommerzialisiert wurde.
»Wahrscheinlich wurde es zuerst während des Zweiten Weltkriegs von Kriegsgefangenen in japanischen Lagern gespielt. Weißt du noch, wie es geht? So allmählich fällt mir wieder ein, warum wir es so lange nicht mehr rausgeholt haben. Ich glaube, das letzte Mal haben wir aufgegeben und stattdessen Risiko gespielt, weil es uns weniger kompliziert vorkam, was einiges aussagt.« Paul wandelte auf dem schmalen Grat zwischen seiner Leidenschaft für Gesellschaftsspiele und seiner Abneigung gegen Spielregelheftchen.
Leonard erklärte ihm die Kurzversion, soweit er sich daran erinnern konnte. Paul, dem ebenfalls das »Blitzmerker-Gesicht« fehlte, nickte zwar, verstand aber nur Bahnhof.
»Fang einfach an, dann schauen wir weiter. Mir fällt es sicher wieder ein, wenn ich es erst sehe. Irgendwie sind diese Regeln für mich wie Kartenspiele, die verstehe ich auch nie. Ach, und ich hole uns am besten noch einen Würfel.« Paul verschwand im Kabuff und stibitzte einen Würfel aus einem anderen Karton, was echte Gesellschaftsspieler als Akt des Kannibalismus verurteilen würden.
Gemäß den Regeln schüttelte Leonard den Becher wie einen Cocktailshaker mit beiden Händen, sodass die Würfel darin herumklackerten. Er versuchte sich an einem Full House, warf aber fünf verschiedene Augenzahlen. Paul, der beschlossen hatte, ebenfalls ein Full House zu versuchen, stopfte sich hektisch den angebissenen Keks in den Mund, um zum Würfeln beide Hände freizuhaben. Seinen vor lauter Stress weit auseinanderklaffenden Bademantel hatte er bereits vollgekrümelt. Er warf zwei Zweien, eine Drei, eine Fünf und eine Sechs. Was das hieß, war ihm allerdings schleierhaft.
»Ah! Jetzt weiß ich wieder – muss ich nicht ›Yahtzee!‹ rufen?«, fragte er, weil ihm nichts Besseres einfiel.
»Eigentlich nicht. Ich glaube, du denkst an Bingo oder Uno«, sagte Leonard, bevor er Paul seine Kombination erklärte und ihn bei den nächsten Würfen unterstützte.
Da sie beide regelmäßig miteinander spielten und oft die Spiele wechselten, war es nicht weiter ungewöhnlich, dass es am Anfang zunächst eher schwerfällig lief. Das war völlig normal, schließlich muss sich jemand, der mit eingerosteten Fremdsprachenkenntnissen im Ausland eintrifft, auch erst mal wieder in die Landessprache einhören. Schon bald ging das Spiel seinen Gang, Würfel klackerten und fielen, und die beiden Freunde unterhielten sich angeregt über dieses und jenes, denn sie waren Freigeister und als solche an vielerlei Themen interessiert.
Paul, der die Welt für etwas Fantastisches hielt, begegnete ihr mit großer Faszination. Wissenschaftliche Erkenntnisse waren für ihn wie eine Sammlung an Legenden, manche erschienen ihm sogar so rätselhaft und undurchdringlich, dass sie eigentlich schon ins Reich der Mythen gehörten. Gern lieh er sich Ausgaben von National Geographic aus der Bücherei, manche schon Monate alt, aber das störte ihn nicht, wenn er Artikel über die Radiokarbonmethode oder die Perser las. Auf diese Weise hielt er sich über die Welt da draußen auf dem Laufenden und sich gleichzeitig von dem fern, was generell als »Tagesgeschehen« bezeichnet wurde. Leonard, ein Autodidakt, wie er im Buche stand, besaß ein Abonnement des New Scientist, ein Weihnachtsgeschenk seiner Mutter, das sie jedes Jahr für ihn erneuert hatte. Außerdem las er gern die Zeitschrift Yesterday Today, um sich über die neuesten Entwicklungen in der Geschichte des Altertums zu informieren. Für die beiden Freunde war die Korallenbleiche ebenso aktuell wie die letzte Wahl, die Entdeckung neuer Zwergplaneten so relevant wie das Elfmeterschießen in der Fußballübertragung des vergangenen Abends und Marco Polo genauso interessant wie die Promis auf dem roten Teppich. In ihren Unterhaltungen vereinigte sich das Yin von Leonards Leidenschaft für Faktenwissen mit dem Yang von Pauls Neugier.
»Erinnerst du dich an die Edvard-Munch-Ausstellung von letztem Jahr? Mit diesen schlimmen Bildern von kranken Kindern?«, fragte Paul.
»Aber sicher. Da am Kühlschrank hängt ja auch noch der Magnet von Der Schrei, den du dir damals als Andenken gekauft hast. Und ich weiß, dass es nicht jeder Künstler an eure Kühlschrankgalerie schafft.«
»Tja, ich habe heute einen Artikel über genau dieses Kunstwerk gelesen, und du wirst nicht glauben, was ich herausgefunden habe. Weißt du, was das Faszinierendste an diesem Bild ist?«, sagte Paul geheimnisvoll.
»Okay, lass mich überlegen. Der orangefarbene Hintergrund ist eine Anspielung auf den Ausbruch des Krakatau, oder? Meinst du das?«
»Interessant, aber nein.« Paul klackerte die ganze Zeit über mit dem Würfelbecher herum, was die Spannung noch weiter erhöhte.
»Okay, ich geb auf.«
»Die Figur auf dem Bild schreit gar nicht.« Paul kippte die Würfel mit so viel Enthusiasmus auf die Matte, dass einer unter den Tisch rollte, leider eine Vier, die ihm nichts nutzte.
»Wirklich? Bist du sicher?«
»Hundertpro. Das ist nämlich gerade der Punkt. Die Figur hält sich die Ohren zu, damit sie den Schrei nicht hören muss. Ist das nicht faszinierend? Dass ein Bild so missverstanden wird und trotzdem so berühmt ist?«
»Echt? Ich muss zugeben, dass ich es selbst falsch beschrieben habe, in mehreren meiner Lexika. Aber egal. Wie interessant, das müssen wir bei der nächsten überarbeiteten Auflage ändern.«
Leonard würfelte und komplettierte seinen Viererpasch. Als er seinen Tee trank, der unversehens kalt geworden war, erwischte er nur die eklige Neige.
»Du hast gestern Abend nicht zufällig die Doku über Edwin Hubble gesehen?«, fragte Paul, jetzt so richtig in Fahrt. »Dad und ich haben sie nach dem Judo geschaut, während Mam mit Grace telefoniert hat. Ich muss zugeben, dass das Weltall für mich ohne Fernsehen ein Buch mit sieben Siegeln wäre. Dem Himmel sei Dank, dass es so viele enthusiastische Oxford-Dozenten gibt, die nebenbei diese ganzen BBC-Dokus machen – vermutlich verdienen sie sich damit ein bisschen Taschengeld. Fernsehen und das Weltall sind wie füreinander gemacht. Dad und ich waren so darin vertieft, dass wir eine ganze Toblerone verputzt haben – eine von den großen, die man nur am Flughafen kriegt.«
»Schade, dass ich die Sendung verpasst habe. Da gibt es etwas, das ich bei meinen Lexikoneinträgen nie so ganz genau erfasst habe, obwohl ich immer wieder darüber lese: wie sich das All ausdehnt und wieder in sich zusammenfällt«, gestand Leonard. »Ich meine, die physikalischen Zusammenhänge kann ich ansatzweise verstehen, aber es übersteigt meine Vorstellung, dass das Universum von etwas umgeben sein soll, das nicht das Universum ist und in das hinein es sich ausdehnt – oder ist es so, dass sich das Universum nicht ausdehnt, sondern das All? Wie soll man Kindern das erklären, ohne dass sich bei ihnen gleich eine Million unbeantwortete Fragen auftun? Ganz zu schweigen von den Ängsten, die jedes normale Kind empfinden muss, wenn es hört, dass das Universum wie ein Gummiband zurückschnellen und auf Nadelkopfgröße schrumpfen könnte. Wie können wir herumlaufen und unser alltägliches Leben führen, obwohl wir wissen, dass über unseren Köpfen solche Sachen passieren? Wenn wir uns mal klarmachen würden, dass das ganze Ding irgendwann auf einen winzigen Punkt zusammenschrumpfen wird, würden wir uns alle vermutlich nicht so anstellen. Wahrscheinlich muss man einfach der Wissenschaft vertrauen, ab einem bestimmten Punkt bleibt nichts anderes, als blind daran zu glauben, zumindest erlebe ich es so.«
Paul runzelte die Stirn. »Ehrlich gesagt finde ich die ganze Ausdehnung des Universums ziemlich entmutigend. Es scheint fast, als würde Mutter Natur alles von allem wegschieben. So richtig mütterlich ist das nicht. Das Universum mag sich ja ausdehnen, aber das tut es, um sich von uns zu entfernen, und damit lässt es uns im Stich und macht unsere Welt noch kleiner.«
Die beiden Freunde versanken in ausgedehntes Schweigen, was typisch war für die Art, wie sie einander mit ihrer Gesellschaft Trost spendeten. Sie konnten längere Zeit in kompletter Stille dasitzen und kehrten danach nicht etwa hastig zu ihrer früheren Aktivität zurück, sondern ließen ihr Schweigen auf ganz natürliche Weise ausklingen. Dieses Mal hatte Paul jedoch mit seiner spontanen Äußerung zur Astrophysik bei Leonard eine melancholische Saite zum Klingen gebracht. In den Wochen seit dem Tod seiner Mutter hatte er eine deutliche Schrumpfung seines persönlichen Universums bemerkt. Seine Abende blieben ungefüllt, seine sozialen Möglichkeiten eingeschränkt, und sein Verstand wandte sich immer weiter nach innen, einer vagen, traumgleichen Melancholie zu. Als Paul aufstand, um erneut den Wasserkocher einzuschalten und die Becher auszuwaschen, sprach Leonard dieses Thema an.
»Vielleicht bezieht sich das mit der Ausdehnung und dem Schrumpfen nicht nur aufs Universum«, sagte er. »Womöglich gilt das ja auch für uns, weißt schon, dass unser Alltag schrumpft, je älter wir werden.«
»Wie meinst du das?«
»Also als Kind kommt einem die Welt riesig vor, so groß, dass es einen mit Ehrfurcht erfüllt. Die Schule sah groß aus. Erwachsene auch. Die Zukunft. Aber ich habe das Gefühl, ich habe mich mit der Zeit immer mehr zurückgezogen, meine Welt kleiner gemacht. Ich sehe die Menschen rumrennen und frage mich: Wo wollen die alle hin? Wen treffen sie? Ihr Leben ist prallvoll. Ich versuche mich zu erinnern, ob mein Leben je so war.«
Paul überlegte einen Moment. »Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich hatte schon immer ein Problem mit der Größe der Welt. Ich habe über drei Jahrzehnte damit verbracht, mir einen sicheren Weg durch die Wildnis zu bahnen, genau wie du auch, zumindest teilweise. An manchen Stellen ist der Pfad vielleicht ein bisschen schmal, aber ist das wirklich so schlimm?«
»Es sind nicht nur die äußeren Umstände«, antwortete Leonard. »Ich spüre, dass auch ich schrumpfe. Ich komme mir stiller vor und, keine Ahnung, irgendwie unsichtbarer. Das ist wie Physik, eine Kraft, die mein Leben ständig nach innen zieht. Ich habe die Dinge laufen lassen, und wenn ich jetzt nichts unternehme, führe ich irgendwann eine harmlose Randexistenz.«
»Das hat auch seine Vorteile. Wie du weißt, halte ich es mit Hippokrates: Ich möchte niemandem Schaden zufügen. Mir ist es lieber, mich im Hintergrund zu halten. So ähnlich wie bei der Verkehrserziehung: Ich warte erst mal, schau gut hin und höre zu, bevor ich loslege. Das hat bis jetzt immer gut funktioniert und mir einen friedlichen Umgang mit meinen Mitmenschen beschert. Es ist auf jeden Fall besser, als auf der Welt Spuren zu hinterlassen, die sie am Ende nur verunstalten«, sagte Paul.
»Ich habe nicht vor, mich an Geländer zu ketten oder Polizisten mit BHs zu bewerfen, falls du das meinst. Es gibt genug Menschen, die so was tun. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass ich die Türen und Fenster in meinem Leben ein bisschen aufschieben muss.«
Paul zögerte, er hatte seinen Keks zu lange über dem Tee gehalten und musste jetzt tatenlos zusehen, wie ein halbmondförmiges Stück davon abbröckelte und auf den Boden seines Bechers sank. »Das mag sein«, sagte er schließlich, »aber die Kunst besteht darin, genau zu erkennen, wie viel von der Welt man in sein Leben lassen kann, ohne davon überwältigt zu werden. Wie Edwin Hubble schon sagte, das Universum ist feindliches Terrain.«
»So ist es. Und manchmal weiß man nicht, ob man schreien oder sich lieber die Ohren zuhalten will«, sagte Leonard.
Womöglich lag es am Yahtzee, dass die beiden Männer eine dieser produktiven Unterhaltungen führten, bei denen ein Gedanke den nächsten befruchtete. Wäre es hier um reine Hypothesen gegangen, hätten sie das Thema den ganzen Abend weiterdiskutieren können. Weil die Dinge aber anders lagen, nutzten sie die willkürlich eintretende Unterhaltungspause dazu, sich auf sich selbst zu besinnen. Sogar unter engen Freunden gibt es immer noch Gedanken, die im Privaten heranreifen sollten.
Nachdem sie ihren Tee getrunken hatten, kamen beide zu der stillschweigenden Übereinkunft, den vergnüglichen, von wild vollgekritzelten Yahtzee-Zetteln begleiteten Spieleabend zu beenden und einander eine gute Nacht zu wünschen.
Leonard streckte den Kopf zur Wohnzimmertür herein, um sich von Pauls Eltern zu verabschieden. Helen hatte ihr Puzzle fertig – Wasserlilien von Monet, über das Bild hatte Leonard einen Lexikoneintrag für die Ausgabe Welt der Kunst geschrieben – und telefonierte nun mit Pauls Schwester Grace, sie sprachen über DJs für die Hochzeitsfeier. Peter hatte den Fernseher mit engelsgleicher Geduld erneut auf Pause gestellt und verabschiedete sich, indem er beide Daumen reckte.
Paul brachte Leonard zur Tür.
»Na dann, gute Nacht«, sagte Leonard.
»Gute Nacht, Leonard«, sagte Paul, das Revers seines Judo-Bademantels enger zugezogen, um sich nicht die Brust zu verkühlen.
Unversehens richteten beide den Blick auf ebenjenes tintenschwarze All, über das sie gerade noch gesprochen hatten, während der Mond wie eine riesige Taschenlampe die kreuz und quer über die Auffahrt kriechenden Schnecken beschien. Leonard trat über sie hinweg und machte sich auf den Heimweg, die ausgesprochenen Gedanken des vergangenen Abends im Gepäck: Dinge, von denen er nicht gewusst hatte, dass er sie wusste.
3
DIE RÖMER
Am nächsten Tag, auf der Arbeit, bemühte Leonard sich, sein Kapitel über die Römer in Britannien zu retten. Die überarbeitete Fassung der als Autorin verantwortlich zeichnenden Akademikerin war eingetroffen, ein veritables Blutbad. Nachdem Leonard alle Änderungen angenommen hatte, um überhaupt zu erkennen, woraus sie bestanden, stellte er fest, dass der Inhalt so geschrumpft war, dass er nun auf einem Glückskekszettel Platz finden würde.
Kommentare wie »Können wir hier was Originelleres finden?« oder »Würde man das wirklich so sagen?«, in denen vage Enttäuschung mitschwang, waren völlig normal für die verantwortlichen Akademiker, die vielleicht viel von ihrem Fachgebiet wussten, aber nichts vom kindlichen Verstand oder schriftstellerischen Gemüt. Für das Ping-Pong-Spiel mit den nachverfolgten Änderungen brauchte man ein ziemlich dickes Fell. Leonard hatte oft das Gefühl, man bezahle ihn für seine Duldsamkeit. Sein Bestes zu geben fiel ihm schwer, denn er wusste genau, was passieren würde: Man würde seine Ideen ablehnen, ohne sie zu verstehen, oder sie übernehmen, um sie als die eigenen auszugeben. Er versuchte, sich auf den einstigen Rat seiner Mutter zu besinnen, seine Arbeit zwar ernst, aber nie persönlich zu nehmen.
Im Allgemeinen waren Geschichtslexika für Kinder nicht so beliebt oder gut wie andere Sachbücher. Die besten Illustratoren wollten Bücher über Dinosaurier bebildern (sofern sie von Hand malten) oder Bücher übers Weltall (sofern sie Grafikprogramme verwendeten). Geschichtslexika waren offenbar nur für Illustratoren mit Einzeltalenten interessant. Es gab solche, die Menschen nur von vorn malen konnten, sodass ihre Figuren den Betrachter direkt anstarrten, was im Schlachtgetümmel und bei Kampfszenen ziemlich lächerlich wirkte. Andere waren nicht in der Lage, Menschen unterschiedlicher Nationalitäten zu zeichnen, und verlegten sich daher darauf, sämtliche Personen mit demselben, leicht grimmigen Ausdruck auszustatten, weil sie in ihrer Einfältigkeit erkannt zu haben meinten, dass wütende Menschen auf der ganzen Welt gleich aussähen.
Die Römer stellen eine besondere Herausforderung dar. Alles, was sich zwischen »vor Christus« und »nach Christus« abgespielt hat, kann man Kindern eigentlich nicht erklären. Denn eine Achse, auf der man die Zeit erst rückwärts bis null und dann wieder vorwärts erfasst, ist für Kinder, die Zeit an ihren Geburtstagen abmessen, unendlich verwirrend. Außerdem haben die Römer lange Namen, mit denen man sich nicht identifizieren kann, und die einzige Möglichkeit, das Problem mit den Namen zu überwinden, nämlich ihre Verballhornung, wurde leider bereits von Asterix und Monty Python verwendet. Ja, es gab die üblichen Klischees über die lateinische Sprache, Aquädukte, schnurgeraden Straßen und Sklaven, aber das alles hatte man schon so oft gehört, dass es gegen den Tyrannosaurus Rex oder die Explosion bei der Entstehung einer Supernova keine Chance hatte.
Leonards wahres Problem mit den Römern bestand jedoch darin, dass sie es grundsätzlich auf Schwächere abgesehen hatten. Vierhundert Jahre lang hatten sie alle anderen gepiesackt und schließlich nur ihr Ende gefunden, weil sie selbst den Goten und Barbaren zum Opfer gefallen waren. Für Kinder ist eine solche Geschichte ziemlich beunruhigend. Eigentlich hofft man doch, dass so einem Piesacker ganz schnell der Garaus gemacht wird und er seine gerechte Strafe bekommt. In Wahrheit sind gerechte Strafen in der Geschichte der Menschheit aber leider Mangelware.
Weil ihm die Ideen ausgingen, nahm Leonard seine Noise-Cancelling-Kopfhörer ab, die ihn zuverlässig vor Lärm und menschlicher Gesellschaft schützten, und schlenderte in die Büroküche, um sich seinen vormittäglichen Becher Tee zu kochen, obwohl er es nicht mochte, verdruckst herumzustehen und Smalltalk zu machen, bis der Wasserkocher brodelte.
Als er sein Handy checkte, stellte er fest, dass er einen Anruf von einer Festnetznummer verpasst hatte, also ziemlich sicher von Paul, der kein Mobiltelefon hatte und gern endlos lange Nachrichten auf der Mailbox hinterließ:
Leonard, hallo. In einer Welt, in der die Menschen gegen Zahlen antreten müssen, scheint es mir, als würden die Zahlen stets gewinnen.
Am Anfang klang Paul oft kryptisch und epigrammatisch wie ein Autor bei seinem Debütroman.
Normalerweise bespreche ich heikle Angelegenheiten gern unter vier Augen, aber ich glaube, ich hinterlasse dir jetzt lieber eine Sprachnachricht, statt auf unser nächstes Treffen zu warten.
Leonard fiel auf, dass Paul wie immer einwandfreie Manieren an den Tag legte.
Meine Mutter und Grace haben bezüglich der Hochzeit alles durchgesprochen, in aller epischen Breite und bis ins letzte Detail, und wie sich herausstellte, wird es mit der Gästeliste ziemlich eng. Ich meine, es handelt sich hier um eine Hochzeit mit »ungefähr hundert Gästen«, so haben sie es mir jedenfalls erklärt, aber ich habe keine Ahnung … *Piep*
Leonard war es gewohnt, dass Pauls Nachrichten den vorgegebenen Zeitrahmen sprengten und meist im Serienformat bei ihm eintrafen.
Tut mir leid, aber ich muss mich wirklich bemühen, schneller zur Sache zu kommen, daher hoffe ich, das klingt jetzt nicht zu brüsk.
Das letzte Wort war neu und leitete bei Paul gewöhnlich eine Ära ein, in der er es öfter verwenden würde.
Hundert bedeutet im Endeffekt fünfzig für die Braut und fünfzig für den Bräutigam, in Wahrheit aber fünfundzwanzig für jeden, plus deren Partner. Während es völlig hinnehmbar ist, dass diejenigen außerhalb des unmittelbaren Familienkreises nicht mehr dazuzählen, müssen sie, ich meine, müssen »wir« – man hat mich angewiesen, unbedingt »wir« zu benutzen – dafür sorgen, dass die Zahlen aufgehen, wie man so schön sagt. *Piep*
Während die nächste Sprachnachricht lud, bereitete sich Leonard mental auf eine Herabsetzung vor, eine Einladung zum Empfang nach der Hochzeit, was bedeuten würde, dass er die schönen Momente verpasste und stattdessen dem späten, versoffenen Teil der Feier beiwohnen müsste, den er verabscheute. Viel Spielraum blieb ihm nicht, das Hochzeitsgeschenk entsprechend zu verkleinern, ohne gekränkt zu wirken.
Also habe ich mich, beziehungsweise wir, uns gefragt, ob du planst, eine Begleitperson mitzubringen, weil ich schon zugesagt habe, dass ich aus unterschiedlichen Gründen am betreffenden Abend ohne Begleitung komme, und falls du dich in einer ähnlichen Situation befinden solltest, könnten wir die jeweilige Begleitperson füreinander sein, was zwei Plätze freimachen würde für Gäste, ohne die die gesamte Hochzeitsfeier etwas »angespannt« wäre, wie Grace es ausgedrückt hat. Unter diesen Umständen und angesichts der Tatsache, dass Grace mich noch nie um etwas gebeten hat, möchte ich ihr keine unnötigen Probleme machen, also könntest du vielleicht darüber nachdenken und mich bei Gelegenheit zurückrufen. Ich möchte nicht, dass du denkst … *Piep*
Keine weiteren Nachrichten. Die Entscheidung war leicht. Das letzte Mal, als Leonard für jemanden die Plus eins gegeben hatte, lag schon lange zurück. Genauer betrachtet stand er in letzter Zeit dermaßen neben sich, dass man ihn mittlerweile eher als »Minus eins« bezeichnen könnte. Es war ohnehin eher eine Formalität, dass die Einladung für ihn und eine Begleitperson ausgestellt war.
Als Leonard zurückrief, hatte er Helen am Apparat, der die Angelegenheit zwar ein bisschen peinlich war, die seinen Vorschlag, als Pauls Begleitperson zu erscheinen, aber ohne Gegenrede akzeptierte. »Solange ich kein Kleid tragen und mit ihm tanzen muss … Wer weiß, vielleicht bin ich deine neue Schwiegertochter!«, sagte Leonard munter.
»Danke für dein Verständnis, Leonard. Wir waren nicht sicher, wie wir dich am besten fragen sollten, daher bin ich heilfroh, dass es dir nichts ausmacht.«
»Überhaupt nicht, kein Problem. Bestell Gracie einen lieben Gruß von mir … Hoffentlich ist sie nicht zu gestresst. Wir stehen alle hinter ihr.«
Als Leonard das Gespräch beendete, setzte er auch seine Munterkeitsmaske ab. Erst in der Büroküche, als er Helens aufrichtige Verlegenheit nachwirken ließ, begriff er, was gerade passiert war. Die »Begleitperson« auf seiner schon vor Wochen ausgestellten Einladung war sicher für seine arme Mutter gedacht. Dieser Gedanke versetzte ihm einen dumpfen Schlag, dem er nicht weiter nachspüren konnte, denn gleich darauf kam ein Mann in Chinos herein und gab missbilligende Geräusche von sich, weil alle Becher zum Einweichen in der Spüle standen. Leonard, der es plötzlich sehr eilig hatte, zu seinen Kopfhörern zurückzukehren, stellte die Teedose zurück und rührte ein letztes Mal in seiner spürbaren milchtrüben Einsamkeit herum, bevor er fluchtartig die Küche verließ.
4
GRACE
Wenn es einen Vorfall gibt, der die Beziehung zwischen Grace und Paul am besten charakterisiert, dann wohl der Folgende: Als Paul noch klein war, bekam er zum Geburtstag eine Karte mit fünf Euro. Den Geldschein stopfte er sich gleich in diese seltsame kleine Innentasche seiner Jeans, eng und unpraktisch, gerade breit genug für einen Finger. Grace, drei Jahre älter, zog mit ihm los, weil ihr kleiner Bruder sein Geld für diverse Süßigkeiten und Comics verbraten wollte. Auf dem Weg traf Paul einen Nachbarsjungen, einer dieser kleinen Angeber vom Fußballplatz, die ihn normalerweise ignorierten oder Schlimmeres, und rief ihm aufgeregt zu, weil er ihm endlich auch mal was Tolles zeigen konnte. Doch bei dem Versuch, den Geldschein aus der lächerlichen Tasche zu ziehen, riss Paul ihn glatt entzwei. Der andere Junge schnaubte verächtlich, versetzte seinem Fußball einen Tritt und jagte ihm hügelabwärts hinterher. Paul stand verdattert da, vor Enttäuschung wie gelähmt. Bevor er sein neuestes Missgeschick verarbeiten konnte, hatte Grace ihm schon den zerrissenen Schein abgenommen und ihn durch einen neuen ersetzt. Paul setzte dem Jungen sofort nach, vor lauter Begeisterung vergaß er sogar, sich bei Grace zu bedanken, die ihm rasch folgte, damit er nicht ohne zu schauen über die Straße rannte.
Wie alle Erstgeborenen war auch Grace eine Weile Einzelkind gewesen und hatte sich im warmen Licht ungeteilter elterlicher Liebe gesonnt, doch als Paul wegen einiger Zusatzuntersuchungen mit leichter Verzögerung aus der Klinik nach Hause kam, empfing Grace ihn mit aufrichtiger schwesterlicher Begeisterung. Als er laufen lernte, war Grace schon alt genug, um ohne elterliche Aufsicht ein bisschen auf ihn achtzugeben, was für gewöhnlich so aussah, dass sie ihn vor sich selbst rettete, denn er war so ein Junge, der seine Finger in den Türspalt oder den Kopf zwischen die Stäbe des Treppengeländers steckte oder Weingummis unzerkaut herunterschluckte.