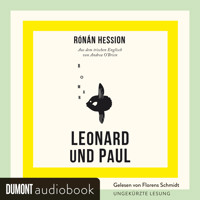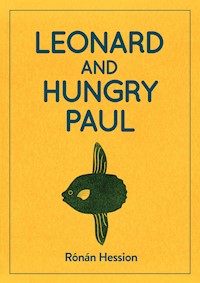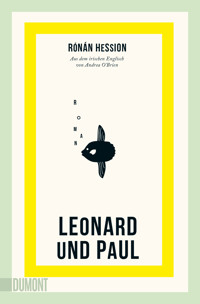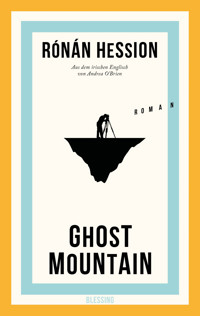
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl Blessing Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der neue Roman vom Autor des Indie-Lieblings „Leonard und Paul“
Wo zuvor nur Felder waren, steht plötzlich über Nacht ein Berg und verändert das Leben der umliegenden Gemeinde. Anhand eines Reigens ganz gewöhnlicher und doch einzigartiger Charaktere erkundet dieser feine Roman die Gipfel und Abgründe des menschlichen Daseins. Warmherzig, humorvoll, weise, zart und geradezu im Vorbeigehen macht er dabei ganze Welten auf.
»Auf mal entzückende, mal lustige, mal erschütternde Weise zeigt Hession, dass unser eigenes Leben genauso unerklärlich und geheimnisvoll ist wie dieser magische Berg.« THE GUARDIAN
»Hession erinnert an Murakami, bevor er berühmt, und an Beckett, nachdem er ein Adjektiv wurde. (…) Was für ein Glück, dass solche Bücher noch geschrieben werden.« THE IRISH TIMES
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Der Autor
Rónán Hession, geboren 1975, lebt als Schriftsteller und Musiker in Dublin. Unter dem Namen Mumblin’ Deaf Ro hat er drei Musikalben produziert. Die letzte Veröffentlichung, »Dictionary Crimes«, wurde für den »Choice Music Prize« (Album des Jahres) nominiert. Sein international gefeierter Debütroman »Leonard und Paul« war u. a. auf der Shortlist der »Irish Book Awards« (Newcomer of the Year 2019) und stand in Deutschland auf der Shortlist für das »Lieblingsbuch der Unabhängigen« 2023.
Die Übersetzerin
Andrea O’Brien übersetzt seit vielen Jahren zeitgenössische Literatur aus den englischen Sprachen und wurde für ihre Arbeit bereits mehrfach ausgezeichnet. Sie lebt und arbeitet in München.
RÓNÁN HESSION
GHOST MOUNTAIN
ROMAN
Aus dem irischen Englisch von Andrea O’Brien
Blessing
Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel GHOSTMOUNTAIN bei Bluemoose Books, Hebden Bridge.
Die Arbeit der Übersetzerin an diesem Roman wurde mit einem Stipendium des Deutschen Übersetzerfonds e. V. gefördert.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2024 by Rónán Hession
Copyright © 2024 der deutschsprachigen Ausgabe by Karl Blessing Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München
This edition published by arrangement with Agence Deborah Druba. All rights reserved.
Redaktion: Claudia Alt
Umschlaggestaltung: Designbüro Lübbeke Naumann Thoben
Umschlagabbildung: © Depositphotos/Oorka5
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-32315-8V001
www.blessing-verlag.de
Dieses Buch ist meiner Frau Sinéad gewidmet, von ganzem Herzen, immer.
BUCH 1
Ghost Mountain
Es war, im gewöhnlichen Sinne dieses Wortes, ein Berg. Er trat aus der umliegenden unspektakulären Landschaft hervor, zwar höher als alles drum herum, aber nicht besonders hoch. Napfschneckenförmig mit kahler Kuppe, rundlich wie ein Knie. Allen Seiten zugewandt, ohne einer Richtung den Vorzug zu geben, wie es Berge nun mal so an sich haben. Zwar stand er Wind und Licht im Weg, lockte damit aber auch deren besonderes Naturell hervor. Licht, sanft und friedfertig, begegnete dem Berg mit Schatten und Kontrast, wohingegen Wind, stets wankelmütig, sich oft an ihm abarbeiten musste. Aus einem bestimmten Betrachtungswinkel schien der Berg zwei Mulden zu haben, sie gähnten wie zwei abgesackte Augenhöhlen mitten im Hang. Eine dritte Mulde lag dazwischen, aber etwas unterhalb der beiden ersten, was ihm einen geisterhaften Ausdruck verlieh, obwohl sich der Berg streng gesagt nicht ausdrückte. Wenn die Zeit gekommen wäre, ihm einen Namen zu geben, sollte man ihn dieser Mulden wegen Ghost Mountain nennen.
Zu behaupten, ein Berg sei dieses oder jenes. Ihm physische oder metaphysische Eigenschaften zuzuschreiben. Ihn zu definieren, indem man ihn gegen das abgrenzt, was er nicht ist – das alles sind Gepflogenheiten des menschlichen Geistes, daher kann man mit Fug und Recht behaupten, dass solcherlei Bemerkungen mehr über den Beschreibenden aussagen als über Ghost Mountain selbst. Ghost Mountain besaß keinen Geist. Er definierte sich nicht. Er hatte weder Selbst noch Selbstwahrnehmung. Ghost Mountain war Ghost Mountain.
Wir wissen nur, dass er gestern erschienen ist.
Ocho
Ocho betrachtete seine Frau. In diesem Moment erschien es ihm unbegreiflich, wie eigenartig die Menschen doch waren.
Ihr Name war Ruth.
Sie las auf ihrem Handy, das sie an beiden Seiten wie ein aufgeklapptes Buch festhielt.
Die von ihr gekochte Suppe stand vor ihnen auf dem Tisch. Ocho hatte zu essen begonnen, ohne auf Ruth zu warten.
Als er sie ansah, kam ihm der Gedanke, dass sie nicht an ihn dachte. Dass ihn dieser Gedanke mit ihr verband und gleichzeitig von ihr trennte. Das bewegte ihn auf neue, bedeutsame Weise. Wo genau bewegte es ihn, körperlich betrachtet? Er ging in sich. Da war so ein Gefühl im Bauch, irgendwo zwischen den dort reingequetschten Organen. Seine Gedanken waren anscheinend mit seinem Bauch verbunden. Der Darm sei das zweite Gehirn, hieß es, er habe mehr Nervenzellen als ein Rattenhirn.
Während er nachgedacht hatte, war die Suppe in seinem Mund abgekühlt und glitt jetzt schleimig seinen Schlund hinab. Hinab zu diesen Nervenzellen. Hinab zu diesem Rattenhirn.
Ruth
Was hatte Ruth auf ihrem Handy gelesen? Ruth hatte über Ghost Mountain gelesen, obwohl der zu diesem Zeitpunkt noch nicht unter diesem Namen bekannt war. Im Artikel stand, der Berg sei in einem Feld erschienen, unweit von dort, wo Ruth und Ocho wohnten. Der Berg sei erschienen. Wie war das gemeint? War er schon vorher da, wurde aber erst jetzt entdeckt? Hatte eine tektonische Verschiebung die Landschaft zeltartig aufgeworfen, sodass ein neuer Gipfel entstanden war? Der Artikel drückte sich nicht klar aus. Auch nach mehrmaligem Durchlesen wurde sie daraus nicht schlau.
Als Ruth den Kopf hob, um Ocho zu fragen, bemerkte sie, dass er sie anstarrte. Seine Miene war ernst und unverstellt. Ocho neigte dazu, überbesorgt zu sein. Das lag daran, dass er eine junge Seele war. So hatte es ihre Mutter immer ausgedrückt. Eine junge Seele war nicht dasselbe wie ein junger Mensch. Eine junge Seele war eine Seele, die nur ein paarmal oder ein paar Hundert Male gelebt hatte. Sie stand mit der Welt im Widerstreit und fand alles schwierig. Junge Seelen empfanden alles als problematisch. Ihr Alltag war konfliktbehaftet, weil die Welt nicht so war, wie sie sie gern hätten. Eine alte Seele hingegen hatte schon unzählige Leben hinter sich. Sie stand mit der Welt im Einklang, hatte genug von ihr in sich aufgenommen, dass zwischen ihr und der Welt kein nennenswerter Unterschied mehr bestand. Dies sorgte für größere Harmonie. Als Kind hatte ihre Mutter ihr oft gesagt: »Weißt du, was du bist, Ruth? Du bist eine alte Seele.« Damals erfuhr Ruth alles über junge und alte Seelen.
Seit Kurzem fragte sie sich, was diese Gegensätzlichkeit für ihre Ehe bedeutete. Im Kleinen war Ocho schwierig. Unwichtiges fand er bemerkenswert. Er kritisierte sie wegen nichtiger Alltäglichkeiten. Doch irgendwann hatte sie verstanden, dass seine eine junge Seele war, im Gegensatz zu ihrer alten Seele, und seither wusste sie, dass ihre Konflikte unausweichlich waren und eine Lösung unzählige Lebenszeiten dauern würde. Dass sie dies hinnahm, bewies ihrer Meinung nach wiederum ganz klar, dass sie tatsächlich eine alte Seele war. Dieser Gedanke tröstete sie wie die warme Suppe, die sanft in ihren ruhigen Magen hinabglitt.
Die Entdeckung von Ghost Mountain
Ghost Mountain wurde von einer Frau beim Gassigehen entdeckt. Sie hatte ihren Hund immer schon dort ausgeführt, selbst nachdem der Grundbesitzer sie lauthals darauf hingewiesen hatte, dass sein Land kein öffentlicher Durchgang sei. Diese Einschätzung teilten auch die Gerichte. Die Frau war zwar dagegen zu Felde gezogen, hatte sich auf Gebrauchsrecht, Sitten und Traditionen, Landrecht, Mundraub und andere abstrakte juristische Konstrukte ungefährer Natur berufen, was die Richterin aber leider wenig beeindruckt hatte.
Irgendwann war der Grundbesitzer gestorben, sein Land hatte er seinem Sohn vermacht, der sich von ihm entfremdet hatte und schon vor Jahren ausgewandert war. Der Besitz umfasste im Wesentlichen einen Flickenteppich aus mehreren unverbundenen und unbeackerten Feldern. »Was soll ich damit anstellen?«, fragte sich der von seinem Vater entfremdete Sohn. »So ein Flickenteppich.« Aufgrund der Entfremdung von seinem Vater sah er sich nach dessen Ableben mit einem weiteren Flickenteppich konfrontiert, lauter unverarbeitete Gefühle und so weiter. Doch nach dem Streit, der einst Anlass ihrer Entfremdung gewesen war, hatte sich der Sohn geschworen, fortan einen großen Bogen um Metaphern zu machen, daher weigerte er sich, einen Zusammenhang herzustellen zwischen dem Flickenteppich aus Feldern, seiner Beziehung zu seinem Vater und seinen Gefühlen nach dessen Tod. Stattdessen beschloss er, die geerbten Felder nicht zu beackern und sie verwildern zu lassen, wobei er sich wiederum jeglicher metaphorischen Bedeutung verschloss, die von seinem Nichthandeln ausgehen mochte.
Und so nutzte die Frau beim Ausführen ihres Hundes das Land nun quasi als öffentlichen Durchgang, wenn auch nicht von Rechts wegen, und ließ ihren Hund frei laufen, auf den unbeackerten Feldern, wo er herumtollte und seine Blase entleerte, bevor er glücklich heimtrottete.
Sie hatte den Berg schon fast bestiegen, als sie spürte, dass Ghost Mountain – wie er später genannt werden sollte – ihr dieses Mal ganz schön zusetzte. Mit brennenden Oberschenkeln und Waden unterbrach sie ihre morgendlichen Betrachtungen, um sich genauer zu orientieren. Das Feld sah anders aus als sonst, daher dachte sie zuerst, sie hätte sich verlaufen. Weiter hinten erspähte sie die Straße und, in der Ferne, das Dach ihres Hauses, das normalerweise von hier aus nicht auszumachen war.
Während sie darüber nachgrübelte, kam ihr Hund herbeigelaufen, doch ohne sein typisch verspieltes Scharwenzeln. Da war kein Schwanzwedeln, nur ein trunkenes Schweifen. Sein Kopf war gesenkt, und statt wie sonst zufrieden zu hecheln, wirkte der Hund ungewöhnlich still. Ein Tennisball, den er in einem Graben gefunden hatte, steckte ihm in der Kehle.
Die Frau schob ihm die Finger tief ins Maul, doch der Ball war schon zu weit nach hinten gerutscht und steckte dort fest. Es gab keinen Zwischenraum, in den sie die Finger hätte zwängen können, ihre Versuche hatten den Ball wahrscheinlich nur noch tiefer in den Schlund gedrückt. Sie stellte sich hinter ihn und trieb ihm die geballten Fäuste in den Bauch, um den Ball per Heimlich-Manöver herauszubefördern, doch vergeblich. Der Hund wurde schwächer und konnte sich schon bald nicht mehr auf den Beinen halten. Schließlich setzte sie sich neben ihn und streichelte ihm über die Flanke, während er langsam in die Bewusstlosigkeit glitt. Als Kind hatte sie mehrere Hunde verloren. Ihre Eltern hatten ihr immer erzählt, der jeweilige Hund sei »ins Land gegangen«, was sie seltsam fand, denn so ein Land voller Hunde hatte sie noch nie gesehen. Dies war allerdings der erste Hund, der vor ihren Augen gestorben war.
Sie hatte ihre liebe Mühe, den Hund nach Hause zu transportieren. Es war ein würdeloses Unterfangen. Sie hatte ihn auf den Rücksitz ihres Kleinwagens verfrachtet und zum Tierarzt gebracht, der nichts mehr tun konnte.
Daher ist es nur zu verständlich, warum sie, als sie in jener Nacht allein im Bett lag, nicht an den später sogenannten Ghost Mountain gedacht und auch niemandem davon erzählt hatte.
Iah
Ocho und Ruth lagen Seite an Seite im Bett. Sie trug weite Pyjamas, er Boxershorts und Unterhemd. Sie hatten sich gerade vereinigt oder »Iah« gehabt, wie sie es oft nannten.
Als Ocho klein war, hatte seine Mutter ihn dabei überrascht, wie er sich im Privaten erforschte, und fluchtartig das Zimmer verlassen. Er war erstarrt, mitten in der Bewegung, bei der sie ihn überrascht hatte. Das war einer dieser Momente gewesen, bei denen man schon im Voraus ahnte, dass er Folgen haben würde. Ocho hatte seine Tage schon eine Weile auf diese Weise begonnen. Dabei verspürte er nie Scham, aber nach dem Vorfall mit seiner Mutter reifte in ihm die Erkenntnis, dass Scham durch die Beziehung zwischen unseren Handlungen und anderen Menschen entstand. Und so empfand er beim Frühstück und später, als sie in seinem Zimmer seinen Wäschekorb leerte, tiefe Scham. Seine Mutter hingegen schützte unerschütterliche Normalität vor, wohl um ihm zu signalisieren, dass sich von ihrer Seite nichts geändert hatte. Ohne es selbst vollständig zu erkennen, brachte sie ihm so das Verleugnungskonzept der Erwachsenen bei. Dieses unterscheidet sich grundsätzlich vom Verleugnungskonzept der Kinder, denen es darum geht, etwas vor Erwachsenen nicht zuzugeben. Bei der Verleugnung der Erwachsenen geht es hingegen darum, etwas vor sich selbst nicht zuzugeben.
Später an jenem Abend kam sein Vater ins Zimmer und setzte sich auf Ochos Bett.
»Schläfst du gut?«, fragte er.
»Ja, sehr gut«, sagte Ocho.
Sein Vater gab ihm oft Rätsel auf. Obwohl er nicht im Militärdienst stand, trug er Militärkleidung. Er arbeitete bei der Straßenmeisterei, weswegen er oft nach Teer roch. An Straßenbaustellen hielt er die roten und grünen Schilder hoch. Militärkleidung trage er deshalb, weil sie strapazierfähig, bequem und für wenig Geld in Armeeläden zu erstehen sei, hatte er einmal erklärt. Selbst als er schon längst nicht mehr arbeitete, trug er sie weiter. Und roch immer noch nach Teer.
Einige Wochen lang klopfte Ochos Vater jeden Abend an seine Tür, um sich zu erkundigen, ob er gut schlafe. Ocho antwortete stets, ja, er schlafe gut, erwähnte dabei aber nicht, dass dies zum Teil daran lag, dass er seit Kurzem auch am Abend seiner Selbsterforschung nachging.
Nachdem sich nach einiger Zeit kein Fortschritt einstellte, trat seine Mutter eines Morgens, nachdem sie geklopft hatte, in sein Zimmer und verkündete, sein Vater werde mit ihm hinausgehen, damit er mehr über die Natur lerne. Dies entpuppte sich als Besuch auf dem Erlebnisbauernhof, den er auch jedes Jahr mit seiner Schulklasse besuchte.
Auf dem Erlebnisbauernhof angekommen, steuerte sein Vater zielstrebig auf den Eselstall zu und stützte sich mit den Ellbogen auf den Zaun der Koppel davor. Er hatte eine bedächtige Miene aufgesetzt.
»Eselsmilch ist viel besser als Kuhmilch. Da ist viel mehr Gutes drin und weniger Fett. Sie ist unserer Muttermilch am ähnlichsten.« Er wandte sich Ocho zu. »Weißt du, was ich meine?«
Ocho, der keine Ahnung hatte, sagte: »Ja.«
Sie warteten eine ganze Weile dort. Ocho fragte, ob er ein bisschen Gras ausrupfen und die Esel durch den Zaun damit füttern dürfe, doch sein Vater sagte: »Noch nicht.«
Irgendwann bestieg einer der Eselhengste eine Eselstute und stieß auf dem Höhepunkt einen geräuschvollen Eselslaut aus.
»Siehst du?«, fragte sein Vater geheimnisvoll. »Iah.«
Ocho nickte. »Iah.«
Er könne den Esel jetzt gern mit Gras füttern, sagte sein Vater dann.
Ocho hatte Ruth diese Geschichte nach einigen Dates erzählt, als ihr Sexleben bereits eine gewisse Regelmäßigkeit entwickelt hatte. Da sie sie lustig fand, wurde sie in den Fundus ihrer Insider-Beziehungswitze aufgenommen und gehörte schon bald zu ihrem normalen Sprachschatz.
In jener Nacht, als Ocho und Ruth nach dem Iah im Bett lagen, bemühte sich Ocho nach Kräften, sich nicht wieder zu übersorgen. Ruth war auf dem Rücken eingeschlafen. Auch er lag auf dem Rücken. Sie hatten Händchen gehalten, aber jetzt, da Ruth eingeschlafen war, hatte sich ihr Griff gelöst, daher war es eher so, dass er ihre Hand hielt. Ihm war schon klar, dass er so nicht schlafen könnte, aber aus unerfindlichen Gründen fand er nicht den richtigen Moment, seinen Griff zu lösen. Jedes Mal, wenn es so weit war, erschien es ihm leichter, auf den nächsten Moment zu warten. Zuerst versuchte er, die Momente zu zählen, dann, sie runterzuzählen wie bei einem Countdown. Irgendwann schlief er ein, doch auch seine Träume waren voller Überbesorgtheit. Beim Aufwachen fand er einen Becher Kaffee neben seinem Bett, und Ruth stand bereits unter der Dusche. Als sie sich danach im Bad die Haare trocknete, fragte er sie, ob sie beim Aufwachen Händchen gehalten hatten.
Ruth dachte, er mache einen Scherz.
Der neue Berg
Der Tod ihres Hundes führte bei der Frau zu einer emotionalen Entwurzelung, die wir als Trauer bezeichnen. Sie war es gewohnt, bei vielen praktischen Alltagsdingen wie dem Ausleihen einer Leiter auf die Unterstützung ihrer Nachbarn zählen zu können, aber wenn es um abstrakte Gefühle in ihren mannigfaltigen Facetten ging, haperte es bei praktisch veranlagten Menschen bisweilen ein wenig.
»Auf diese Leere war ich nicht vorbereitet«, sagte sie, als sie mit ihrem Nachbarn, einem Bauern, über den Hund sprach.
Der Bauer zertrümmerte gerade einen alten Öltank, unterbrach seine Arbeit aber, um ihr zuzuhören.
»Sie könnten sich einen neuen Hund anschaffen. Oder eine Katze. Katzen sind gut, mit denen muss man nicht raus«, sagte er, als ginge es darum, bei einem Eintopf Kohlrüben durch Steckrüben zu ersetzen.
An der Art, wie er dastand, den Vorschlaghammer in den ölverschmierten Händen, erkannte sie, dass er, nachdem er ihr Problem gelöst hatte, nun gern weitermachen wollte. Er war nach dem Tod seiner Frau am selben Tag zu seiner Arbeit auf dem Hof zurückgekehrt.
Beim Metzger sagte sie, dass sie nun keine Tüte mit Leber mehr brauche, weder diese Woche noch zukünftig, und erklärte ihm auch, warum. Der Metzger hatte selbst zwei Hunde und war – entweder aus logischer Konsequenz oder entgegen aller Intuition – im ganzen Ort als tierlieb bekannt. Es tue ihm leid, das zu hören, sagte er, während er ein Schweinenackensteak zurechthackte. Nicht jeder würde verstehen, was es heiße, einen Hund zu verlieren, sagte er, aber es sei immer ein herber Verlust. Die Frau hatte das Gefühl, endlich jemanden gefunden zu haben, der sie verstand, daher erzählte sie ihm die ganze Geschichte, während er ihr Fleisch verpackte und abwog und ihr den Schein in die Hand drückte, mit dem sie vorn an der Kasse zahlen sollte. Der Metzger legte größten Wert darauf, diese Vorgänge säuberlich zu trennen, entweder man kümmerte sich ums Fleisch oder ums Geld, beides ging nicht.
»Zuerst hab ich es gar nicht gemerkt«, sagte sie, »weil mich der neue Berg so abgelenkt hat.«
Der Metzger wollte mehr wissen über den neuen Berg.
Sie berichtete, was sie wusste, und nachdem der Metzger seine eingehende Befragung abgeschlossen hatte, riet er ihr dringend, den Vorfall zu melden. Es dauerte ein bisschen, bis sie verstand, dass er mit »Vorfall« den neuen Berg meinte und nicht den Erstickungstod ihres Hundes. Wiederum war sie mit der Denkweise praktisch veranlagter Menschen konfrontiert. Der Metzger hatte sich indessen bereits dem nächsten Kunden und dem Abwiegen des bestellten Hackfleischs zugewandt.
Der Frau war das Herz so schwer, doch es fand sich niemand, der es wiegen wollte.
Ocho war nicht immer so
Ruth lackierte sich die Fußnägel. Ocho hatte ihr gesagt, er werde sich während des Sonnenuntergangs draußen auf die Mauer setzen, wo er jetzt saß, aber mit dem Gesicht nach Osten, die Sonne im Rücken.
Ocho war nicht immer so, dachte Ruth.
Sie hatte ihn im Kino kennengelernt. Sie hatte eine Karte für einen europäischen Film gekauft, eine Betrachtung der Themen Trauer und Verlust mit ein bisschen Sex dazwischen. Verspätet war sie in den schon dunklen Kinosaal getreten und hatte sich zu ihrem Sitz vorgetastet, den Mantel hatte sie anbehalten. Die erste Szene spielte bei Nacht, ein Paar fährt bei strömendem Regen zu einer abgelegenen Hütte. Die nächste Szene, die beiden sitzen beim Frühstück auf der sonnigen Veranda, deutet an, dass sie in der Nacht miteinander geschlafen haben. Als es im Kinosaal wieder hell wurde, erkannte Ruth, dass alle Ränge bis auf den Platz neben ihr leer waren. Dort saß ein Mann. Bis zum Ende des Films hatten sie keinerlei Notiz voneinander genommen. Danach gingen sie auf einen Kaffee. Ihr gefiel seine Selbstsicherheit. Es war keine arrogante Selbstsicherheit, nein, ihr gefiel es einfach, dass er ein Mann war, der tagsüber allein ins Kino ging. Das ließ auf viele andere Eigenschaften schließen, die ihr gefielen.
Sie waren beide gleich groß, und Ruth wurde oft als hochgewachsen bezeichnet, etwas, das noch niemand über Ocho gesagt hatte. Sie fühlte sich nicht besonders stark zu ihm hingezogen, war aber schon seit einigen Jahren alleinstehend und der damit einhergehenden Mühe so langsam leid.
Ihre ersten Treffen drehten sich ums Essen und kamen ihr vor wie ein Rendezvous und nicht wie das wahre Leben. Nach einer Weile verlor sie das Interesse daran und vielleicht sogar an ihm. Sie hatte erwartet, dass er sie zu einer Tagesvorstellung ins Kino einladen würde, doch das tat er nicht. Immer wieder schlug er gemeinsame Mahlzeiten vor und sagte so was wie: »Essen müssen wir sowieso, dann können wir das auch gleich zusammen machen, oder?«
Irgendwann ergriff sie die Initiative und schlug vor, mitzukommen ins Kino, dort lief eine weitere europäische Betrachtung von Trauer und Verlust mit ein bisschen Sex dazwischen. Danach schliefen sie in seiner kleinen Wohnung miteinander. Er gestand, sich wegen der geringen Größe seines Heims geschämt zu haben. Nachdem Ruth beteuert hatte, das mit der Wohnung sei ihr egal, fühlte er sich akzeptiert und wurde lockerer. Er riss Witze und äußerte sich spontan. Er vertraute ihr seine Lebensziele an, obwohl er sicher war, dass sie sie albern finden würde. Sie versicherte ihm das Gegenteil. Wie sich herausstellte, waren seine Lebensziele tatsächlich albern, doch das sagte sie ihm nicht.
Ähnlich unsicher wirkte Ocho auch, als es darum ging, Ruth seinen Eltern vorzustellen. Sein Vater trage Militärkleidung und seine Mutter sei unergründlich, sagte er. Ruth lernte sie beide kennen und mochte sie. Danach sagte Ocho, er freue sich darüber, sei aber auch ein bisschen enttäuscht, weil seine Eltern Ruth lieber mochten als ihn. Darauf versicherte Ruth ihm, dass Eltern grundsätzlich die jeweiligen Freundinnen lieber mochten als die eigenen Söhne. So sei das einfach.
Während sie sich die Fußnägel lackierte, dachte sie, ja, vieles löste bei Ocho tiefe Unsicherheit aus, und von seiner Sicherheit im jeweiligen Moment hing es ab, in welcher Ocho-Qualität man ihn erwischte. Es gab keinen ersichtlichen Grund für seine Unsicherheit. Einmal hatte Ruth seine Mutter gefragt, ob er je auf den Kopf gefallen sei. Ochos Mutter hatte gelacht. Ochos Vater nicht. Dann fiel Ruth die Sache mit den jungen und den alten Seelen wieder ein. Sie erinnerte sich daran, dass es das Schicksal alter Seelen war, junge Seelen zu finden.
Ocho kam aus dem Garten ins Haus und erklärte, er sei ein bisschen geblendet vom Anschauen der Sonne und werde hochgehen, um sich auf den Sitzsack zu legen.
»Wenn meine Fußnägel trocken sind, bring ich dir ein bisschen Suppe, die ist von gestern noch übrig. Und Brot zum Tunken.«
»Die Farbe gefällt mir. Fleischrosa?«
»Koralle.«
»Ist das eine Farbe oder ein Ton?«
»So steht es einfach auf der Flasche«, sagte sie.
»Heutzutage geben sie jedem Ton einen Namen, aber nicht jeder Ton ist eine Farbe.«
Ruth war aufgefallen, dass Ocho oft bei Dingen, die ihn nicht mal interessierten, besonders pedantisch war.
»Möglich«, sagte Ruth, während sie sich auf den äußersten Fitzel ihres kleinen Zehs konzentrierte.
Zwischen ihnen breitete sich Schweigen aus.
»Ich bin immer noch ein bisschen geblendet«, sagte er. »Also …«
»Ich bring dir nachher Suppe«, wiederholte sie, ohne aufzusehen. »Und Brot zum Tunken.«
Ocho war nicht immer so: II
Ocho saß mit dem Rücken zur Sonne auf der Mauer und sah den Schatten beim Längerwerden zu. Die Baseballkappe trug er verkehrt herum, damit er im Nacken keinen Sonnenbrand bekam. Es ging ihm nicht darum, cool auszusehen.
Seit ein paar Tagen hatte er das Gefühl, neben sich zu stehen. Als würde er seine Gedanken oder sich selbst betrachten, statt er selbst zu sein. Wie gewöhnlich kreisten seine Gedanken bedeutungslos im großen leeren Wäschetrockner seines Hirns herum. Nur war es dieser Tage so, dass er nicht selbst in diesen Gedanken steckte, sondern sich wie ein Zuschauer vorkam.
Also saß er auf der Mauer und sah seinen Gedanken beim Kommen und Gehen zu. Sah sie in luftige Höhen aufschwingen, dann ins Rattenhirn seiner Eingeweide hinabsinken. Sah zu, wie das Rattenhirn Sorgenstoffe an die dort hineingequetschten Organe aussandte. Es war ihm alles zu dicht gedrängt. Seine Organe hatten keinen Platz. Seine Gedanken hatten keinen Platz. Er hoffte, er würde das alles zumindest so weit verstehen, dass er es Ruth erklären könnte. Er wusste nur, dass sich in der Welt irgendwas verschoben und bei ihm Selbstzweifel ausgelöst hatte. Die Grundfesten seiner Persönlichkeit waren erschüttert. Oberflächlich deutete nichts darauf hin, doch er spürte in sich einen feinen Riss, der ihn mit Sorge erfüllte. Diese Sorge sollte das dünne Mauerwerk der Selbstsicherheit zersetzen, das ihn zusammenhielt.
Er wandte sich der Sonne zu. Es lag in der Natur der Menschen, in die Sonne zu schauen, um zu erkennen, wie sie aussah. Herauszufinden, ob man davon tatsächlich erblindete. Bald schon tanzten ihm schwarze Punkte vor den Augen, es wurde unangenehm, doch er hielt es länger aus, als er von sich erwartet hätte. Während er die Sonne ansah, änderte sie abrupt die Farbe. Von fließendem Orange zu Weiß zu unregelmäßigen schwarzen Kreisen. Er versuchte, seinen Blick durch Blinzeln zu klären, doch er war geblendet. Dennoch wollte er warten, bis die Sonne versunken war. Er wähnte sich in einem Widerstreit mit der Sonne. Am Ende waren seine Augen aber nicht stark genug, um die Sonne so lange im Blick zu behalten, bis sie ganz hinter dem Horizont verschwunden war. Als er seine Kappe herumdrehte und den Rückweg ins Haus antreten wollte, tauchte die Sonne auf einmal hinter einem als Silhouette erkennbaren Berg ab, den Ocho noch nie zuvor bemerkt hatte.
Den Vorfall melden
Niemanden kümmert es, dachte die Frau, deren Hund erstickt war.
Sie war immer davon ausgegangen, gute Freunde und Nachbarn zu haben, doch das war jetzt vorbei. Jetzt glaubte sie, dass es niemanden kümmerte. Vielleicht lag es daran, dass es sie tatsächlich nicht kümmerte oder dass sie nicht wussten, wie wichtig es ihr war, oder womöglich wussten sie es doch, wollten aber nicht da reingezogen werden. Das sagte sie sich, laut. Sie führte oft Selbstgespräche. Früher hatte sie es »mit dem Hund reden« genannt.
Nach dem Metzgersbesuch kehrte sie heim, legte einen Teil des Fleisches in den Kühlschrank und verteilte den Rest auf Gefrierbeutel. Im Gefrierfach war jetzt so viel Platz. Fürs Abendessen öffnete sie eine Dose Suppe und kippte den Inhalt in ihren kleinsten Topf. Nachdem sie die Dose ausgespült und zum Recyclen aufs Regal gestellt hatte, sagte sie zu ihrem abwesenden Hund: »Andy Warhol würde Millionen dafür verlangen.« Beim Kochen weinte sie ein wenig. Nachdem die Suppe etwas abgekühlt war, probierte sie einen Löffel. Sie war salzig und cremig, genau, wie sie sie mochte.
Die Frau wägte ihre Möglichkeiten ab. Den Vorfall melden oder den Vorfall nicht melden. Immer, wenn sie nicht wusste, wie sie sich entscheiden sollte, schlief sie eine Nacht darüber. Als Hundemensch war sie Frühaufsteherin, daher ging sie auch zeitig zu Bett. Wie es aussieht, hat der Hund mich erzogen, sagte sie ins Leere. Trotz allem passte es ihr immer noch gut, früh schlafen zu gehen. Abende waren schwierig geworden, endlos.
Sie schlief mit einem Kissen zwischen den Beinen in einem großen Bett. Ihre Träume waren lebhaft, aber bedeutungslos. Als sie am nächsten Morgen erwachte und ihr alles wieder einfiel, traf es sie wie ein Schlag, als wäre der Hund erneut gestorben. Sie blieb liegen, bis es Zeit war, den Vorfall zu melden. Sie fürchtete, dass die Polizei ihr Schwierigkeiten machen könnte, weil sie das Feld betreten hatte, trotz des Gerichtsurteils und so. Sie würden eine Frau um die fünfzig vor sich sehen, mit Kurzhaarfrisur, Holzfällerhemd und khakifarbener Chinohose, die nicht mehr weiblich, aber auch nicht männlich wirkte, alleinstehend war, vor Gericht eine Niederlage erlitten und einen Hund durch Ersticken verloren hatte. Sie würden ihre verrückte Geschichte zur Kenntnis nehmen und hinter vorgehaltener Hand über sie kichern. Die ganze Stadt würde von dem neuen Berg erfahren, und man würde ihren Namen fortan immer mit ihm in Verbindung bringen. Das schmerzte sie, denn der Berg war ihr verhasst, erinnerte er sie doch daran, dass ihr Hund erstickt war.
Schließlich, beflügelt von der durchschlafenen Nacht, tippte sie die Meldung in ihren Computer, in Times New Roman, 12 Punkt, doppelter Zeilenabstand, und druckte sie danach auf ihrem langsamen Tintenstrahldrucker aus, wickelte sie um einen Ziegelstein und warf ihn durchs Fenster der Polizeiwache.
Stadtbekannter Säufer
Die einzige Person, die man sofort des Steinwurfs verdächtigte, war der stadtbekannte Säufer. Er hatte schon seit Monaten immer wieder Ziegelsteine mit Botschaften durchs Fenster der Polizeiwache geworfen. In manchen gestand er Verbrechen, die er begangen haben mochte oder vielleicht auch nicht. In anderen standen Theorien über die Stadt oder die Welt. Oft handelte es sich um unverbindlich formulierte, banale Lebensweisheiten ähnlich denen, die man in Glückskeksen findet. Ein- oder zweimal enthielten sie Anschuldigungen gegen historische Persönlichkeiten und deren Schriften. Einmal bestand die Botschaft lediglich aus einer Quittung für eine Palette Ziegelsteine – diese wurde als »Leerbotschaft« gewertet, da man hinter der mitgeschickten Quittung ein Versehen vermutete.
Die Lokalzeitung berichtete über diese Vorfälle, und schon bald erfreuten sich die Artikel einer zunehmenden Beliebtheit.
Nach jedem Steinwurf kam die Polizei ins Haus des stadtbekannten Säufers, das zwar klein, aber stets blitzsauber war. Beim Kaffee trugen sie ihm die Anschuldigungen vor und belehrten ihn über seine Rechte. Der stadtbekannte Säufer begleitete sie darob in die »Innenstadt«, nur ein paar Straßen weiter, wo sie die nötigen Formulare ausfüllten und ihn hin und wieder auch in eine Zelle sperrten, bis die Richterin bereit war für eine Anhörung. Der stadtbekannte Säufer vertrat sich selbst vor der Richterin, anscheinend mochte er sie. Manche behaupteten, er schwärme für sie. Die Richterin drückte ihr Bedauern darüber aus, dass der stadtbekannte Säufer nicht mehr aus sich gemacht habe, und entließ ihn zumeist mit einer Verwarnung oder einer Geldstrafe. Kam es zu einer Geldstrafe, plädierte der stadtbekannte Säufer erfolgreich dafür, diese in kleinen Raten über einen sehr langen Zeitraum hinweg abzahlen zu dürfen. Er tue dies, wie er behauptete, nicht aus finanziellen Gründen, sondern um sich ein Lebensziel zu setzen, denn wenn er jede Woche eine geringe Summe entrichtete, würde ihn dies an sein Fehlverhalten erinnern und ihm damit auferlegen, sich in Zukunft zu bessern. Die Richterin, die sich einen grundsätzlichen Glauben an die Menschheit bewahrt hatte, gab diesen Gesuchen statt, und einmal bedankte sich der stadtbekannte Säufer mit einem Blumenstrauß, den er ihr, an einem Ziegelstein befestigt, durchs Richterinnenzimmerfenster warf.
An diesem Morgen hatte der stadtbekannte Säufer resolute Kopfschmerzen. In der vergangenen Nacht hatte er getrunken, in Promille und Litern. Ihm war nicht nur elend, sondern auch noch zum Heulen zumute. Als dann aber die Polizei bei ihm auftauchte, munterte ihn das etwas auf. Sie zeigten ihm den Ziegelstein und die getippte Botschaft. Kaum hatte er die Botschaft zur Seite gelegt, schleuderte er den Ziegelstein quer über die Straße. Er zertrümmerte das Heckfenster des Volvo Kombi seiner Nachbarin von gegenüber.
Er fragte die Polizisten, ob sie noch einen Ziegelstein hätten. Die verneinten. Also holte er sich den geworfenen Ziegelstein zurück und warf ihn wiederum quer über die Straße, auch diesmal flog er durchs Volvofenster, das allerdings schon zertrümmert war. Er landete auf der Hutablage neben einer mit Glassplittern gefüllten Schachtel Kosmetiktücher.
»Keiner von meinen«, sagte er, als er zurückkehrte ins Haus, um Kaffee zu kochen. »Hat aber gut in der Hand gelegen.«
Erst da kümmerte er sich um die dazugehörige Botschaft, hielt sie wie ein Buch mit beiden Händen. Bis zur letzten Zeile las er sich alles durch, dann widmete er sich noch mal den Passagen, die er nicht verstanden hatte.
»Keine von meinen«, wiederholte er.
Die Polizisten tauschten Blicke. »Sind Sie sicher?«, fragten sie.
Die Besitzerin des Volvo kam über die Straße, einen Arm halb in der Strickjacke. Ihre Äußerungen waren anklagend und scharfzüngig. Der stadtbekannte Säufer bot an, fürs Volvofenster zu zahlen, in kleinen Raten, über einen sehr langen Zeitraum, und erklärte ihr, was er daraus lernen werde. Er erklärte außerdem, dass der Ziegelstein nicht ihm gehöre, obwohl er ihn durchaus geworfen habe.
Die Frau trollte sich Verwünschungen murmelnd zurück in ihr Haus.
»Wissen Sie, immer, wenn sie hier vorbeigekommen ist, hat sie mir ins Fenster geglotzt«, erzählte der stadtbekannte Säufer. »Irgendwann hab ich beschlossen, auf sie zu warten, und als sie das nächste Mal reingeglotzt hat, hab ich ihr in Unterhose zugewinkt.«
Nachdem die Polizisten gegangen waren, saß er allein da und dachte über das nach, was in der Botschaft über den neuen Berg gestanden hatte, und darüber, wie die Trübsal in seinem Bauch beim Lesen einfach versickert war.
Carthage und Clare
Ocho und Ruth waren bei Carthage und Clare zum Essen eingeladen. Sie hatten die beiden über gemeinsame Freunde kennengelernt, zu denen sie jetzt aber keinen Kontakt mehr hielten. Früher trafen sich die gemeinsamen Freunde mit Ocho und Ruth und Carthage und Clare zum Abendessen, doch nachdem die gemeinsamen Freunde Eltern geworden waren, hatten sie immer wieder abgesagt, und so schrumpfte die ursprüngliche Dreipaargruppe schließlich auf eine Zweipaargruppe.
»Du solltest deine Freunde häufiger treffen«, sagte Ruth oft zu Ocho.
»Freundschaften muss man pflegen«, sagte Clare oft zu Carthage.
»Aber er ist eigentlich nicht mein Freund«, sagten Ocho und Carthage zu ihren jeweiligen Ehefrauen.
Daher trafen sie sich immer wieder zu viert.
Während sie aufs Essen warteten, unterhielt sich Carthage mit Ocho, sagte Sachen wie: »Wen kennst du in Firma X? Kennst du Mr Y in Firma X? Ich kenne Mr Y in Firma X schon ewig. Ein feiner Kerl, ganz feiner Kerl …«
Ocho gefiel es nicht, dass Carthage seine Mitmenschen behandelte, als wären sie auf der Arbeit. Als wäre Ocho ein Kühlschrankmagnet und Carthage müsse überlegen, ob er ihn zu den anderen wichtigen Magneten auf Augenhöhe hängen sollte oder weiter unten zu den übrigen Magneten, die man sich nie anschaute.
Was zwischen Carthage und Ruth vor sich ging, behagte ihm auch nicht. Ocho und Ruth waren beide gleich groß, aber wenn sie ausgingen, trug sie hohe Absätze, in denen sie ihn überragte, genau wie Carthage, der seinerseits Ruth überragte. Wenn sie zu dritt beieinander standen, fühlte sich Ocho, der kleinste, als wären Carthage und Ruth Vater und Mutter und er das Kind. Daraus erwuchs bei ihm die Vermutung, dass zwischen Carthage und Ruth was lief. Und nun, da sich dieser Verdacht erst mal in seinem Kopf festgesetzt hatte, sah er ihn in allem bestätigt, egal, wie unschuldig es auch sein mochte. Wenn Carthage sagte: »Wie schön, euch zu sehen« und dabei Ruth ansah oder ihnen für die von Ruth besorgten Gastgeschenke dankte, war er ganz niedergeschlagen.
Ocho überließ Ruth und Carthage ihren Plaudereien und folgte Clare in die Küche. Im Türrahmen sah er ihr zu, wie sie den Geschirrspüler einräumte und Teetassen zu den in fingerdicke Streifen geschnittenen Kuchenstücken auf ein Serviertablett stellte. Er fragte sich, wie es ihm damit gehen würde, wenn dies sein Leben wäre und Clare dies in ihrer gemeinsamen Küche täte. Ocho bot Clare Hilfe an und fragte sie, wie es auf der Arbeit so laufe, obwohl er vergessen hatte, was sie eigentlich machte. Sie schenkte ihm ein unverbindliches Lächeln und sagte: »Geht so. Muss ja.«
Ihre zugeknöpfte Art schüchterte ihn ein, denn in seinen Augen wurde sie dadurch unergründlich.
Nachdem sie ihm das Tablett in die Hand gedrückt hatte, wies sie ihm die Richtung und schickte ihn mit sanftem Druck auf den Ellbogen zurück zu den anderen. Könnte er sein Leben mit einer Frau teilen, die ihm einfach die Richtung wies und ihn dann auf diese Weise wegschickte?
Ruth und Carthage standen eng beieinander und waren in ein angeregtes Gespräch vertieft, als Ocho das Tablett abstellte. Er schenkte ihnen Tee ein und servierte ihnen die Kuchenfinger. Dabei kam er sich vor wie jemand, der unsichtbar hinter den Kulissen arbeitet. Nutzlos wie ein unten am Kühlschrank aufgehängter Magnet.
Sie unterhielten sich über etwas, das später als Ghost Mountain bekannt werden sollte. Die Stadt sprach über nichts anderes mehr, die Geschichte hatte es bereits in die überregionalen Nachrichten geschafft. Alle redeten darüber, dass der stadtbekannte Säufer einen neuen Berg entdeckt habe. Der Lokalzeitung, die die Meldung zuerst verbreitet hatte, war allerdings bekannt, dass man sämtliche Ermittlungen gegen den stadtbekannten Säufer eingestellt hatte, doch die Artikel, in denen er vorkam, waren bei der Leserschaft am beliebtesten, aus unerfindlichen Gründen wollten alle wissen, was er so trieb, und daher hatte man ihm die Hauptrolle zugeschrieben. Unter dem Aspekt des Nachrichtenwerts hatte das auch gut funktioniert, die Geschichte war interessant, weil sich Plausibilität und Nichtplausibilität darin die Waage hielten. Anders ausgedrückt handelte es sich um eine Geschichte, die die Menschen zum Nachdenken anregte.
»Es hat eindeutig was mit Tektonik zu tun«, meinte Ruth. »Weil, kein Mensch hat die Geburt der anderen Berge auf der Welt miterlebt, daher wissen wir theoretisch gar nicht, wie sie eigentlich der Erde entspringen. Wir verfügen lediglich über nachvollziehbare Theorien, die wir nun aber noch mal überprüfen müssen.«
»Ja, stimmt. Daran habe ich gar nicht gedacht«, sagte Carthage.
Ocho betrachtete dies als weiteres Beispiel dafür, dass zwischen Carthage und Ruth was lief. Eigentlich hatte Carthage bei einer Diskussion nämlich immer gern das letzte Wort. Nie im Leben würde er einer derart albernen Aussage zustimmen, wenn er nicht verliebt wäre oder zumindest Iah im Sinn hätte.
»Der Berg war schon immer da«, mischte Ocho sich ein. »Es ist reiner Kleinstadt-Opportunismus, ihn zur Sensation aufzubauschen, um den Tourismus anzukurbeln. Sicherlich gibt es offizielle Quellen, die die Fakten bestätigen, aber die Lokal…«
»… das würdest du nie sagen, wenn es in der Großstadt passiert wäre«, unterbrach Clare, als sie sich zu ihnen an den Tisch setzte. »Kleinstädte sind oft Geburtsstätten großer Wissenschaftler und politischer Führer«, fuhr sie fort, indem sie sich an Carthage und Ruth, aber nicht an Ocho wandte, »während die meisten Verbrecher aus Großstädten stammen.«
»Wie wahr, wie wahr«, stimmten Carthage und Ruth zu, während sie einander Milch in den Tee gaben.
Ocho schob sich einen Kuchenfinger in den Mund, ohne zu bemerken, dass er noch in seinem transparenten Förmchen steckte. In dem kurzen Moment des Schweigens, der sich nach Clares Betrachtung ergeben hatte, sah er sich gezwungen, das Papier vor aller Augen in eine Stoffserviette zu spucken.
Er hatte das Gefühl, allgemeine Abscheu zu erregen.
Landvermessung
Die Polizei hatte die Geschichte über den neuen Berg an die Zeitung durchsickern lassen, um so an neue Hinweise zu kommen.
Zu jenem Zeitpunkt war sie noch nicht befugt, den sogenannten neuen Berg in situ zu besichtigen. Man hatte sie angewiesen, ihn stets als »sogenannten Berg« zu bezeichnen, bis ein genauer Tatbestand erfüllt sei. Da es weder Tatort noch Tatvorwurf gab, sah man sich nicht bemüßigt, nur wegen eines kleinen Aufregers eine offizielle Ermittlung anzustrengen. Außerdem weilte der vom Vater entfremdete Sohn, jetzt Grundbesitzer, im Ausland, was bei einer Ermittlung eine internationale Zusammenarbeit erfordern würde und mögliche vom jeweiligen Staatsabkommen abhängige Konsequenzen hätte. Allein der Papierkram ergäbe einen zweiten neuen Berg, bemerkte ein Polizist. Den Spruch präsentierte er dann später seiner Frau, die daraufhin ganz stolz auf ihn war.
Auf dem Amt für Kartografie und Landvermessung standen genau ein Schreibtisch mit Computer, Telefon, Papier, Kopiergerät sowie ein spezieller Aktenschrank voller Karten. Die Amtsstube war außerdem gerade groß genug für den dort waltenden Amtsdiener, der den Titel Landeskartenbeamter trug. Beim Gespräch mit der Polizei musste sich der Landeskartenbeamte ein Lächeln verkneifen. Er könne ihnen leider nicht helfen, sagte er, und präzisierte sofort, er würde es wirklich gern, doch es sei ihm nicht möglich. Dann lehnte er sich mit verschränkten Händen in seinem Beamtensessel zurück und ließ die Daumen umeinander kreisen.
»Warum nicht?«, fragten die Polizisten.
»Nun …«
Die Pause war wichtig. In ihr kulminierte der Frust über seine unerfüllten Karrierewünsche, die vereitelten Vorstöße, die ständigen Beschneidungen seiner professionellen Gewissenhaftigkeit, die in den Wind geschlagenen Warnungen.
»… die regionalen Karten verzeichnen keine Geländeerhebungen«, sagte er.
Der Landeskartenbeamte hatte eine Laufbahn in der Kartografie und Landvermessung angestrebt, weil er sich gern im Freien aufhielt und ihn die unerzählten Geschichten der Landschaft faszinierten. Nach vielen Jahren als Landeskartenbeamtenanwärter hatte man ihn für das von der Regierung finanzierte Stipendium zur Förderung der Kartografie und Landvermessung vorgeschlagen, und während des Förderprogramms hatte er dem Obersten Landvermesser die Hand geschüttelt, der ihm zu seinem zeichnerischen Können gratulierte. Später wurde er zum Landeskartenbeamten auf Lebenszeit ernannt, wenn auch nur in kommissarischer Funktion.
Die Beförderung beflügelte ihn dazu, seine Frau zum Umzug in die kleine Stadt zu überreden, von der sie noch nie zuvor gehört hatte, und ihr zu versprechen, dort eine Zukunft aufzubauen und ihr die Kinder zu machen, die sie so dringend in die Welt setzen wollte.
Seine Beförderung sollte sich jedoch als Enttäuschung herausstellen. Seine Hauptaufgabe bestand darin, Katasterkarten für Personen zu kopieren, die sich wegen irgendwelcher Liegenschaftsangelegenheiten stritten. Das Gehalt war gut, der Job sicher, doch er war unglücklich, weil seine Fähigkeiten brach und die Karten, die er mitgebracht hatte, noch verpackt im Schrank lagen, genau wie sein Theodolit.
Bei seiner Ankunft äußerte er sich herablassend über die mangelnde Detailtreue der regionalen Karten, die zwar Gemarkungen verzeichneten, aber keinerlei Erhebungen. Seine erste Amtshandlung als kommissarischer Landeskartenbeamter, so teilte er seinen Vorgesetzten umgehend mit, werde darin bestehen, die regionalen Karten zumindest auf ein geodätisches Basisniveau zu heben. Hier nicht zu handeln käme einer groben Nachlässigkeit, ja, dem Banausentum gleich, schrieb er in seinem ersten Bericht als kommissarischer Landeskartenbeamter. Damit wollte er seinen Vorgesetzten eigentlich nur versichern, dass er kraft seines neu übertragenen Amtes dafür sorgen wolle, die herabgesetzte Würde ihres Berufs wieder in einen angemessenen Stand zu erheben.
Aber die Reaktion seiner Dienstoberen fiel so knapp wie eindeutig aus: »Immer schön auf dem Boden bleiben.«
Nach dieser Antwort kehrte er heim zu seiner Frau, sah sich aber erst nach einer weitgehend schlaflosen Nacht in der Lage, ihr zu erklären, was passiert war. Je mehr er mit ihr über den Vorfall sprach, desto tiefer drang er in die darin enthaltenen Bedeutungsschichten vor. Sie hatten ihn also nicht für Größeres vorgesehen. Er verstand, dass man ihm einen mittelmäßigen Job mitten im Nirgendwo zugeteilt hatte, weil man ihm offenbar nicht mehr zutraute. Hinter seinem kommissarischen Status wähnte er ein abgekartetes Spiel, hinter der vermeintlichen Beförderung nur eine Finte, auf die er reingefallen war. Und am traurigsten machte ihn die Erkenntnis, dass sein berufliches Scheitern nur ein geringer Teil eines viel größeren, allgemeineren Scheiterns darstellte. Bis jetzt hatte sich kein Baby angekündigt, und die Ärzte hatten ihnen geraten, auch keines zu erwarten.
Der Besuch der Polizei in seiner Amtsstube aber sollte sich für ihn als großer Moment herausstellen. Eine Ehrenrettung. Er hatte bereits in der Zeitung von dem neuen Berg gelesen und sich nicht zu einem Kommentar hinreißen lassen, als seine Nachbarn im beiläufigen Gespräch bemerkten, dass er sich sicher mit Bergen gut auskannte, wo er doch Geologe sei (war er nicht). Auch wimmelte er die vielen Anrufer ab, die beim Amt um ein Foto vom Berg nachsuchten. Diese Personen wies er höflich darauf hin, dass er keine Berge fotografiere und dass es sich bei dem von ihnen vermutlich gemeinten Erfassungsinstrument um einen Theodoliten handele. Er verkniff sich den Hinweis darauf, dass sein Titel nicht Landkartenbeamter lautete, sondern Landeskartenbeamter.
Als er in seiner beengten Amtsstube dem Ersuchen der Polizisten lauschte, ging ihm auf, dass sich ihm gerade die Gelegenheit für die größte Genugtuung in der Geschichte der Landesvermessung bot. Im tiefsten Inneren ließ er sich die Wörter »befriedigend« und »höchst erquicklich« auf der Zunge zergehen.
Mittags fuhr er schnurstracks nach Hause und schlief aufs Leidenschaftlichste mit seiner Frau. Für sie beide sollte dies den Beginn eines herrlichen Sommers einläuten, voll mit Mittagspausen wie dieser.
Dem Berg einen Namen geben
Über die genauen Umstände bei der Entdeckung des Bergs kursierten unterschiedliche Geschichten, und auch darüber, wie neu er denn nun eigentlich war, wurde lange gestritten. In diesen ersten Tagen hatte er zwar noch keinen offiziellen Namen, aber viele inoffizielle.
Die Polizei nannte ihn den »sogenannten« neuen Berg.
Die Frau, die ihn entdeckt hatte – und deren Hund dort erstickt war – nannte ihn nach ihrem Hund Thelonius Mountain.
Der stadtbekannte Säufer nannte ihn den Ziegelsteinwerfer.
Der Landeskartenbeamte und seine Frau nannten ihn Mittagsspitz.
Für den Metzger war er der Erstickte Hundsberg.
Clare nannte ihn schlicht Neuberg.
Carthage, der laut Ocho nur darauf aus war, Ruth mit seiner Dichtkunst zu beeindrucken, nannte ihn Potzblitz.
Als Gegenentwurf nannte Ocho ihn – zumindest im Stillen – Dumme Arschkrampe.
Ruth, die daheim eigentlich über nichts anderes mehr sprach, nannte ihn Spirit Mountain.
Die städtischen Behörden unterzogen sämtliche Varianten einer gründlichen Prüfung. Sie wussten um die Weisheit der Wunschlinie.
In der Vergangenheit hatten sie bei neuen öffentlichen Parkanlagen auch immer einen Weg angelegt, damit die Leute die Rasenflächen nicht betraten. Aber die Öffentlichkeit schuf sich mit der ihr eigenen, intuitiven Schwarmintelligenz stets ihre eigenen Wege, was dazu führte, dass die neuen Parkanlagen grundsätzlich von zwei Wegen durchschnitten wurden, dem offiziellen Weg und einem zweiten Trampelpfad mitten durch die Rasenflächen – die Wunschlinie. Aus dieser Erfahrung hatten die städtischen Behörden gelernt, sich dem öffentlichen Willen zu beugen, und nach einiger Zeit ging man dazu über, Parkanlagen zunächst ohne gepflasterte Wege zu planen. Stattdessen wartete man einfach, bis die Öffentlichkeit sich ihre eigene Wunschlinie ertrampelt hatte, die man dann pflasterte.
So lautete sie, die Weisheit der Wunschlinie.
Und dieser Weisheit folgten sie auch bei der Benennung des Bergs. Nach einiger Zeit fuhren die Leute aus der Stadt hinaus, um den Berg mit eigenen Augen zu sehen. Da es keinen direkten Zugang gab, parkten sie ein paar Meter davon entfernt und durchquerten zu Fuß den Flickenteppich aus zusammengestückelten Feldern des im Ausland ansässigen Grundbesitzers, das Vermächtnis seines Vaters, von dem er sich entfremdet hatte. Aus diesem Blickwinkel betrachtet schien der Berg zwei Mulden zu haben, sie gähnten wie zwei abgesackte Augenhöhlen mitten im Hang. Eine dritte Mulde lag dazwischen, aber etwas unterhalb der beiden ersten, was ihm einen geisterhaften Ausdruck verlieh.
Und so kam es, dass der Berg von jenen, die ihn gesehen hatten, Ghost Mountain genannt wurde.