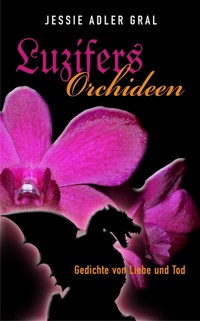Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Am Ufer des Capibaribe im brasilianischen Recife kämpfen die Leoparden, eine Gruppe von -teils noch sehr kleinen - Straßenkindern um ihr Überleben, immer auf der Flucht vor der Militärpolizei, die vor Mord nicht zurückschreckt, um die herumlungernden kleinen Hungerleider loszuwerden. Im deutschen Brühl ist unterdessen der Immobilienhändler Maxim Tabrizi förmlich besessen von seiner jungen Geliebten Jennifer, um die er mit dem exzentrischen Studenten Freddy Fassbender konkurrieren muss. Nach einem Besuch bei Fassbender stürzt die versierte Pilotin Jennifer bei idealem Flugwetter mit ihrer Maschine ab, was die Kommissare Arissa und Merill auf den Plan ruft. Das Verhältnis der beiden Ermittler gestaltet sich gelegentlich etwas schwierig, da Merill in Carolin Arissa verliebt ist, während die Kommissarin eher einer Beziehung mit dem aufregenden Rechtsmediziner Sommerfeld zuneigt. Als einzige Spur finden sich in der abgestürzten Cessna einige telogene Yorkshire-Terrierhaare. Dann wird in einem nahe gelegenen Wald auch noch die Leiche eines nackten schwarzen Kindes ausgegraben, dem beide Nieren und Augen fehlen ... Leoparden unter kaltem Mond leuchtet die dunkelsten Winkel der menschlichen Seele aus. Es ist ein literarischer Kriminalroman, in dem sich Sexualität, Tod, Menschenverachtung und Liebe zu einem packenden Potpourri vermischen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jessie Adler Gral
LEOPARDEN UNTER KALTEM MOND
Roman
Copyright © 2013 Jessie Adler Gral
Published by: epubli
Das gesamte Werk ist im Rahmen des Urheberrechtsgesetzes geschützt. Jede von der Rechteinhaberin nicht genehmigte Verwertung ist unzulässig. Dies gilt auch für die Verwertung durch Film, Funk, Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger jeglicher Art, elektronische Medien sowie für auszugsweisen Nachdruck oder Übersetzung.
Prolog
Sancho war fest entschlossen, nicht zu weinen. Er kniete nackt auf den steinernen Fliesen der Polizeiwache und versuchte, sein Zittern zu unterdrücken. Neben ihm kauerten Lobinho und Cielito, ebenfalls nackt und zitternd. Die Kinder froren erbärmlich, denn die Bullen hatten sie drei Stunden ohne Kleider auf dem nächtlichen Hof stehen lassen und wieder und wieder mit kaltem Wasser überschüttet. Aber das Zittern kam nicht nur von der Kälte. Es war ja keineswegs der erste Überfall der grünen Hühner, und die Kinder wussten genau, was ihnen bevorstand. Luna hatten die Bullen gleich zu Anfang von der Truppe isoliert, um sie ungestört im Nebenzimmer zu vergewaltigen.
Sancho biss die Zähne zusammen und unterdrückte ein Stöhnen. Diese elenden Hurensöhne! Vor allen Dingen nicht weinen, hämmerte er sich ein. Auch schreien durfte er nur im äußersten Notfall. Schließlich war er der Anführer. Er musste seinen Leuten ein gutes Beispiel geben.
„Los, ihr Ratten!“, brüllte der Polyp, der Camargo hieß, und gab seinen Untergebenen durch die geöffnete Tür einen Wink. Zwei weitere grüne Hühner kamen herein und trieben die nackten Jungen mit Faustschlägen über den Korridor in einen lichtlosen kleinen Verschlag.
„Nicht die Papageienschaukel, bitte!“, heulte Sancho auf und wich zurück, bis er mit dem nackten Hintern an die Wand stieß. Der Anblick der runden Stange, die etwa einen Meter über dem Betonfußboden angebracht war, versetzte ihn in helle Panik.
Flavio Camargo grinste. Jetzt hatten die kleinen Scheißer natürlich die Hosen voll. Aber auf der Straße, vollgepumpt mit Kleister, waren sie unerhört tapfer und rissen ihre ungewaschenen schwarzen Mäuler sperrangelweit auf. Was diese kleinen Kanalratten für einen Unflat von sich gaben! Aber hier auf dem Revier schlotterten sie natürlich vor Angst. Polizeioffizier Camargo packte den nackten Sancho grob am Arm und schleppte ihn durch den Raum. Er hob den dünnen Jungen hoch und hängte ihn mit den Knien über die Stange. Sancho machte sich schwer und blieb wie ein Kartoffelsack mit den Schultern auf dem Boden liegen.
„Los, heb gefälligst Deinen Arsch und streck die Arme unter der Stange durch“, bellte Camargo, der langsam die Geduld verlor. „Sonst mach ich Dich so fertig, dass Dich Deine eigene Mutter nicht mehr erkennt.“ Er riss Sanchos Arme nach oben und führte sie unterhalb der Stange an seinen Knien vorbei. Dann fesselte er die Handgelenke des Pivete mit einem Strick über den verschränkten Füßen und gab ihm einen leichten Stoß.
Der Pivete pendelte hilflos vor und zurück. Er war verschnürt wie ein Paket und unfähig, ein Glied zu rühren. Kopf, Geschlechtsteile und Fußsohlen waren schön exponiert und jeder Willkür preisgegeben. Camargo betrachtete die fest zusammengekniffenen Lider des aufgehängten Moleque und lächelte dünn. Jetzt würde er dem unverschämten Bürschchen ein bisschen Respekt beibringen. Das würde ihn lehren. In dieser Hinsicht war die Papageienschaukel unübertroffen. Er griff zu dem biegsamen Stock, der an der Wand hing und verpasste Sancho einen saftigen Hieb auf die Fußsohlen.
Der Pivete riss die Augen auf und keuchte.
„Das war erst der Anfang, Du nichtswürdige Ratte“, sagte Camargo mit seidenweicher Stimme und grinste bösartig. Er holte aus und platzierte den nächsten Hieb auf die offen daliegenden Genitalien des Jungen.
Der Pivete brüllte auf und begann dann stoßweise zu schluchzen. Die beiden anderen nackten Elendsgestalten, die auf dem Betonboden an der Wand hockten, stöhnten und ließen die Köpfe hängen.
1
Quentin Hofhacker schlenderte durch den schattigen Wald des Königsforsts und pfiff einen alten Song der Beach Boys vor sich hin - California Girls. Seit er Bobbi wiederhatte, war er ein rundherum glücklicher Mann. Als Quentin pensioniert wurde, hatte der glänzend schwarze Dobermann mit den senfgelben Pfoten noch zwei weitere Dienstjahre abzureißen. Hofhacker hatte alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Bobbi freizukriegen, doch es hatte nichts genützt. Zwar war Bobbi nicht mehr jung, doch er war erstklassig trainiert, und seine Ausbildung war bei weitem zu teuer gewesen, um ihn vor Ablauf seiner Dienstzeit in Ruhestand zu versetzen. Da half alles nichts: Bobbi war einfach zu wertvoll.
Zwei Jahre hatte Quentin ohne Bobbis hingebungsvollen Blick und sein vertrautes Hecheln leben müssen - eine furchtbare Zeit für ihn, zumal ein Jahr zuvor auch seine Frau gestorben war. Ohne Frau und Hund fühlte sich Hofhacker beinahe schon selbst halbtot, und der Gedanke, dass jetzt ein neuer Kollege mit Bobbi arbeitete, hatte Ströme von Eifersucht und Besorgnis durch sein altes Blut gejagt. Was, wenn der Kerl schlecht mit Bobbi umging? Bobbi war ein kräftiger und mutiger Hund, aber er war empfindsam. Was, wenn das Tier ihn ganz vergaß? Quentin hatte seinen Kummer und die schmerzliche Sehnsucht nach Bobbi in Bergen von Essen erstickt. Er hatte Brathähnchen, Sahneeis mit Paranüssen, Schweinshaxe und Tiramisu in sich hinein geschaufelt. Dazu Rumkugeln und Berge von Marzipanschweinen, deren rundliche rosige Formen ihm einen eigenartigen Trost vermittelten. Vielleicht wegen Valeria. Auch Valeria war rundlich gewesen, mit frischer rosiger Haut. Quentin seufzte aus tiefster Brust. Er hatte gefressen und gefressen und mehr als fünfzig Pfund Gewicht zugelegt.
Dann war Bobbi aus dem Polizeidienst entlassen worden, und Quentin hatte ihn gekauft. Jetzt zeigte sich, dass das Tier, von dem er sich vertragsgemäß zwei Jahre lang ferngehalten hatte, ihn keineswegs vergessen hatte. Bobbi hatte beim Anblick seines alten Herrchens in allen Tonlagen geheult und gejault. Der muskulöse Rüde hatte Quentin umgerannt, und der alte Mann hatte seine Arme um Bobbi geschlungen und gelacht und geweint, während sich beide wie die Verrückten am Boden wälzten. Ihr Wiedersehen hatte einigen der mit Quentin befreundeten Hundeführern verstohlene Tränen in die Augen getrieben. Hofhacker zog seine Hose hoch und schnaufte leise bei der Erinnerung. Trotz seines Gürtels rutschte die verdammte Hose ständig nach unten, denn seit Bobbi wieder bei ihm war, war sein Übergewicht rapide zusammengeschmolzen. Bobbi, der ihm einige Meter voraustrabte, winselte leise, weil er die Rührung seines Herrn spürte. Der Wald roch aromatisch nach trockenem Laub und warmem Harz, und Quentin erspähte den Kopf eines Maronenröhrlings, der die warme Erde durchbrach. Die ersten zusammengerollten braunen Blätter und Nadeln bedeckten den Waldboden, denn der Sommer war ausnehmend trocken gewesen. In ganz Südeuropa hatten wochenlang furchtbare Waldbrände gewütet.
Bobbi, der zwischen ein paar jungen Tannenschösslingen herumschnüffelte, jaulte plötzlich auf und sank bewegungslos auf ein kleines freies Areal zwischen den jungen Trieben. Quentin drehte sich um und pfiff, doch der Hund jaulte wieder und blieb regungslos liegen. Der alte Mann erstarrte. „Das ist nicht dein Ernst, Bobbi?“, sagte er mit rauer Stimme, und der Hund jaulte erneut und blieb liegen wie ein Stein, die Schnauze auf den warmen Erdboden gesenkt. Vielleicht machte Bobbi ja bloß Faxen, aber was, wenn nicht? Doch ehe er jetzt ein ganzes Bataillon von Ex-Kollegen zu Hilfe rief und sich womöglich lächerlich machte, würde er die Sache erst mal selbst überprüfen.
Quentin schlug die Augen zum Himmel und seufzte. „Okay, alter Junge, Du bleibst brav hier, und ich komme wieder, so schnell ich kann. Rühr Dich nicht vom Fleck, hast du verstanden?“ Bobbi kläffte leise zur Erwiderung.
Quentin keuchte erbärmlich, als er mit Spaten, Gartenhandschuhen und Schaufeln zu seinem Hund zurückkam. Er war mit seinem alten Lada so weit wie möglich in den Wald hineingefahren, was zwar gesetzwidrig, in diesem Fall aber zu entschuldigen war, denn er musste so schnell wie möglich zu Bobbi zurück. Natürlich war der Hund ausgezeichnet trainiert und sehr gehorsam, aber wenn man ihn länger als eine Stunde alleinließ, konnte er leicht die Lust verlieren und sich zu einem Spaziergang aufmachen.
Doch Bobbi lag noch immer brav auf dem kleinen kahlen Fleckchen zwischen den Tannenschösslingen. Hofhacker lobte ihn über den grünen Klee und warf ihm einen mitgebrachten Hundekuchen zu. Bobbi sprang hoch und schnappte den Kuchen mit einer eleganten Drehung aus der Luft heraus, während Quentin sich schweren Herzens ans Graben machte. Leichenspürhunde absolvierten ein langes Training, damit sie ausschließlich auf menschlichen Leichengeruch reagierten. Mit ihrer seismografisch empfindlichen Nase konnten sie einen toten menschlichen Körper noch in einer Tiefe von drei Metern unter einem Bauschutthügel riechen. Oder auch eine in Plastikbahnen verpackte Leiche, die unter dem Steinfußboden eines Kellers eingemauert war. Hatten sie einen Toten erschnüffelt, stießen sie einen langgezogenen Jaulton aus, legten sich über der entsprechenden Stelle nieder und blieben bewegungslos liegen.
Quentin wischte sich über das schweißfeuchte Gesicht und schaufelte schneller, während Bobbi schweifwedelnd über die Lichtung tobte.
In einer Tiefe von nur etwa eineinhalb Metern stieß Quentin auf eine kleine schwarze Hand, die wie um Hilfe flehend aus der nackten Erde ragte.
2
Recife, 7. September 2000
Sancho fluchte. Seit mindestens fünf Minuten strampelte er sich ab, unter dem verbeulten Leichtkochtopf aus Aluminium Feuer zu machen. Vom Meer her fegte ein scharfer Wind ins Land, und er hatte nur ein paar Holzsplitter und kaum Papier, um das Feuer zu entfachen. Die verdammten Sucateiros rissen jeden Fetzen Papier an sich, den die Straßenreinigung übersehen hatte, um ihn zusammen mit anderen kostbaren Abfällen zu verscherbeln. Er verbrannte sich die Hand an seinem dreizehnten Streichholz und fluchte erneut.
Sancho war der Anführer der Leoparden, einer Bande von sechs elternlosen, verlassenen Straßenkindern, wie es sie in brasilianischen Großstädten zu Tausenden gibt. Die Leoparden lebten auf der Praça Joaquim Nabuco, praktisch zu Füßen der Statue des berühmten Sklavenbefreiers. Das war ein Witz, dessen bittere Bedeutung den Kindern keineswegs entging, denn mit einer Ausnahme waren alle Mitglieder der Bande schwarz. Waren sie nicht so etwas wie moderne Sklaven?
Sancho pustete auf das winzige Häufchen von Holzsplittern, verschluckte sich am aufsteigenden Rauch und hustete. Endlich gelang es ihm, eine dünne Flamme am Brennen zu halten. Nicht, dass es viel zu kochen gegeben hätte. Außer drei Litern Wasser waren in dem alten Alukochtopf bloß Gemüseabfälle - zwei Zwiebeln, eine matschige Tomate, eine halbe Aubergine und mehrere dicke Kartoffeln. Dazu ein klitzekleines Stückchen Fisch. Der Fisch wog höchstens hundertachtzig Gramm, schätzte Sancho. Die Madonna mochte wissen, wie davon sechs Leute sattwerden sollten.
Er blies auf die dürftige Flamme, schichtete einige dünne Zweige mikadoartig über dem Feuer auf und verzog sorgenvoll das Gesicht. Tatsache war, dass es den Leoparden nicht gutging. Alle Bandenmitglieder waren barfuß und halb verhungert. Alle waren Analphabeten, und die jüngeren Leoparden gingen in Lumpen. Nur der fünfzehnjährige Sancho und seine Freundin Luna waren mit Bermudas und knappen Tank-Shirts halbwegs manierlich angezogen. Sancho rückte den verbeulten Alukochtopf über dem Feuer zurecht und seufzte. Er wusste natürlich, dass es den Leoparden hauptsächlich deshalb schlechtging, weil er als Straßenvater viel zu jung war. Ein Straßenvater war der Boss einer Kindergang. Er knobelte die Raubzüge aus, nahm das Geld in Verwahrung und verteilte Beute und Essen. Ein Straßenvater wusste, wie man an Waffen kam. Doch Sancho fehlte es an Lebenserfahrung und Abgebrühtheit. Er war einfach noch kein Profiräuber, und wie man an Waffen kam, wusste er auch nicht. Seine Bande begnügte sich noch immer mit einigen verschrammten Messern und den obligatorischen Rasierklingen.
Die dreizehnjährige Luna wickelte sich fest in ihre lumpige Decke. Sie fröstelte, denn sie hatte seit gestern Abend keinen Happen mehr zwischen die Zähne bekommen. Auch die übrigen Leoparden hockten apathisch auf ihren Pappunterlagen. Sie hatten alle Hunger, denn der Fischzug der gestrigen Nacht war voll in die Hose gegangen. Nachdem sie mit ihrem Glasschneider endlich das Oberlicht des Elektrogerätegeschäfts durchhatten, war ein schriller Alarm losgegangen, und wie aus dem Nichts waren plötzlich drei Bullen aufgetaucht. Sie waren um Haaresbreite entkommen, indem sie kopflos vom Dach sprangen und wie die Teufel hakenschlagend und über Mauern springend davonrasten.
Inzwischen waren alle Leoparden wieder eingetrudelt und warteten tödlich erschöpft auf Tupi, der beim Schuster einen Zweiliterkanister Cola de Sapateiro kaufen und den Stoff direkt in ihre kleinen Schnüffelflaschen umfüllen sollte. Der verfluchte Schuster wurde mit jedem Tag dreister und verlangte Unsummen für seinen gottverdammten Kleister. Ein gemeiner Halsabschneider, das war er, aber was konnte man schon dagegen machen? Ihre paar Münzen langten gerade noch für ein bisschen Kleister, aber wovon hätten sie ein anständiges Mittagessen bezahlen sollen? Luna schmiegte sich noch enger in ihre zerfetzte Decke. Wenigstens würden sie Kleister haben, den goldenen himmlischen Klebstoff, dessen Dämpfe alle Qualen und Demütigungen der Straße wegschmolzen. Kleister war lebenswichtig, wichtiger noch als Essen, denn er ließ einen den hungrigen Magen ebenso vergessen wie die Empörung der rechtschaffenen Leute, deren niederträchtige Kommentare noch übler schmerzten als die Prügel der Bullen.
Sie rappelte sich auf und sah teilnahmslos zu, wie Tupi mit einer prall gefüllten Plastiktüte angeschlendert kam. Er sah völlig entspannt aus. Kein Wunder, Tupi hatte ja auch keinen qualvollen Spurt hinter sich und keinen nervenaufreibenden Stress. Keine Todesangst, von den Bullen gepackt, durchgeprügelt und eingelocht zu werden. Stattdessen hatte er - während sich Luna und die anderen auf dem Dach des lausigen Elektrogeschäfts abplackten -, gemütlich in seine Decke gehüllt zusammen mit Moa die Habseligkeiten der Leoparden bewacht.
Luna seufzte verärgert. Aber es war sinnlos, Tupi auf Diebestouren mitzuschleifen. Der Achtjährige konnte die schweren Geräte nicht heben, und wenn man ihm einen winzigen Sack auf den Rücken packte, brach er zusammen. Tupi war nutzlos. Aber klar, zum Essen und Kleisterschnüffeln war er nicht zu schwach. „Beweg Deinen Arsch und schlaf nicht im Stehen ein!“, herrschte sie den Kleinen an. „Wir warten hier seit einer Ewigkeit und sind hungrig und geschafft.“
Gehorsam beschleunigte der kleine Mulatte seinen Schritt und kramte beflissen in der Plastiktüte, um Lunas Schnüffelflasche als erste herauszuziehen. Luna konnte verflucht gemein werden, wenn sie sauer war. Und sie hatte Macht, denn sie war die Freundin vom Boss.
3
Carolin Arissa trat nahe an die stählerne Bahre und betrachtete das tote Kind, das Sommerfeld und Dominik Merill gestern Abend aus dem Wald geborgen hatten. Heute war ihr erster Arbeitstag nach einem dreiwöchigen Urlaub. Als der Junge ausgegraben wurde, hatte sie sich noch in neuntausend Metern Höhe auf dem Rückflug von Madeira nach Köln befunden. Der kleine Mulatte war nackt bis auf ein grünes Tuch, das ihm locker über Brust und Unterleib hing. Sein spindeldürrer Körper war von alten Narben übersät. Die Narben sahen aus, als hätte man ihn mit einem Stock geprügelt. Auf beiden Unterarmen hatte er verheilte Wunden, die von glühenden Zigaretten stammten, und seine Haut zeigte ein fahles Grau. Er war vielleicht zehn Jahre alt. Beide Augäpfel fehlten.
„Gottverdammt“, sagte Arissa mit brüchiger Stimme und spürte bestürzt, wie sich ihre Augen mit Tränen füllten.
Cedric Sommerfeld hätte Hauptkommissarin Arissa gerne in die Arme geschlossen, doch er tat es nicht. Er wusste, dass Carolin es hasste, schwach zu erscheinen. Sie war eine beherrschte und stolze Frau. Nach einem kurzen Blick auf ihre in Tränen schwimmenden dunklen Augen wandte er sich taktvoll ab und hängte die Röntgenaufnahmen des Kindes an die Lichtwand. Seit Fionas Tod vor vier Jahren hatte ihn keine Frau mehr so fasziniert wie die spröde Kommissarin Arissa, und er hatte ihre Rückkehr aus dem Urlaub mit jeder Faser seines Herzens herbeigesehnt. Dabei hatte sie ihm während der ganzen Zeit nicht eine einzige Karte geschrieben. Sie hatte auch nicht angerufen. Er hatte nicht die leiseste Ahnung, wie sie zu ihm stand. Doch trotz dieses ernüchternden Faktums und des erbärmlichen Anblicks, den das gemarterte Kind bot, konnte er seine Freude über ihr Wiedersehen kaum zügeln.
Carolin Arissa haderte mit sich. Welche Kommissarin brach schon an der Bahre eines ermordeten Kindes in Tränen aus? Verdammt unbeherrscht, Arissa! Doch der kleine Junge ohne Augen sah so verlassen und geschändet aus, dass es einem wirklich das Herz brechen konnte, verteidigte sie sich in Gedanken. Sie streifte einen transparenten Handschuh ab und wischte sich beiläufig über die Augen. „Ein misshandeltes und ermordetes schwarzes Kind ohne Augen zu sehen, ist nicht gerade ein Vergnügen“, sagte sie heiser, um ihre Tränen auch Sommerfeld gegenüber zu rechtfertigen. „Schließlich bin ich selbst dunkelhäutig.“
Der Rechtsmediziner drehte sich zu ihr um und betrachtete ihre klaren Züge. Carolins Haut war honigfarben, doch natürlich wusste er, dass ihr Vater aus Äthiopien stammte. Und ganz egal, wie hellhäutig diese Menschen waren - nach der rassistischen Farbtypisierung, die aus der Kolonialzeit überlebt hatte, galten diese Leute als schwarz, zumindest aber als dunkelhäutig. Und Arissa, die eine blonde deutsche Mutter hatte, natürlich auch. „Der Junge hat auf Armen, Po und Schenkeln vernarbte Spuren von Stockschlägen“, sagte er sachlich. „Und Folterspuren von brennenden Zigaretten. Außerdem wurden ihm beide Nieren entfernt.“ Er schlug das Laken, das den Körper des Jungen verhüllte, zurück.
Über den Bauch des Kindes zog sich ein klaffender Längsschnitt.
Arissa schnappte nach Luft. „Ein reiches weißes Kind wäre nicht so leicht zum Opfer geworden“, sagte sie endlich mit rauer Stimme.
Sommerfeld nickte. „Die Bauchwunde war flüchtig mit Vicryl vernäht. Weil der Fall so ungewöhnlich ist, haben wir das Nahtmaterial ausnahmsweise schon vor der Obduktion entfernt und uns die Wunde näher angeschaut. Da zeigte sich dann, dass dem Kind beide Nieren fehlen.“
Arissa hatte sich wieder gefasst. „Ist die Stärke des Vicryl schon bestimmt?“ Sommerfeld schüttelte den Kopf. „Und die Organentnahme - wurde das fachmännisch gemacht oder hat da irgendein Dilettant herumgepfuscht?“
Cedric Sommerfeld wiegte den Kopf. „Ich schätze, dass die Nieren von einem Fachmann entnommen wurden. Andrerseits ist es meiner Kenntnis nach nicht üblich, den ganzen Augapfel herauszuschneiden, wenn man bloß die Augenhornhäute will.“ Er zog die Schultern hoch und ließ sie wieder fallen. „Man könnte also bei der Augenentnahme von einer eher stümperhaften Ausführung sprechen. Doch dazu sollten wir die Meinung eines Augenarztes einholen.“
Carolin Arissa streifte Sommerfeld mit einem aufmerksamen Seitenblick. Unter seinem flüchtig geschlossenen Kasack lugte ein apfelsinenfarbenes Hemd hervor, auf dem sich kleine schwarze Hasen tummelten, und seine Brauen standen dicht und schwarz über den blassgrünen Augen. Er sah genauso wölfisch aus wie in ihrer Erinnerung, und Carolin atmete in tiefen Zügen, um ihr flatterndes Herz zu beruhigen.
„Was wissen wir denn bis jetzt über das Kind?“
Sommerfeld zuckte die Achseln. „Der Junge ist zwölf oder dreizehn Jahre alt. Er steht am Anfang der Pubertät. Allerdings ist er so klein und schmächtig wie ein Zehnjähriger. Der Körperbau ist leptosom, der Körper selbst sehr gepflegt. Fingernägel, Ohren, Haare, alles picobello gesäubert. Auch keine Schmutzränder unter den Fingernägeln. Die Erdproben vom Leichenfundort sind noch nicht analysiert. Trotzdem zeigt der Zustand von Haut und Zähnen, dass der Kleine über Jahre hinweg Hunger gelitten haben muss. Er ist unternährt und mangelernährt, und trotz seines zarten Alters fehlen ihm schon fünf Zähne. Außerdem hat er umschriebene Hautveränderungen an Mund und Nase.“ Er deutete auf die vollen Lippen des Kindes, die von geröteter, aufgerauter Haut umgeben waren. „Ich vermute, dass er irgendeine Art Lösungsmittel geschnüffelt hat. Das hier sind Entzündungen, die auf den Missbrauch von Lösungsmitteln hindeuten.“ Sommerfeld deckte den Unterleib des Jungen wieder mit dem Tuch zu und betrachtete geflissentlich die Röntgenbilder an der Lichtwand.
Arissa trat neben ihn und machte einen erneuten Versuch, ruhig und tief zu atmen. Sie war sich seiner körperlichen Nähe sehr bewusst und zugleich fassungslos über das Verlangen, das selbst jetzt, im Angesicht des brutal ermordeten Kindes, in ihr aufstieg. Doch Cedric Sommerfeld, der erst vor wenigen Monaten zum Leiter des Rechtsmedizinischen Instituts in Köln berufen worden war, hatte buchstäblich von der ersten Sekunde an diese Wirkung auf sie gehabt. Vor ihrem Urlaub hatten sie vorsichtig geflirtet, waren aber nicht miteinander ins Bett gegangen, obwohl Carolin es liebend gern gewollt hätte. Doch der damals gerade aufgeklärte Mordfall hatte ihr einen gebrochenen Unterschenkel und einige angeknackste Rippen eingetragen, und sie fand den Gedanken, mit Gipsbein und schmerzender Brust in Cedrics Armen zu liegen, nicht gerade verlockend. Von ihrer ersten Liebesnacht mit ihm hatte sie andere Vorstellungen. So war alles zwischen ihnen unausgesprochen und seltsam beunruhigend.
„Der Kleine hat drei verheilte Knochenbrüche an den Armen“, sagte Sommerfeld mit heiserer Stimme. „Außerdem einen alten Bruch des linken Schenkels und einen schlecht verheilten Schlüsselbeinbruch. Das lässt auf massive Gewalteinwirkung während der gesamten Kindheit schließen.“
„Also grobe Misshandlung, Unter- und Mangelernährung und vermutlich Lösungsmittelmissbrauch. Möglicherweise handelt es sich um ein obdachloses Kind, das auf der Straße gelebt hat. Hatte der Junge Kleider an, als er entdeckt wurde?“
„Nicht einen Faden. Es wurden auch keine Gegenstände bei oder an ihm gefunden. Aber vielleicht wird uns eine gründlichere Untersuchung der Leiche und der Erdproben doch noch ein paar vernünftige Hinweise geben.“
„Verdammt und zugenäht!“, fluchte die Kommissarin. „Keine Kleider, keine Unterwäsche. Wie sollen wir das Kind da identifizieren?“ Sie verschränkte die Arme über der Brust und starrte auf die Röntgenbilder.
Sommerfeld musterte sie unter gesenkten Lidern. Carolins normalerweise zimtfarbenes Haar war von der Sonne heller gebrannt und fiel ihr in winzigen Kräusellöckchen über Brust und Rücken. Ihre schrägen schwarzen Augen waren halb geschlossen, und ihr Mund war groß und rot.
Das gleißende Licht der Lampen traf mitten in seine Augen und ließ seine grüne Iris aufleuchten. Gletschergrün wie das wirbelnde Wasser eines Bergbachs, wenn es an sonnigen Tagen zu Tal schießt, dachte Arissa zusammenhanglos.
Mit einer einzigen fließenden Bewegung kamen sie zusammen. Cedric hielt Carolin wortlos an sich gepresst. Carolin schlang die Arme um seinen Hals und drängte ihren Körper an seinen. Beide spürten ihren Herzschlag bis in die Fußspitzen. „Du hast mir schrecklich gefehlt“, flüsterte Cedric in ihr gekräuseltes Haar. Carolin seufzte hingerissen und zerwühlte ihm das schwarze Haar. Sommerfeld gab einen Raubtierlaut von sich und umfasste ihren Hintern in der weichfallenden grünen Seidenhose.
Als die Tür des Autopsiesaals geräuschvoll aufgestoßen wurde, fuhren beide schuldbewusst auseinander. Sommerfelds Stellvertreterin Lila Dailis blieb wie festgenagelt im Türrahmen stehen. Sie trug eine frisch gelegte Dauerwelle im Stil Marilyn Monroes und einen wehenden, türkis gemusterten Kittel über einem knappen gelben Cocktailkleid. Ihre Lippen glänzten blutrot, ihre Lider veilchenblau. Carolin fand, dass sie wie ein Papagei aussah und wandte rasch die Augen ab.
Dailis schoss der albernen Polizistin, die betreten an ihrem Handy herumfummelte, einen wütenden Blick zu. „Wir haben ein Problem mit Ernst Weihmann, Cedric“, sagte sie scharf. „Weihmanns Obduktion ist für viertel nach vier an Tisch drei angesetzt, aber Tisch drei ist zur selben Zeit vom Fall Brigitte Lakers belegt. Wir haben zwar noch einen anderen freien Tisch für diese Zeit, aber keinen freien Obduzenten. Beide Fälle haben Dringlichkeitsstufe A. Welchem geben wir Priorität?“
Sommerfeld wandte sich ihr zu und erwiderte gleichmütig ihren Blick. “Das kannst Du doch allein entscheiden, Lila. Ich bin in einer dringenden Besprechung mit Hauptkommissarin Arissa.“
„Stimmt, das hab ich gesehen“, erwiderte Lila mit spöttischem Blick und drehte ihm unvermittelt den Rücken zu. Die Tür des Autopsiesaals schloss sich mit einem leise schmatzenden Laut, und eine Wolke ihres süßlichen Parfüms trieb langsam zu Sommerfeld und Arissa hinüber. Wie auf Kommando drehten sich beide wieder zur Lichtwand um und starrten auf die Bilder des toten Kindes.
Was für ein peinlicher Auftritt, dachte Arissa beschämt. Es war würdelos, sich neben einem ermordeten Kind in den Armen zu liegen, schlimmer noch: Es war erbärmlich. Aber es hatte sie einfach fortgerissen. Sie blickte Sommerfeld unauffällig von der Seite an. Ihm schien die Situation ebenfalls peinlich zu sein, seine Züge waren ausdruckslos.
„Was haben wir sonst noch an Informationen?“, fragte sie mit belegter Stimme.
„Der Anus des Jungen ist vernarbt und wulstig, was auf wiederholten brutalen Missbrauch schließen lässt.“
„Sexueller Missbrauch kann ein weiterer Hinweis auf ein ungeschütztes Dasein als Straßenkind sein. Möglicherweise ist der Junge aus einem Waisenhaus oder einer ähnlichen Einrichtung ausgerissen und hat sich seitdem auf der Straße durchgeschlagen. Vielleicht hat er sich prostituiert wie so viele Straßenkinder. Wie lange ist der Kleine jetzt tot?“
Sommerfeld blinzelte. „Der Körper ist noch ziemlich frisch, allerdings sind die Totenflecke kaum mehr wegzudrücken. Es gibt ein paar geringfügige Fäulniserscheinungen im rechten Unterbauch. Ich schätze, er war ungefähr dreiundvierzig Stunden tot, als er gefunden wurde. Nach der Autopsie weiß ich es genauer.“
„Also lag das Kind nicht mal zwei Tage in dem Erdloch, als Hofhackers Dobermann ihn aufspürte.“
Sommerfeld lachte kurz auf. „Ja, dass da ein pensionierter Leichenspürhund des Weges kommt und das Versteck ausschnüffelt, war wirklich ein Glücksfall.“ Er tippte flüchtig auf das Laken, das den Körper des Kindes bedeckte. „Noch etwas: Auf der Leiche gibt’s weder Fliegeneier noch Fliegenmaden.“
Arissa zog die Stirn kraus. In freier Natur setzten Schmeißfliegen ihre Eier auf Menschen ab, sobald sie tot waren. Manchmal auch schon, während sie starben. Dabei zeigten sie eine Vorliebe für die Körperöffnungen. „Wenn keine Fliegeneier oder Maden da sind, ist das Kind in einem geschlossenen Raum getötet und anschließend luftdicht eingepackt worden“, sagte sie. „Die Verpackung kann erst Sekunden vor dem Vergraben entfernt worden sein. Sofort danach hat der Täter das Kind mit Erde bedeckt.“ Sie starrte auf den toten schwarzen Jungen. „Warum hat er diese komische aschfahle Farbe?“
Sommerfeld seufzte. „Ich bin so gut wie sicher, dass ihm das gesamte Blut entzogen wurde. Das war vermutlich sogar die Todesursache.“
Carolin hob bestürzt den Kopf. „Aber die entnommenen Nieren und Augen?“
„An einer Nierenexplantation stirbt man nicht gleich. Auch nicht an herausgeschnittenen Augäpfeln. Solange das Herz schlägt und Blut durch den Körper pumpt, lebt der Mensch noch ein Weilchen weiter. Ich vermute, dass der Junge durch Ausblutung starb. Jemand hat ihm das Blut abgezapft und ihn dadurch umgebracht.“ Er zog das Laken, das über dem Unterleib des Kindes lag, erneut herab und spreizte die Bauchwunde behutsam. „Man sieht, dass das Gewebe hier in dem Schnitt auffallend bleich und blutleer ist. Auch die verbliebenen Organe sind bleich.“
„Ausgeschlachtet wie ein Ersatzteillager und dann ausgeblutet“, murmelte Arissa. „Großer Gott, was für Schweine!“ Ihr Handy läutete, und sie riss sich fahrig den zweiten Handschuh von den Fingern.
„Ich war grad in der Gegend und stehe jetzt gegenüber der Rechtsmedi“, sagte Merills leicht polternde Stimme. „Ich kann Dich zum Präsidium chauffieren, wenn Du magst. Hast Du noch länger zu tun?“
„Ich ..... nein ... eigentlich sind wir fertig“, erwiderte Arissa überrumpelt. Sie hatte Nick Merill seit ihrem Urlaub noch nicht wiedergesehen. Sie war überhaupt noch nicht im Präsidium gewesen, sondern sofort nach Dombrowskys Anruf ins Rechtsmedizinische Institut gerast. Woher wusste Merill, dass ihr Wagen noch in der Inspektion war?
4
Recife, 8. September 2000
Der Marder griff nach einer dunkelblonden Lockenperücke und stellte sich vor seinen mannshohen Spiegel. Er stülpte sich die Perücke auf den Kopf und stopfte gewissenhaft jedes schwarze Haar darunter. Natürlich würde er sich anschließend noch die Augenbrauen bleichen müssen. Und die schwarzen Haare auf Händen und Unterarmen. Pereira schlurfte zu seiner Truhe aus Zedernholz, in der er sein Arbeitsmaterial bunkerte, und förderte nach einigem Wühlen ein dunkelblondes Menjoubärtchen zu Tage. Er schlüpfte in eins seiner farbenprächtigen Hawaiihemden und ließ es locker über den Bund seiner hellen Freizeithose hängen. Das Hemd war limettengrün und mit mattblauen und scharlachfarbenen Palmen bedruckt. In Recife hatte die Touristensaison begonnen, und in dieser Aufmachung würde er anstandslos als aufgeputzter Gringo durchgehen.
Fuscão Pereira griff nach der Klebstofftube und befestigte das Bärtchen. Der Madonna sei Dank war es kein Problem, an Straßenkinder heranzukommen. Er kannte ihre Eigenarten, ihre Steckenpferde und ihre Abneigungen. Er wusste haargenau, wie man die Kinder anpacken musste, denn er war selbst ein ehemaliges Straßenkind. Der Umgang mit den Pivetes war im Grunde ein Kinderspiel: Man durfte weder Furcht noch Widerwillen zeigen, sonst wurden die Kinder tobsüchtig. Alle anständigen Brasilianer begegneten ihnen Tag für Tag mit Angst und Verachtung. Ekel oder Abwehr aber machte die Kids zu bösartigen kleinen Monstern, die mit abgebrochenen Flaschenhälsen auf einen eindroschen. Nein, man musste gemütvoll und aufrichtig zu ihnen sprechen - wie ein liebevoller Tio eben. Darauf sprangen die Pivetes an, denn sie waren ja noch Kinder. Sie waren nicht wirklich abgebrüht und raubten nur, um zu überleben. Doch in der Hand eines warmherzigen Onkels waren die Straßenkinder Wachs, denn sie waren ausgehungert nach Liebe.
Der Marder schnaufte kurzatmig, während er das farbenfrohe Hemd wieder abstreifte. Natürlich musste er andauernd seine Aufmachung ändern, denn die Kinder unterhielten ein ausgefuchstes Nachrichtennetz, und er hatte wirklich keine Lust, von irgendeinem dreimalschlauen Moleque wiedererkannt zu werden. Damit wäre sein Geschäft im Eimer gewesen. Doch das war bisher nie passiert, denn er ging es clever an. Manchmal erkannte er sich nach erfolgter Verwandlung selbst kaum wieder.
Fuscão starrte in den Spiegel und erprobte sein gütiges Lächeln.
Es war ein milder, gutherziger und ein wenig verblödeter Gesichtsausdruck, der suggerierte, dass er keiner Fliege etwas zuleide tun könnte. Und dass er außerdem spielend leicht über den Tisch zu ziehen war. Er war noch nie von einem Pivete angefallen worden.
Dass er selbst mit heiler Haut der Hölle des Straßenkinderelends entronnen war, konnte der Marder manchmal selbst kaum fassen. Natürlich hatte er es nur mit Unterstützung der Drogenmafia geschafft. Fuscão hatte viele Jahre als Drogenkurier gearbeitet - ein lebensgefährlicher Job, bei dem man sich keinen noch so winzigen Fehler erlauben durfte. Doch selbst dem blutgierigen Arm der Drogenmafia war er wieder entronnen. Er hatte den Hexenkessel Rio verlassen, seinen Namen geändert und war in Recife untergetaucht. Fuscão grinste und gratulierte sich im Geist zu seiner Gerissenheit. Und inzwischen war er Organbeschaffer, eine Arbeit, von der man prächtig leben konnte. Es war kinderleicht, die ausgehungerten, verdreckten Pivetes mit einem warmen Bad und einer gemütlichen Fernsehnacht in einer billigen Absteige anzulocken. Dazu Hamburger und eine kräftige Feijoada, Coca Cola, Bonbons und Fruchtsäfte. Und natürlich Schusterleim - Ströme von Schusterleim. Für die Pivetes war das der Himmel auf Erden. Meist allerdings kamen die Kinder gar nicht mehr dazu, viel zu schnüffeln. Ein paar K.o.-Tropfen in ihren Ananassaft, und schon waren sie im Dämmerschlaf. Ihnen Blut und Urin abzunehmen, war dann kein Problem mehr. Für den Urin legte er den betäubten Kindern einen Katheter.
Fuscão wandte sich vom Spiegel ab und kramte in der mittleren Schublade in seiner Truhe. Bestimmt zum fünfzigsten Mal überlegte er, ob er die betäubten Kinder nicht vorher noch an einen Pädophilen verkaufen sollte. Schließlich gab es genügend perverse Säue, denen es Spaß machte, ein ohnmächtiges Kind zu ficken. Es wäre ein nettes Zubrot gewesen, und die Pivetes hätten gar nichts davon mitgekriegt. Aber er brachte es einfach nicht fertig. Pereira schalt sich deswegen einen sentimentalen Ziegenbock, aber es half nichts. Er konnte es nicht. Außerdem brachte ihm seine Arbeit genug Kohle ein, auch ohne dass er Pädophile bediente. Die nötigen Blut- und Gewebetests gab er als Eilaufträge an ein nahegelegenes Labor, während er den Kindern ein kleines Frühstück spendierte und sie dann in der Nähe ihres Lagerplatzes wieder absetzte. Das Labor brauchte für die HLA-Typisierung bloß zehn Milliliter EDTA-Blut pro Kind.
HLA hieß Human Leucocyte Antigen, wie sich Pereira, stolz auf sein Englisch, ins Gedächtnis rief. Aus den Leukozyten, den weißen Blutzellen, isolierte das Labor dann irgendwie die DNA des Spenders, doch wie das genau ablief, hatte er nie richtig kapiert. Alles, was er wusste, war, dass die HLA-A, -B- und -DR-Antigene zwischen Spender und Empfänger möglichst verträglich sein sollten. Das war wichtig für den dauerhaften Erfolg einer Transplantation. Mit der HLA-Typisierung eines Spenders nach der molekulargenetischen Methode war das Labor in ungefähr drei Stunden fertig, das allein zählte. Wenn die Blutgruppe in Ordnung war, und die Gewebetests einigermaßen okay, schaute der gute Tio Fuscão nach einigen Tagen erneut bei den Straßenkindern vorbei. Diesmal aber schaffte er die Kids nicht in eine verlotterte Pension, sondern in Gallaghers geschmackvolle Altbauwohnung.
Pereira verzog den Mund und trottete ins Bad. Aus seinem Spiegelschrank nahm er eine Packung Bleichcreme und eine Tube dunkelblonder Haarfarbe. Er legte seine klotzige goldene Armbanduhr ab und zog die Perücke aus. Dann betupfte er Augenbrauen, Unterarme, Hände und Brusthaar mit Wasser und trug mit dem Spatel eine großzügige Dosis Bleichcreme auf. Klar, ein paar ehemalige Straßenkinder, die wie er überlebt hatten, waren Gutmenschen und wurden Straßenerzieher. Sie pirschten nachts durch die verlassenen Gassen, um hungrige und verlauste Pivetes mit Essen und tröstenden Worten zu versorgen. Na, jeder nach seinem Geschmack. Er für seinen Teil zog es vor, als Organbeschaffer sein anständiges Auskommen zu haben. Fuscão strich die Creme auf seiner behaarten Brust glatt und warf einen Blick auf seine Uhr. Dann setzte er sich auf seinen azurblau angestrichenen Holzstuhl und wartete darauf, dass das Bleichmittel wirkte.
Als er an die Entsorgung der kleinen Spender dachte, verdüsterte sich seine Stirn. Das war der einzige Teil seiner Arbeit, den er wirklich hasste. Der Alte nähte die Kinder nach der Organentnahme immer nur notdürftig zu, und er musste die Leichen mit ihren frischen Wunden in seinem Bulli zu einer der großen Müllkippen schaffen und vergraben. Meist fehlten den Kindern die Augen, und fast immer rissen die schlampig zusammengeflickten Wunden wieder auf und nässten, während die Münder der Pivetes aufklafften und ihre leeren Augenhöhlen ihn vorwurfsvoll anstarrten.
Fuscão Pereira drehte am Wasserhahn und hielt sein linkes Handgelenk probeweise unter den Wasserstrahl. Die Haare auf seinem Gelenk waren hellblond. In drei Teufels Namen, irgendein Haar in der Suppe gab es doch immer. Man musste eben die Zähne zusammenbeißen. Die Pivetes hatten es jedenfalls hinter sich, und spätestens mit siebzehn waren die meisten von ihnen doch ohnehin tot. Er ersparte ihnen einfach ein paar Jahre Hunger und Prostitution - von der Folter durch die Militärpolizei gar nicht zu reden.
Pereira machte sich stöhnend ans Abspülen der Bleichcreme. Er tupfte sich die Augenbrauen ab und seufzte schwer. Trotzdem musste er sich für diesen Teil seiner Arbeit jedes Mal einen ansaufen.
5
Dominik Merill blickte Arissa ohne das leiseste Lächeln entgegen. Er lehnte in Bikerpose an einem Laternenpfahl gegenüber der Rechtsmedizin. Neben ihm halb auf dem Bürgersteig stand ihr gemeinsamer Dienst-BMW. Nick bemerkte, dass Arissas Haut eine paar Nuancen dunkler war als sonst. Sie trug einen Hosenanzug aus einem fließenden seegrünen Stoff, und ihr voller Mund leuchtete rot. Die Flut ihrer kakaofarbenen Haare umloderte ihr Gesicht. Arissa sah viel jünger aus als siebenunddreißig, und er wusste, dass das manche Leute dazu verführte, sie nicht ernst zu nehmen. Doch Arissa machte das nichts aus; sie benutzte es vielmehr schamlos für ihre Ermittlungsarbeit.
Nick Merill fand seine Vorgesetzte hinreißend, ließ sich aber nichts anmerken. Anfangs, als er noch neu in Köln war, hatten zwei Kollegen von der Computerkriminalität ihn gewarnt, Arissa sei ein unverschämtes Luder. Sie sei dominant und eingebildet, und ihre Karriere verdanke sie hauptsächlich ihrer Bereitschaft, den allmächtigen Julius Brüggemann ranzulassen. Sie hatten ihm feixend geraten, ihr von Anfang an die Zähne zu zeigen, wenn er nicht hoffnungslos untergebuttert werden wollte. Natürlich hatte er diesen Blödsinn nicht unbesehen geglaubt, aber tatsächlich war er Arissa zu Anfang mit gehörigem Misstrauen begegnet. Doch inzwischen hatte sich das Blatt grundlegend gewendet, denn er war in Arissa verliebt. Und das, obwohl er wusste, dass er bei ihr nicht landen konnte, denn sie hatte es ihm in einer heftigen Auseinandersetzung gesagt. Ob das an seinem dicken Bauch lag, an seinen ruppigen Manieren oder an der Tatsache, dass er seit seiner Scheidung an der Flasche hing, hatte sie nicht gesagt. Auf jeden Fall zog sie ihm diesen eingebildeten Rechtsmediziner vor, der immer wie frisch aus dem Ei gepellt aussah - ein Trottel, der mit Vorliebe seidene Hemden trug, die mit Enten, Waschbären und ähnlichen kleinen Viechern bedruckt waren. Das Entenhemd, nannte Nick den Kerl bei sich.
Carolin Arissa schlängelte sich mit gemischten Gefühlen zwischen den Autos des dicht befahrenen Melatengürtels hindurch. Eine Formation von Dohlen zischte heiser krächzend über Merills Kopf hinweg, doch sein Gesicht blieb unbewegt. Aber ein alter Mann mit Baskenmütze hob drohend seinen Krückstock und beschimpfte die Vögel.
Vor rund fünf Monaten war Nick Merill von Stuttgart nach Köln strafversetzt und ihrem Mitarbeiterstab zugeteilt worden. Die Behörde hatte Merill vom Hauptkommissar zum einfachen Kommissar zurückgestuft, weil er sich als Kameradenschwein erwiesen und zudem den Polizeipräsidenten von Stuttgart geohrfeigt hatte. Erst später hatte Carolin erfahren, dass Merill als einziger Beamter aktiv gegen die auf der Stuttgarter Zentralwache übliche Misshandlung von Arretierten vorgegangen war.
Als einfacher Kommissar jedoch war er Arissa automatisch unterstellt, was anfangs endlose Schwierigkeiten verursacht hatte. Riedhammer von der Pressestelle hatte sie gewarnt, dass Nick Merill ein unverbesserlicher Macho sei, der sofort an ihrer Autorität kratzen und die Macht an sich reißen würde. Allerdings war Riedhammer ein berüchtigtes Klatschmaul, doch sie hatte zu viele Kerle gekannt, die exakt dieses Verhaltensmuster an den Tag legten. Daher war sie vor Nick Merill auf der Hut gewesen. Und tatsächlich hatte der degradierte und gedemütigte Merill wochenlang Feuer gespuckt, sich mit jedem Kollegen angelegt und sie mit seinem Zynismus fast verrückt gemacht. Doch im Verlauf ihres ersten gemeinsamen Falls – einer Mordserie durch eine mafiaähnliche Bande - hatten sich beide achten gelernt. Carolin hatte begriffen, dass Merill zwar schlechte Manieren hatte, aber über Sachverstand und einen ausgezeichneten kriminalistischen Instinkt verfügte, und Merill hatte grollend akzeptiert, dass Arissa nicht drauf aus war, ihn wie einen grünen Bengel durch die Gegend zu scheuchen.
Carolin betrachtete Nick unter gesenkten Wimpern, während sie sich zwischen den letzten fahrenden Autos durchwand. Merill war ein schwergewichtiger Hüne und nahezu eins neunzig groß. Er hatte ein aufsässiges, leicht teigiges Gesicht mit einer gebogenen fleischigen Nase. Nick war erst neununddreißig, wirkte aber viel älter. Seine rauchgrauen Augen sahen wässrig und verschwollen aus, und seine Züge waren gedunsen. Klar, Nick trank ganz schön.
„Hey, du siehst ja glänzend aus!“, krächzte Merill und verzog seine teigigen Züge zu einem Grinsen. „War’s nett in Madeira?“
Carolin lächelte, obwohl sie insgeheim verstimmt war. Warum zum Teufel hatte sie sich von Merill übertölpeln lassen? Viel lieber hätte sie mit Cedric noch einen Kaffee getrunken. Sie beschloss, gegen künftige Kontrollversuche Nicks wachsam zu sein. „Sehr nett“, erwiderte sie einsilbig, während sie hinter das Lenkrad des BMWs glitt.
6
Recife 8. September 2000
Sancho hockte auf einer dreifachen Lage Pappkartons und sog gierig an seiner Kleisterflasche. Es war eine dunkle, eiskalte Nacht. Routiniert unterdrückte er den Reizhusten, der sich zu Beginn des Schnüffelns unweigerlich einstellte und die Luftröhre wie Feuer reizte, aber schon lösten sich seine verkrampften Muskeln in Wohlbehagen auf. Er beobachtete gleichmütig, wie Tupi den Arm um die kleine Moa legte und die dünne, verfilzte Decke, die den Kleinen zum Wärmen diente, über den Schultern des Mädchens zurechtzupfte. Moa war das Küken der Bande. Tupi hatte sie verwahrlost, halb verhungert und durchgedreht auf dem Pflaster der Altstadt gefunden und das zu Tode erschöpfte Kind zu den Leoparden geschleppt. Nicht alle hatten sich über den Zuwachs gefreut. Besonders Luna beäugte die hübsche Sechsjährige argwöhnisch und hackte häufig auf ihr herum. Sancho verstand das durchaus, denn bevor Moa gekommen war, war Luna die einzige Frau der Bande gewesen. Außerdem war Luna seit einigen Monaten schwanger, und schwangere Frauen waren launischer als das Meer. Andrerseits war Moa ein Geschenk Gottes, denn sie half durch Betteln, die Gruppe zu ernähren. Schließlich war das Kind winzig und entzückend und erweckte noch einen Funken Rührung in Leuten, die das Elend, das an jeder Straßenecke lauerte, bereits sterbenssatt hatten. Außerdem war Moa fleißig: Sie sammelte Gemüsestrünke vom Boden der Markthalle und klaute manchmal sogar ein paar Erbsen oder ein Ei. Nichts Besonderes, aber ohne Moa hätten sie doch an manchen Abenden hungern müssen. Sancho betrachtete sie abschätzend. Die Kleine war eine Schönheit, aber ihre kinnlangen Löckchen waren eine Katastrophe.
„Moas Haare sind total verfilzt“, sagte er träge zu Luna, die sich neben ihm auf dem zerdrückten Pappkarton räkelte.
„Macht nichts“, schrie Luna aufgekratzt. „Dann machen wir ihr eben Zöpfchen.“ Sie sprang hoch und tänzelte auf Moa zu. „Who let se dog out? Wuff wuff wuff wuff!“, grölte sie und schwenkte provozierend ihren Hintern.
Sancho beobachtete sie mit finster zusammengezogenen Brauen. Er war hin- und hergerissen zwischen Entzücken und Wut. Entzücken, weil Luna sexy war und selbst mit ihrem Babybauch den Teufel im Blut hatte. Und Wut, weil sie schon wieder bis zu den Haarwurzeln zu gedröhnt war. Offenbar hatte sie sich, während er zum Pinkeln im Gebüsch war, ausgiebig an seiner Kleisterflasche bedient. Wie oft hatte er ihr schon verboten zu schnüffeln, weil sie dem Baby schadete!
„Du siehst aus wie eine Ratte!“, fuhr Luna die Kleine an. „Du musst besser auf dich aufpassen, verdammt nochmal! Wir haben hier keine Mama, die sich um uns kümmert. Straßenkinder sind stark und schlau. Los, kämm Dir die Haare!“
„Womit denn?“, jammerte Moa und gab sich Mühe, nicht zu weinen. „Ich hab doch keinen Kamm.“
Tupi baute sich mit dem Mut der Verzweiflung vor Luna auf und hob tapfer das Kinn. Er sah aus wie ein winziger Kater, der sich aufplustert, um einen aggressiven Dobermann zu beeindrucken. „Lass Moa in Ruh!“, quiekte er. „Ich kümmer mich schon um sie.“
„Tja, und super machst du das “, erwiderte Luna spöttisch. „Moa sieht aus wie ein verlaustes Schwein.“
„Ich geh mit ihr zum Springbrunnen und wasch sie“, bot Tupi an.
Luna lächelte träge und zog dem Jungen blitzschnell die kleine Kleisterflasche aus der schmuddeligen Faust. Mit dem Rücken zu Sancho gewandt nahm sie gehetzt zwei tiefe Züge. Der Klebstoff war noch flüssig und stark, und Lunas Augen verdrehten sich unter den betäubenden Dämpfen.
„Oh-kay“, sagte sie mit schleppender Stimme und stieß Tupi die Kleisterflasche wieder vor die Brust. „Und wasch Dich auch gleich selbst. Du bist dreckig wie eine Kanalratte.“ Sie musterte Tupi und Moa mit Widerwillen im Blick. Die Kleinen trugen zerfetzte Hemdchen und waren so schmutzig, als hätten sie sich im Rinnstein gewälzt. Aber wenn man seine Klamotten im Springbrunnen waschen musste, sahen sie eben nach kurzer Zeit wie Drecklappen aus. Außerdem stellte der alte Kerl, der den Springbrunnen bewachte, immer das Wasser ab, sobald er die Kinder zum Brunnen rennen sah. Anschließend schüttelte er die geballten Fäuste und drohte ihnen mit den Bullen, und den Kleinen blieb nichts übrig, als abzuhauen.
Luna zog die Stirn in Falten, während sie angestrengt nachdachte. Leider konnten Tupi und Moa auch nicht einfach ihre Mama in der Favela besuchen, um sich zu waschen und ihre Kleider zu säubern, so wie sie selbst es tat. Moas Mutter lebte als zugedröhntes Wrack unter irgendeiner Brücke in Recife, und Tupis Mutter war tot. Luna seufzte erschöpft und stakste zu ihrem Allerheiligsten, einer mit Herzchen geschmückten Kinderhandtasche aus glänzendem Plastik. Sie kniete sich auf den Pappkarton, wühlte in dem Handtäschchen und zog einen kleinen grünen Seifenrest hervor, den sie Tupi zuwarf. „Aber dass ihr mir ja nicht alles verbraucht!“, drohte sie. „Und wascht euch ordentlich. Wir heißen Leoparden und nicht Schweine. Und deshalb sehen wir auch nicht wie Schweine aus, kapiert?“ Sie drehte sich mit provozierendem Hüftschwung zu Sancho um. „Oder stimmt‘s vielleicht nicht, Schatzi?“
„Stimmt genau, Mäuschen.“ Sancho kratzte sich träge den wolligen Kopf über den Segelohren. Für seine fünfzehn Jahre war reichlich mickrig, kaum größer als ein Zwölfjähriger. Er war der Dunkelste der Bande und lebte schon seit sieben Jahren auf dem Pflaster. Mit acht war er von Zuhause fortgelaufen und hatte drei Brüder und vier Schwestern zurückgelassen. Sancho war der jüngste, und sein Vater hatte ihn nicht nur regelmäßig grün und blau geprügelt, sondern auch seine Kippen auf seiner Brust ausgedrückt.
Sancho setzte sein draufgängerischstes Grinsen auf und packte seine Freundin um die Hüfte. „Komm, wir gehen ein bisschen abseits“, raunte er mit tiefhängenden Lidern und nahm noch schnell zwei Züge aus der Klebstoffflasche. „Cielito, Du rührst den Topf um. Lass bloß nichts anbrennen, Kumpel.“ Wenn er so zugedröhnt war wie jetzt, wollte er einfach nur noch Lunas hübsche Brüste streicheln und sie ficken und ficken, bis sie sich ineinander verloren, und Hunger, Dreck und die Brutalität der Straße für einen köstlichen Augenblick von ihm abfiel.
Im Traum verzog die kleine Moa ihre Lippen zu einem seligen Lächeln. Sie wohnte wieder in ihrer alten Hütte, und Papa war so lebendig wie eh und je. Es war ein wundervolles Heim aus Sperrholz und Plastik mit einem festgetrampelten Lehmboden, den Mama jeden Tag ordentlich abschrubbte. Die Hütte war ein richtiges Zuhause mit zwei kleinen Zimmern, in denen sie alle schliefen und aßen - Papa, Mama und Moa mit ihren drei Geschwistern. Mama war wieder jung und hübsch. Sie trug das Baby Diego auf dem Arm und sang für den Kleinen ein schwermütiges Lied. Moa rannte überglücklich zu ihr hin und klammerte sich an ihre Wade, und Mama lachte und gab ihr ein Stück Mango. Der berauschende Saft der Mango tropfte Moa auf die Brust. Goldgelbes Sonnenlicht strömte durch die winzigen Fenster und lag in hellen Flecken auf dem glatten Lehmboden.
Plötzlich kreischte Tio Rodrigos Stimme in höchster Panik von draußen: „Marília, komm schnell, Rinaldo ist in die Zuckerrohrpresse geraten! Marília, um Christi willen, rasch, rasch!“ Immer wieder schrie Tio Rodrigo diese Worte, und jedes Mal war seine Stimme lauter. Das Licht in der Hütte war plötzlich ganz schwach, und Mama wurde vor Moas entsetzten Augen faltig und alt, während Tio Rodrigos schrille Stimme unablässig weiterkreischte. Dann war es schon fast finster in dem winzigen Raum, und Tio Rodrigo rüttelte wütend an der Tür, aber Mama trank aus der Cachaçaflasche und lachte ihr schreckliches heiseres Lachen. Sie ließ Diego achtlos auf den Lehmboden fallen, ohne sich weiter um das schreiende Kind zu kümmern. Moa schüttelte Mama und krächzte: „ Hast Du nicht gehört? Papa ist in die Zuckerrohrpresse gefallen!“ Doch Mama bekam ihr böses Gesicht und blähte sich vor Moas Augen zu einem grauroten Monster auf, das aus aufgequollenem Mund Unflätigkeiten grölte. Das Mamamonster hatte ganz tote Augen und riss den Mund weit auf, um Moa zu fressen...
Moa erwachte mit einem schrillen Schrei. Sie lag neben Tupi auf dem Pflaster, die zerrissene alte Decke notdürftig über den Beinen. Die Hütte und das Sonnenlicht waren weg. Es war Nacht, und es war kalt. Papa und Diego waren tot. Und Mama hauste unter irgendeiner Brücke und soff sich das Hirn aus dem Schädel.
Moa stöhnte trostlos und klammerte sich an Tupis Schulter fest.
Sie war ganz verlassen.
7
„Übrigens waren der Nasen-Rachenraum und die Speiseröhre des Jungen entzündet“, sagte Cedric Sommerfeld. „Das weist auf schweren, langanhaltenden Lösungsmittelmissbrauch hin, wie ich schon vermutet hatte.“ Er griff nach einem Scheibchen Baguette, das im Lafayette zusammen mit einem Töpfchen Kräuterbutter vor dem Essen serviert wurde. Das Lafayette war ein Steakhaus am Heumarkt, denn Carolin hatte Appetit auf Filetsteak bekundet.
Die Stimmung war allerdings keineswegs so heiter, wie er gehofft hatte. Carolin war unruhig und hatte bis jetzt über nichts anderes als den ermordeten Mulattenjungen ohne Augen geredet, dessen Sectio er am frühen Nachmittag vorgenommen hatte. Sie trug ein hochelegantes zyklamfarbenes Kleid mit Rückenausschnitt, das ihre Brüste und ihren Hintern eng umspannte, doch bis jetzt hatte sie sich nicht eine einzige private Bemerkung entschlüpfen lassen. Stattdessen saß sie da und spielte mit ihren Armreifen.
Auch er selbst war alles andere als gelassen, wie er sich widerstrebend eingestand. Normalerweise konnte er sich auf seine Selbstbeherrschung verlassen, aber heute war er scheußlich nervös, was eine neue Erfahrung für ihn war. Zumindest hatte er so etwas seit Fionas Tod nicht mehr erlebt.
Carolin nahm eines der kleinen braunen Holzpferde zur Hand, die als Dekoration auf allen Tischen standen. „Was war denn nun letztlich die Todesursache?“
„Der Kleine ist an Herzstillstand gestorben. Durch Ausblutung.“
„Hat man ihn so lange bluten lassen, bis das Herz versagte?“, fragte sie heiser.
Sommerfeld schüttelte den Kopf und steckte sich einen Happen gebuttertes Baguette in den Mund. „Der Täter hat den Tod des Jungen mit einem Operationssauger beschleunigt. Man steckt den Saugschlauch in die aufgeschlitzte Vena cava und kann einem Menschen damit in kürzester Zeit das ganze Blut aus dem Körper ziehen, worauf das Herz versagt, weil es kein Blut mehr zu transportieren gibt. Das Ganze dauert höchstens sieben Minuten, soweit ich weiß. Vielleicht auch weniger.“
Carolin zog eine Grimasse und kippte den Rest ihres Pinot blanc hinunter. Der Tod des Kindes war bedrückend und die Art seiner Ermordung widerlich und obszön. Andrerseits hatten sie beide in ihrem Beruf ständig mit dem Tod in seiner unerfreulichsten Form zu tun. Mit gewaltsamem Tod, der blutig und hinterhältig daherkam und Menschen vorzeitig und auf barbarische Weise aus dem Leben riss. Doch bei allem Mitgefühl mit dem anonymen toten Kind machte es keinen Sinn, mit Trauermiene beim Essen zu sitzen und sich anschließend in Magenkrämpfen zu winden. Den Toten gebührte Achtung, Mitgefühl und eine lückenlose Aufklärung der an ihnen begangenen Verbrechen.
„Der Operationssauger und die fachmännische Nierenentnahme lassen auf einen Chirurgen schließen“, sagte sie ruhig. „Was den Jungen angeht, so haben unsere Recherchen in allen nur denkbaren Vermisstenverzeichnissen nichts gebracht. Ein elf- bis dreizehnjähriger schwarzer Junge wurde von niemandem als vermisst gemeldet. Das überrascht mich nicht, denn es deutet alles darauf hin, dass es sich um ein obdachloses Kind handelt.“
Ein schmächtiger Kellner brachte zwei helle Holzteller, auf denen knusprig gebratene Steaks zwischen geschnitzten Radieschenrosen und leuchtenden Cocktailtomaten ruhten. „Ach, riecht das gut“, freute sich die ausgehungerte Kommissarin. Der Kellner, ein müder Mann mit dünnem Haar, dem die Füße wehtaten, lächelte gezwungen, wünschte ihnen guten Appetit und humpelte davon. Sommerfeld trank einen Schluck Scotch und sah zu, wie Carolin mit ihrem Messer herumfummelte. Sie war eindeutig nervös, aber bestimmt nicht wegen des ermordeten Kindes. Der Fall war widerwärtig und niederdrückend, aber gewiss machte er sie nicht nervös. War sie etwa seinetwegen nervös? Sein Herz begann schneller zu schlagen. „Hast du heute überhaupt schon was anderes zu dir genommen als schwarzen Kaffee?“, fragte er beiläufig.
„Nicht allzu viel“, räumte Arissa ein und prüfte mit einem kurzen Einschnitt, ob ihr Steak medium gebraten war. „Lass es Dir schmecken, Cedric.“ Keiner von beiden aß sein Fleisch bleu, denn manchmal sickerte aus solchen Stücken noch das Blut heraus, und Blut sahen sie beide in ihrem Berufsalltag zur Genüge. Carolin goss ein halbes Kännchen Sauce béarnaise über ihr Filetsteak, säbelte einen Bissen ab und kaute genüsslich. „Einfach Spitze! Dem Menschen, der die Sauce béarnaise erfunden hat, sollte man das Bundesverdienstkreuz zuerkennen.“
Sommerfeld lachte und schnitt sein Pfeffersteak an. Heut Morgen im Autopsiesaal hatte er sich wirklich weit aus dem Fenster gelehnt. Du hast mir schrecklich gefehlt! Ojeoje. Zwar hatten sie sich vor ihrem Abflug nach Madeira einmal hitzig geküsst, aber solch intime Geständnisse waren unter modernen Singles doch eher verpönt. Zu guter Letzt trieb er sie mit solchen Gefühlsergüssen noch auf und davon. Doch sie war seit mehr als fünf Jahren geschieden. Da könnte man doch vermuten, dass sie für eine neue Liebe zu haben wäre, oder? Allmählich fühlte er sich entspannter, aber es war wohl taktisch klüger, noch ein Weilchen den gemeinsamen Fall durchzukauen. „Der Junge hat unter beiden Füßen dick vernarbte Hornhaut. Das beweist, dass er den größten Teil seines Lebens barfuß gelaufen ist“, sagte er. „Und zwar nicht auf Gras oder Sand, sondern auf Stein, Beton und Asphalt.“
Carolin krauste die Stirn und legte ihr Besteck ab. „Lebenslanges Barfußlaufen ist hierzulande nicht üblich, nicht mal bei Straßenkindern. Vielleicht stammt der Junge gar nicht aus Deutschland. Vielleicht wurde er hergebracht. Vielleicht ist er ein Straßenkind aus Übersee, aus irgendeinem südamerikanischen Land. Da leben ganze Horden von verlassenen Kindern auf der Straße und betäuben sich mit Schnüffelstoffen, und die meisten von ihnen sind schwarz oder Mulatten. Vielleicht stammt er auch von den karibischen Inseln.“ Sommerfeld nickte; das klang plausibel. Er griff nach der Pinot Blanc-Flasche und füllte Carolins leeres Glas auf.
Arissa erwärmte sich für ihre Idee. „Viele Mulatten leben an der Ostküste Lateinamerikas, vor allem in Venezuela und Brasilien. Und natürlich in Kolumbien. Möglicherweise auch in Argentinien und Paraguay, aber da muss ich mich erst mal informieren. Doch egal, wo er herkommt, umgebracht wurde er todsicher hier. Und wenn die Nierenexplantation wirklich von einem Fachmann gemacht wurde, müssen wir uns auf die Jagd nach einem Chirurgen machen, der so eine Operation beherrscht. Da kommen bestimmt nicht nur Bauchchirurgen in Frage.“
„Nein, garantiert auch andere Fachärzte wie Gefäßchirurgen, Handchirurgen oder Unfallchirurgen.“ Sommerfeld betrachtete Carolins Lippen, seufzte und nahm einen Schluck Scotch.
Arissa tunkte einen Happen Steak in die Sauce Béarnaise. „Wenn der Junge wirklich aus Lateinamerika stammt, haben wir allerdings ein Problem. Südamerika ist riesig, und ein namenloses Straßenkind oder ein Kind aus den Slums wird nur schwer zu identifizieren sein. Wir brauchen ein erkennungsdienstliches Foto des Kleinen. Man kann ihm doch sicher Glasaugen einsetzen, die einigermaßen natürlich aussehen?“
„Klar, das kann Sybille Jakuwitz machen. Sybille hat ein wunderbares Händchen für die Leichentoilette.“
„Okay, dann bringen wir ein Foto des Kleinen in den Fernsehnachrichten und bitten die Bevölkerung um Unterstützung.“ Arissa seufzte. „Wenn wir nur irgendwas hätten, das uns bei der Identifizierung weiterhilft.“
„Ich wusste doch, dass ich Dir heute noch eine Freude machen kann.“ Sommerfeld streckte die Hand aus und strich leicht über Carolins Fingerspitzen. Ihre Finger bebten ein wenig, und er zog seine Hand zurück, erschrocken und entzückt zugleich.
„Du hast was gefunden?“, japste Carolin. „Was denn, was?“
„Etwas, das Dich glücklich machen wird.“ Cedric lächelte, lehnte sich zurück und trank einen weiteren Schluck Scotch.
„Herrjeh, nun spuck’s schon aus!“
„Drei Haare. Sie klebten auf dem linken Unterschenkel des Jungen.“
Arissa spürte, wie sie trotz des bedrückenden Falles schneller atmete. „Was für Haare? Wurden die schon untersucht?“ Cedric lachte. Carolins schwarze Augen waren leicht zusammengekniffen, und ihr Gesicht trug einen Ausdruck fiebriger Jagdlust. „Lach nicht, Du Mistkerl. Du willst mich bloß auf die Folter spannen. Was für Haare?“
„Sykownik vermutet, dass es Tierhaare sind.“
„Tierhaare, na, besser als nichts. Ist das Tier schon bekannt?“
„Sykownik glaubt, dass es Hundehaare sind.“ Sommerfeld trank noch einen Schluck Scotch. „Hundehaare hätten eine typische, spatenförmige Wurzel, behauptet er. Allerdings ist Sykownik Chemiker, also…“
„Hundehaare! Das ist vielleicht eine Chance.“ Arissa griff erneut nach einem der kleinen braunen Holzpferde und drehte es gedankenverloren in den Händen. „Hunde sind Haustiere. Wilde Hunde gibt es in Deutschland kaum, ausgenommen ausgesetzte und stromernde Hunde natürlich. Die Haare eines Haushunds aber können uns direkt zum Täter führen. Ein Haushund verrät sein Herrchen so gewiss, als hätte der Kerl seine Visitenkarte zu Füßen der Leiche abgelegt. Vorausgesetzt natürlich, wir finden den Hund.“ Sie setzte das Pferd mit einem kleinen Knall auf die Tischplatte zurück. „Diese Haare müssen pronto zum Landeskriminalamt Düsseldorf. Falls es wirklich Hundehaare sind, brauchen wir die DNA.“
„Ich hab noch was, das dir Freude machen wird. Wir haben auf der Kopfhaut des Kindes ein erbsengroßes Stück einer weißlichen, transparenten Substanz gefunden. Sykownik ist sicher, dass es Klebstoff ist. Auf jeden Fall roch es stark nach Toluol, als er es angeschnitten hat. Und Toluol ist laut Sykownik in den meisten handelsüblichen Klebstoffen enthalten.“
„Hervorragend! Das muss natürlich auch zum Landeskriminalamt.“
Cedric erhob sein halbleeres Whiskyglas und schenkte ihr ein Raubtierlächeln. „Trinken wir auf die hübscheste und klügste Frau, die mir in den letzten Jahren begegnet ist.“
Carolin blickte in seine Augen. Eine warme Blutwelle rauschte durch ihren Körper und benebelte ihr den Verstand. „Wirklich charmant“, erwiderte sie ironisch, doch zu ihrer Bestürzung klang ihre Stimme belegt. Zum Teufel, was redete sie da? Cedric musste sie ja für komplett bescheuert halten, wenn sie sich bloß wegen eines Kompliments von ihm fast in die Hosen pinkelte. Sie trank ihm zu und blickte dann verwirrt auf ihr Filetsteak nieder. Sie spürte ihr Herz in der Kehle. In solchen Fällen nützt einem auch ein abgeschlossenes Psychologiestudium nichts, dachte sie und seufzte. Zornig über ihren beschämenden Mangel an Selbstsicherheit zwang sie sich, wieder in Sommerfelds dunkles Gesicht zu blicken.
„Das ist kein Charme“, sagte Cedric. Er lächelte und berührte ihre langen dünnen Finger. „Ich bin glücklich, dass Du endlich wieder da bist, Carolin.“
8
Recife, 8. September 2000
Fuscão Pereira war wütend. In seiner Mailbox war nur eine einzige Nachricht.
Tante Alba wünscht sich zum Geburtstag zwei kleine Päckchen Katzenzungen und eine Flasche Jamaica-Rum. Außerdem ein kleines Päckchen Nusspralinen und eine Flasche Kognak. Bitte vergiss Tante Albas bescheidene Wünsche nicht. Ihre Geburtstagsfeier findet am 12. September um 20 Uhr 30 statt. Einfache Abendkleidung erwünscht.
Er starrte auf den Bildschirm und kaute erregt auf dem Kopf eines roten Cocktailspießchens herum. Das Rauchen hatte er sich schon vor langer Zeit abgewöhnt, denn seine angegriffenen Lungen, die er den Jahren auf der Straße und dem Schnüffeln verdankte, vertrugen einfach keine Zigaretten mehr. Es krachte laut, als Fuscão den Cocktailspieß in der Mitte durchbiss. Er spuckte die zerbrochenen Teile auf die Fliesen und stampfte mit dem Absatz darauf herum. Dann schloss er widerwillig die linke Schreibtischschublade auf und fischte eine gedruckte Liste heraus. Er ging den Code der Mail durch und machte sich dabei Notizen. Pereira dechiffrierte den Code immer