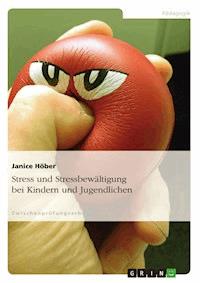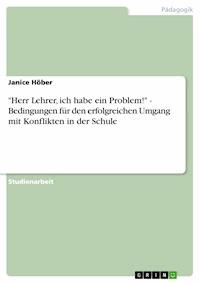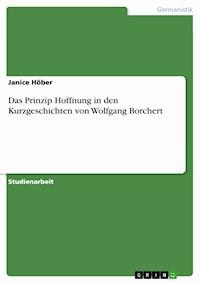15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Didaktik - Germanistik, Note: 1,7, Universität Potsdam (Institut für Germanistik), Veranstaltung: Lesen und Vorlesen - Theorie und Geschichte, Sprache: Deutsch, Abstract: Lesen wurde jahrhundertelang durchweg als Vorlesen praktiziert. Sowohl in der Antike als auch im Mittelalter war es selbstverständlich, dass, wenn öffentlich oder individuell gelesen wurde, dies grundsätzlich laut geschah. Seit der frühen Neuzeit bildeten sich neue Formen des lauten Vorlesens heraus. Gemeint ist damit jenes Vorlesen, „das sich komplementär zum stillen Lesen in privatem Rahmen entwickelte und Formen einer intimen Geselligkeit und informellen Öffentlichkeit ausbildete.“ Im Barock entstanden so genannte literarische Zirkel, in denen sich die dort verkehrenden Autoren ihre Dichtungen gegenseitig laut darboten. Auf dieser Basis entwickelte sich zu Beginn des 17. Jahrhunderts eine eigenständige ästhetische Vortragskunst, die dazu diente, die Qualität der vorgetragenen Texte zu testen. Beim Theater diente die Vorleseprobe den Schauspielern oder dem Regisseur in erster Linie als Auseinandersetzung mit dem Stück. All das geschah letztendlich vor dem Hintergrund, die deutsche Sprache zu pflegen, zu vereinheitlichen und hoffähig zu machen. Eine selbstständige Vorlesekunst lässt sich erst um 1750 nachweisen. Heute sind es vor allem die Schauspieler, die die Rolle des Vorlesers übernehmen und einem sich dafür begeisternden Publikum Texte meist schon verstorbener Autoren vortragen. Jedoch verhindern die seit den 20-er Jahren des 20. Jahrhunderts aufgekommenen Medien, wie Rundfunk, Fernsehen, Schallplatte, Tonband oder CD, die völlige Wiederbelebung der alten Tradition. Statt der öffentlichen Lesung gewinnen medienvermittelte Vorlesungen, wie zum Beispiel in Form des Hörbuchs, zunehmend die Oberhand. Wie wichtig das Lesen und Vorlesen von und aus Büchern vor allem im Kindesalter ist, wird von verschiedenen Seiten immer wieder bestätigt, denn es regt nicht nur die Fantasie an, sondern fördert auch die individuelle sprachliche Entwicklung. Darüber hinaus wird Lesen als Basiskompetenz für lebenslanges Lernen angesehen. Um so alarmierender wirken die PISA-Ergebnisse, aus denen hervorgeht, dass die deutschen Mädchen und Jungen erhebliche Defizite im Bereich der Lesekompetenz aufweisen und zu 42 Prozent sehr ungern lesen. Da Kinder nicht als Leseratten geboren werden, ist es die Aufgabe der Familie und der Schule, und hier vor allem des Deutschunterrichts, sie zum Lesen zu motivieren und in ihnen die Freude am Lesen zu wecken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Page 1
Universität Potsdam Institut für Germanistik Abt. Literaturwissenschaft
Lesen und Vorlesen - Theorie und GeschichteHauptseminar (WS 2006/07)
Janice HöberStudentin:
Studiengang:LA Gymnasium (Musik/Deutsch)
Abgabedatum:13.03.2007
9821Wörter:
Page 1
1. Einleitung
1.1 Hinführung zum Thema
Lesen wurde jahrhundertelang durchweg als Vorlesen praktiziert. Sowohl in der Antike als auch im Mittelalter war es selbstverständlich, dass, wenn öffentlich oder individuell gelesen wurde, dies grundsätzlich laut geschah.
Da lange Zeit von einer illiteraten Gesellschaft ausgegangen werden muss, wird weiterhin angenommen, dass das Vorlesen zunächst den Schreibern von Dokumenten als Absicherung ihrer Arbeit diente. Und zwar dahingehend, dass sie die Schriften nach Fertigstellung den Auftraggebern, meist adligen Grund- und Gerichtsherren, die in der Regel nicht lesen konnten, zur Kontrolle vorlasen. Gleiches gilt auch für die seit dem frühen Mittelalter überlieferten Regesten, Verordnungen, Privilegien und Verfügungen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eine ähnliche Überprüfung erfahren haben, ehe sie von den Machthabenden genehmigt wurden.
Im Mittelalter gehörten nicht nur die freie Predigt sowie das Rezitieren zu den wichtigsten Formen der gesprochenen deutschen Sprache. BENEDIKTVONNURSIA erklärte sogar per Satzung das Vorlesen zu einem wesentlichen Bestandteil des Klosteralltags, wobei dies laut Artikel 38 seines Regelwerks nach genauen Vorgaben geschehen sollte:
„Zu den Mahlzeiten der Brüder soll stets gelesen werden; doch keiner möge es wagen, aufs Geratewohl zum Buch zu greifen und mit dem Lesen anzufangen; sondern der, welcher dieses Amt für eine ganze Woche übernimmt, soll damit am Sonntage beginnen.“1
Doch auch vor den Klostermauern wurde das Vorlesen zu einer notwendigen und weit verbreiteten Praxis, da nur wenige diese Fertigkeit beherrschten und Bücher zudem recht teuer waren.
Seit der frühen Neuzeit bildeten sich neue Formen des lauten Vorlesens heraus. Gemeint ist damit jenes Vorlesen, „das sich komplementär zum stillen Lesen in privatem Rahmen entwickelte und Formen einer intimen Geselligkeit und informellen Öffentlichkeit ausbildete.“2
1zit. n. Manguel, A. (1998), S. 139
2Meyer-Kalkus, R. (2001), S. 234
Page 2
Im Barock entstanden so genannte literarische Zirkel, in denen sich die dort verkehrenden Autoren ihre Dichtungen gegenseitig laut darboten. Auf dieser Basis entwickelte sich zu Beginn des 17. Jahrhunderts eine eigenständige ästhetische Vortragskunst, die dazu diente, die Qualität der vorgetragenen Texte zu testen. Damit ist zu jener Zeit jedoch nicht das Verfassen von möglichst originellen, sondern vielmehr der „Schulmeinung und entsprechenden Dichterlehren“ angemessenen Texten gemeint.3Beim Theater diente die Vorleseprobe den Schauspielern oder dem Regisseur in erster Linie als Auseinandersetzung mit dem Stück. All das geschah letztendlich vor dem Hintergrund, die deutsche Sprache zu pflegen, zu vereinheitlichen und hoffähig zu machen. Eine selbstständige Vorlesekunst lässt sich erst um 1750 nachweisen. Die daraus hervorgegangene Autorenlesung ist bis in die 60-er Jahre des 20. Jahrhunderts erhalten geblieben und erfreute sich größter Beliebtheit, was E. OCKEL auf die Neugier des Leserpublikums zurückführt, das die Schriftsteller und Autoren ihrer Bücher persönlich kennen lernen wollte.4Trotz des Interesses seitens der Zuhörerschaft verschwand diese öffentliche Lesekultur jedoch weitestgehend.