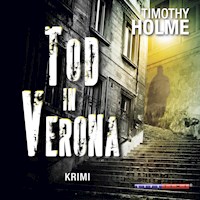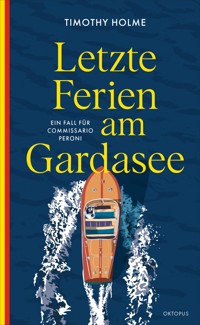
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: OKTOPUS by Kampa
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
An einem sonnigen Morgen im Juli wird am Ufer des Gardasees die Leiche einer jungen Frau angespült. Ein Carabiniere, als Erster am Fundort, geht von einem Unfall aus: Immer wieder unterschätzen Touristen die Gefahr plötzlich aufziehender Stürme, für die der See berühmtberüchtigt ist. Er will die Akte schließen, ehe sie überhaupt angelegt wurde. Commissario Achille Peroni aber ist überzeugt, dass die Frau nicht ertrunken ist. Und er kann die Tote identifizieren. Erst vor drei Tagen hat er eine nächtliche Bootsfahrt mit Cordelia Hope unternommen und sie als versierte Seglerin kennengelernt. In Venedig stationiert, hatte Peroni überraschend frei bekommen und entschieden, seine Schwester zu besuchen, die gerade Urlaub am Gardasee macht – zu Peronis Leidwesen auf einem Campingplatz. Der Flirt mit der attraktiven Geschichtsstudentin aus Oxford war ihm ein willkommener Zeitvertreib, auch wenn Cordelia unnahbar blieb und ihn immer wieder warten ließ, um ihren Recherchen nachzugehen. Was suchte sie wirklich am Gardasee?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Timothy Holme
Letzte Ferien am Gardasee
Ein Fall für Commissario Peroni
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Klaus Timmermann und Ulrike Wasel
Oktopus
Teil 1Tod im Wasser
1
Ein kiesiger Uferstreifen am Gardasee, eines Morgens imJuli. Die Feriengäste sind noch nicht aus den Federn, aber die Sonne ist bereits aufgegangen, und ihre Strahlen lassen das Wasser silbrig aufleuchten, wenn es ans Ufer plätschert, trügerisch ruhig, gemessen an dem Unwetter der vergangenen Nacht. Hinter dem Strand ragen Zypressen majestätisch in den azurblauen Himmel, und noch etwas weiter weg schmücken Olivenbäume den Hang mit Silbergrün. In der Luft liegt ein kaum wahrnehmbarer Hauch von Zitronenduft.
Nur eines verunziert diese idyllische Szenerie: eine menschliche Leiche, das Gesicht nach unten, mit langem roten Haar, das sich im Wasser bewegt, als hätte es ein Eigenleben. Sie ist jung, weiblich und gut gebaut, mit einem gelben T-Shirt, Jeans und Turnschuhen bekleidet. Das Gesicht noch immer abgewandt und mit der Nase sacht über einen Kieselstein reibend, harrt sie ihrer Entdeckung.
Die ist bereits im Anzug. Ein Junge, der früh aufgestanden ist, kommt um eine Biegung auf den Uferstreifen. Er ist so sehr darin vertieft, Kieselsteine über die glatte Wasserfläche des Sees hüpfen zu lassen, dass er die Leiche erst sieht, als er schon fast darauftritt. Bei ihrem Anblick weicht er verschreckt zurück. Dann übermannt ihn die Neugier, er macht einen vorsichtigen Schritt nach vorn und bückt sich, um sie genauer zu betrachten. Er hat noch nie eine Leiche gesehen, und dank seiner Jugend lässt ihn diese Erfahrung noch einigermaßen unberührt. Er würde gern ihr Gesicht sehen, aber einerseits hat er eine gewisse Scheu, die Leiche anzufassen, andererseits befürchtet er, dass er Ärger mit den Erwachsenen bekommt, wenn er es tut.
Nach ungefähr einer Minute kommt er zu dem Schluss, dass etwas geschehen muss, und mit einem letzten Blick auf die vom Wasser geschaukelte Gestalt, um sie sich einzuprägen, damit er sie seinen Freunden beschreiben kann, wendet er sich um und rennt über den Strand zu einem schmalen Weg, der ins Dorf führt.
Wenige Minuten später ist er mit einem halben Dutzend Erwachsener zurück. Er zeigt aufgeregt auf die Leiche und ruft auf italienisch: »Da ist sie! Seht ihr? Ich hab’s euch doch gesagt!« Offenbar waren die Älteren geteilter Meinung im Hinblick auf seine Glaubwürdigkeit gewesen.
Zwei der Männer gehen zögernd ans Wasser. Die Frauen drängen sich zusammen, ihre Mienen spiegeln eine Mischung aus Faszination und Entsetzen. Die Leiche wird aus dem Wasser gezogen, auf den Rücken gedreht und auf den Strand gelegt. Selbst der Tod und eine bislang noch unbestimmte Zeit im Wasser haben die Tatsache nicht auslöschen können, dass die junge Frau schön war.
Eine Frau bekreuzigt sich, und der Rest der Gruppe tut es ihr nach, einschließlich des kleinen Jungen. Eine Jacke, das am besten geeignete und greifbare Kleidungsstück, wird pietätvoll über das tote Gesicht gebreitet, und dann, nach hastigem Getuschel, machen sich zwei aus der Gruppe auf und gehen über den Weg ins Dorf.
Es dauert etwas länger als bei dem Jungen, bis sie zurückkommen, und als es so weit ist, sind sie in Begleitung von zwei Carabinieri und einem Priester in schwarzer Soutane. Während der Priester mit gesenktem Kopf neben der Leiche steht und die Lippen im Gebet bewegt, hebt der ältere der beiden Carabinieri – ein unentwegt zynisch dreinblickender Brigadiere, der offenbar schon mehr Wasserleichen gesehen hat, als ihm lieb ist – die Jacke hoch und studiert das Gesicht der toten Frau mit professionell abschätzendem Blick. »Ist wahrscheinlich letzte Nacht bei dem Unwetter draußen gewesen«, sagt er zu seinem Kollegen. »Manche fordern es einfach heraus.«
Mehr Menschen treffen ein und drängen sich heran, um etwas von der Tragödie mitzubekommen, glotzen, flüstern, gaffen. Der zweite Carabiniere scheucht sie weg, auf respektvollen Abstand.
Dann taucht ein einzelner Mann auf, bleibt an der Stelle stehen, wo der Weg auf den Strand trifft, und starrt auf die Szenerie, wie von einer entsetzlichen Vorahnung erfasst. Er ist ein dunkler südländischer Typ mit sehr weißen Zähnen und durchdringenden schwarzen Augen, die zu romantischer Zärtlichkeit fähig sind. Nach ein paar Sekunden setzt er sich widerwillig, fast ängstlich in Bewegung, nähert sich der Leiche, wobei seine Mokassins auf dem Kies knirschen.
Als er herankommt, blickt der Brigadiere zornig auf und will ihn schon fortjagen, doch dann erkennt er ihn offenbar, und sein Verhalten wird unangenehm kriecherisch. »Dottor Peroni!«, sagt er. »Ich wusste gar nicht, dass Sie hier am See sind.« Er stockt, erstaunt über den Gesichtsausdruck des Südländers, der nach unten auf das tote Gesicht blickt. »Haben Sie sie gekannt?«, fragt er.
Einen Moment lang antwortet der Mann, den er Peroni genannt hat, nicht. Dann schüttelt er den Kopf. »Nein«, sagt er, »nein …«
»Einen kurzen Moment habe ich gedacht …«, sagt der Brigadiere, dann überlegt er es sich anders. »Komisch, dass aus gerechnet Sie jetzt hier auftauchen«, sagt er stattdessen. »Ich meine, genau in dem Augenblick, wo eine Leiche gefunden wird. Aber das fällt nicht in Ihr Ressort, Dottore – bloß wieder jemand ertrunken. Um diese Jahreszeit kommt das hier so häufig vor wie Verkehrsunfälle.« Er blickt wieder nach unten auf die Leiche. »Sieht aus wie eine Ausländerin«, sagt er. »Ganz schön dämlich, die Leute.«
Commissario Achille Peroni hätte nur schwer erklären können, warum er auf die Frage, ob er Cordelia kannte, gelogen hatte. Er hatte nichts zu befürchten, wenn ihre weiß Gott unschuldige Beziehung bekannt würde, und noch weniger zu gewinnen, wenn er sie verschwieg. Sein Leugnen war instinktiv gewesen, wahrscheinlich weil ihm die Vorstellung zuwider war, sich unter dem gleichgültigen Blick eines Carabiniere, der ihn zufällig erkannt hatte, so verwundbar zu zeigen. Außerdem war er bedenklich aus dem Gleichgewicht geraten.
Er hatte schlecht geschlafen, wie von bösen Vorahnungen gequält. Schon bevor er zu Bett gegangen war, hatte er gehört, wie sich das Unwetter über dem See zusammenbraute, aber es war nicht sonderlich schlimm, und nach dem, was drei Nächte zuvor passiert war, machte ihm das allein noch keine großen Sorgen. Trotzdem wurde er immer wieder von Furcht gepackt, wie in einem nicht enden wollenden Albtraum. Schließlich war er dann früh aufgestanden und hatte einen Spaziergang am See gemacht, aber noch immer lag ihm das Gefühl einer drohenden Katastrophe im leeren Magen. Nach einer Weile – zwanzig Minuten? Halbe Stunde? – kam er an den schmalen Weg, der hinunter zum See führte, und schlug ihn ein. Als er dann den Strand erreichte, erkannte er sofort, wenn nicht die Leiche, so doch die Situation: die murmelnde, ungewöhnlich ernste Menschenmenge, um einen jähen Tod versammelt, die Carabinieri bei ihrer schmutzigen, unangenehmen Arbeit. Und fast augenblicklich sagten ihm sein Herz und ein flüchtiger Schimmer von rotem Haar, dass es Cordelias Leiche war.
Hatte er im Verlauf ihrer kurzen Bekanntschaft geahnt, dass eine Tragödie drohte? Der gesunde Menschenverstand würde sagen Nein, aber gesunder Menschenverstand war noch nie die starke Seite des neapolitanischen Gassenjungen gewesen, der sich nur allzu oft im Innern des rationalen Polizei-Commissario zu Wort meldete.
Die Folge von Ereignissen, die zu diesem Morgen führte, hatte begonnen, als Peroni – mittlerweile in Venedig stationiert – unerwarteterweise im heiß begehrten Juli zehn Tage Urlaub bekam. Er war derart überrascht, dass er zunächst nicht wusste, was er mit seiner Zeit anfangen sollte. Schließlich beschloss er, eine Einladung seiner Schwester Assunta und ihres Mannes Giorgio anzunehmen, die auf einem Campingplatz in der Nähe des Dorfes Garda am See gleichen Namens ihre Ferien verbrachten. Die pubertierenden Kinder der beiden, Anna Maria und Stefano, waren auch dort, aber da sie das urwüchsige Campingleben bevorzugten und lieber mit ihren Freunden in Zelten übernachteten, war im Wohnwagen reichlich Platz für Peroni.
Es gefiel ihm nicht. Wohnwagen sind einfach zu klein, selbst für den bescheidensten Lebensstil. Er hockte nicht gern auf einem Zinnklosett für Zwergwüchsige und hatte keine Lust, sich in einem Badezimmer von der Größe eines Schachbretts zu waschen, aber noch weniger behagte es ihm, morgens verschlafen hinüber zu den öffentlichen Waschräumen zu schlurfen und sich in die Schlange der jovialen, geschwätzigen Campinggenossen einzureihen. Es missfiel ihm auch, unter freiem Himmel zu essen, wie Giorgio es so gern tat, auf einem Campingstuhl, der schon zusammenbrach, wenn man ihn bloß ansah, und von einem Puppenstubentisch, der wackelte, ganz gleich, mit wie viel Mühe man ihn ausbalancierte. Und dann lernte er Cordelia kennen und beschloss, dass es Umstände gab, unter denen man über die Unannehmlichkeiten selbst des Fegefeuers hinwegsehen konnte.
Vor fünf Tagen hatte er sich, um seine campingstrapazierten Nerven mit einem vormittäglichen Aperitif zu stabilisieren, ins Dorf davongeschlichen und die Kinder schwitzend beim Tennis zurückgelassen, während Assunta das Mittagessen kochte und Giorgio draußen vor der Tür saß, ein Taschentuch auf dem Kopf und in die Lektüre des Lokalblattes vertieft. Nachdem sich Peroni an einem Tisch auf der Terrasse des Caffè im Miniaturhafen des Dorfes niedergelassen hatte, war ihm ein Kopf mit verführerisch rotem Haar aufgefallen, der am Nachbartisch in Kniehöhe auf und ab wippte, und ihm wurde klar, dass ihn nichts daran hindern konnte, den einzigen Sport zu praktizieren, der ihn interessierte, selbst hier am See.
»Kann ich Ihnen behilflich sein?«, fragte er in seinem grässlichen Englisch, auf das er so stolz war, denn er hatte neben dem Fruchtsaft auf ihrem Tisch eine Ausgabe der Times bemerkt.
»Ja«, sagte sie, richtete sich auf und blinzelte in seine Richtung, »Sie können mir helfen, eine Kontaktlinse zu suchen, die mir runtergefallen ist.«
Peroni konnte fast alles auf Englisch sagen oder glaubte es zumindest, aber das Problem begann, so musste er sich eingestehen, wenn es darum ging, das zu verstehen, was Engländer ihm erwiderten. So hatte er auch jetzt kein einziges Wort ihrer Antwort auf seine angebotene Hilfe verstanden. »Wie bitte?«, sagte er.
»Sie können mir helfen«, sagte sie, diesmal in exzellentem Italienisch, »eine Kontaktlinse zu suchen, die mir runtergefallen ist.«
»Ach ja, natürlich«, sagte Peroni, sich nun gleichfalls mit Italienisch begnügend, jedoch durch die problemlose Kontaktaufnahme getröstet. Dann hockte er sich neben ihren Tisch und suchte den Boden nach der Kontaktlinse ab. Als er sie gefunden hatte, richtete er sich auf und bot sie ihr in der flachen Hand dar.
»Danke«, sagte sie. »Moment, ich muss sie eben wieder einsetzen.« Das tat sie geschickt und ohne falsche Scham, dann fuhr sie fort: »Ich bin ohne fast blind, aber auch zu Eitel, eine Brille zu tragen, außer bei der Arbeit.«
»Arbeit?«
»Na ja, Studium.«
»Sie sind Studentin?«
»Ganz recht.«
Völlig natürlich, ohne unhöflich zu sein oder ihm ermunternde Signale zu geben, nahm sie die Times und vertiefte sich in das Kreuzworträtsel. Während sie das tat, studierte Peroni ihr Gesicht. Es war ein faszinierendes Gesicht, klar und offen, mit ehrlichen blauen Augen und einem leichten Hauch von Sommersprossen. Das Kinn zeigte ein zartes Grübchen, und die Form der Lippen ließ einen gewissen Eigensinn erkennen. Sie trug kein Make-up.
Sein Blick wanderte von ihrem Gesicht zur rechten Hand, die mit verblüffender Geschwindigkeit über das Rätsel glitt, und als er sich leicht vorbeugte, um besser sehen zu können, stellte er fest, dass sie gerade dabei war, es abzuschließen. Er sah ihr zu, während sie die letzten Kästchen ausfüllte.
»Zu einfach«, sagte sie und legte die Zeitung hin. Dann wurde ihr Gesichtsausdruck plötzlich sehr sachlich. Sie warf einen Blick auf die Herrenuhr, die sie trug, trank ihren Fruchtsaft aus und stand auf. »Ich muss los.« Sie hängte sich eine Segeltuchtasche, die neben ihr stand, über die Schulter.
»Schon?«
»Ich bin verabredet.«
»Kann ich Sie wiedersehen?«
Sie betrachtete ihn einen Moment mit nachdenklichen blauen Augen. »Sind Sie verheiratet?«
Peroni starrte sie an; an solche Reaktionen war er nicht gewöhnt. Er suchte nach einer geistreichen Replik, fand aber keine. »Nein«, sagte er.
»Na dann, sehr gern.«
»Wollen wir heute Abend zusammen essen?« Sie überlegte kurz, nickte dann.
»In welchem Hotel wohnen Sie? Ich hole Sie ab.«
Sie legte das Geld für ihren Saft auf den Tisch. »Keine Sorge. Ich bin um halb acht hier.«
Und ohne jegliche weitere Formalität wandte sie sich um und ging. Peroni sah ihr nach. Trotz ihrer Direktheit hatte sie etwas an sich, das er nicht genau fassen konnte. Es verwirrte ihn.
2
Ich empfehle den Risotto. Er wird mit Schleie zubereitet,nach einem Rezept, das seit über einem Jahrhundert im Besitz der Familie ist.«
»Dann also Risotto, sehr gern.«
Sie war mit einer, wie Peroni fand, unweiblichen Pünktlichkeit am Hafen erschienen und trug zu seiner gelinden Überraschung und beträchtlichen Freude ein langes dunkelblaues Kleid, das ihre wallende rote Haarpracht wirkungsvoll akzentuierte. Außerdem lag in ihrem Verhalten eine gedämpfte Fröhlichkeit, die, wie er irritiert begriff, nicht seiner Person galt. »Wie ist Ihre Verabredung gelaufen?«, fragte er, weil er darin die Ursache vermutete.
»Sehr gut«, sagte sie und wechselte dann geschickt und höflich das Thema.
Peroni verspürte eine irrationale Eifersucht, weil sie ihm etwas vorenthielt, aber er hatte das Gefühl unterdrückt, so gut er konnte, und war mit ihr in das nahe gelegene Dorf Lazise gefahren, wo sie sich, an einem anderen Miniaturhafen, für ein Restaurant direkt am Wasser entschieden hatten.
»Machen Sie Ferien hier?«
»Ja.«
»Warum gerade hier?«
Peroni hatte das deutliche Gefühl, überraschend um eine Ecke zu biegen und gerade noch mitzubekommen, wie irgendetwas im letzten Moment versteckt wurde, sodass er es nicht mehr sehen konnte. Seine Neugier stieg um etliche Grade an.
»Warum denn nicht hier? Es ist ein bekanntes Urlaubsgebiet, das Klima ist wundervoll, die Landschaft bezaubernd, und der See ist zum Segeln einfach ideal. Also was ist daran so erstaunlich?«
»Nichts«, sagte Peroni, mehr denn je davon überzeugt, dass sie ihm etwas vorenthielt. »Darf ich Ihnen noch Wein einschenken?«
Er durfte, und sie tranken schweigend, während sie einen Schwarm kleiner Fische beobachteten, der scheinbar ziellos im Wasser zu ihren Füßen umherschwamm. Dann kam der Risotto.
»Auf welche Universität gehen Sie?«, fragte Peroni beim Essen.
»Oxford. Und Sie müssen gar nicht so beeindruckt gucken.«
»Und welches Fach?«
»Geschichte.«
»Ich hätte auf Sprachen getippt. Ihr Italienisch ist perfekt.«
»Danke für das Kompliment. Sprachen liegen bei uns in der Familie. Wir betrachten sie nicht als anstrengenden Lernstoff, sondern als Freizeitbeschäftigung.«
Peroni hob die Augenbrauen. Wie gern hätte er dasselbe über sich und sein Englisch gesagt. »Wie viele sprechen Sie?«
»Oh, Französisch, Deutsch, Spanisch, die üblichen, plus Griechisch und Russisch. Und zurzeit lerne ich Hebräisch. Es tut mir leid – das klingt so angeberisch, aber ich kann nur wiederholen, dass man mir beigebracht hat, Sprachen als eine Art Spiel zu betrachten. Aber hören Sie, wir fallen hier in das konventionelle männlich-weibliche Muster, bei dem der um einiges ältere, aber sehr gut aussehende Mann die Fragen stellt und die geschmeichelte, Wimpern klimpernde Frau brav antwortet. Lockern wir das Ganze ein bisschen auf. Was machen Sie denn beruflich?«
Aus unerfindlichen Gründen hatte Peroni keine Lust, ihr zu erzählen, dass er Polizist war. »Ich arbeite für das Innenministerium«, sagte er, womit er der Frage geschickt und wahrheitsgemäß ausgewichen war.
»Sie sehen gar nicht aus wie ein Beamter.«
»Ich fühle mich auch nicht wie einer.«
»Und Sie machen auch Urlaub hier?«
»Ja.«
»Allein?«
»Nein, mit der Familie meiner Schwester.«
»Aha. So, jetzt haben wir die unwesentlichen Fakten geklärt, vielleicht können wir ja jetzt anfangen, uns kennenzulernen. Sie hatten recht – dieser Risotto ist köstlich.«
Peroni war seltsam verwirrt. Solche Frauen war er nicht gewohnt. Sie war beunruhigend hellsichtig, und ständig sagte sie Dinge, auf die er nicht zu reagieren wusste. Auch die Tatsache, dass sie offensichtlich Feministin war, brachte ihn aus der Fassung. Er mochte keine Feministinnen. Aber er mochte sie.
Je weiter der Abend voranschritt, desto mehr mochte er sie. Er mochte die Art, wie sie lachte, und die Art, wie sie ihn zum Lachen brachte. Er mochte die Art, wie sie aß und trank (erstaunlich, bei wie vielen Frauen ihn die gezierte Essweise oder alberne Art zu trinken gestört hatte). Er mochte die Art, wie sie ihn als ihresgleichen behandelte, und er stellte fest, dass er anfing, ihre provokanten Bemerkungen zu mögen, selbst wenn sie ihm die Sprache verschlugen.
Der Abend verging zu schnell. Als er sie nach Garda zurückgebracht hatte, fragte er wie schon einmal: »Kann ich Sie wiedersehen?« Und wie beim ersten Mal betrachtete sie ihn einen Moment nachdenklich.
»Ich wüsste nicht, was dagegen spricht«, sagte sie schließlich, »vorausgesetzt, eins ist klar.« Peroni wartete mit einiger Anspannung. »Ich habe nicht vor, mit Ihnen ins Bett zu gehen, wie man so abgedroschen sagt. Wenn Sie diese Bedingung akzeptieren, würde ich Sie sehr gern wiedersehen.«
Der lüsterne scugnizzo in seinem Inneren taumelte unter diesem Schlag, aber Peroni tat sein Bestes, sich nichts anmerken zu lassen. »Ich akzeptiere«, sagte er. In der Dunkelheit konnte sie nicht sehen, dass er Zeige- und Mittelfinger beider Hände gekreuzt hatte.
»Schön. Morgen früh segle ich auf dem See. Können Sie segeln?«
»Ja und nein.« Peroni gab nicht gern zu, wenn er etwas nicht konnte.
»Ich bringe es Ihnen bei, wenn Sie möchten.«
»Ja, möchte ich.«
»Dann um sieben hier. Okay?«
Das hieß um halb sieben aufstehen. Völlig ausgeschlossen. »Gut«, sagte Peroni.
»Also bis dann.« Sie gab ihm die Hand, ein fester, kühler Druck, wandte sich um und war weg, bevor er Gelegenheit hatte, ihr vorzuschlagen, sie nach Hause zu bringen.
Peroni schwebte hoch auf einer Wolke der Verzückung zurück zum Campingplatz, versank in süßen, traumgewürzten Schlaf und kam am nächsten Morgen mit der mühelosen Leichtigkeit eines jungen Vogels aus den Federn, um Cordelia am Hafen zu treffen, wo sie unter einer hellen, bereits heißen Sonne hinaus auf die Mole spazierten. Fast ganz am äußeren Ende blieben sie vor einem frech und unternehmungslustig aussehenden Boot mit zwei Segeln stehen.
»Darf ich vorstellen, die Spaghetti Western«, sagte sie. »Der Name ist nicht von mir. Den hatte sie schon, als ich sie von einer Freundin geerbt habe, die letztes Jahr hier draußen war. Sie ist sehr übermütig, aber sie reagiert wunderbar, wenn man sie richtig behandelt. Hüpfen Sie rein.«
Und Peroni hüpfte, ein wenig zögerlich, hinein; die Spaghetti Western sah nicht gerade so aus, als wäre sie stabil genug für zwei Personen. Mit anmutig fließenden Bewegungen legte Cordelia ab und schwang sich ins Boot.
Für Peroni waren die nächsten zwei Stunden eine überreiche Mischung aus Paradies und Fegefeuer. Das Paradies lag in Cordelias Anwesenheit und dem ständigen Körperkontakt zu ihr, der beim Steuern eines so kleinen Bootes unvermeidlich war. Das Fegefeuer lag in der zermürbenden Anstrengung, die sie ihm abverlangte. Sie war eine gute Lehrerin, aber eine unbarmherzige Perfektionistin, und sie schikanierte, ermahnte und malträtierte ihn unablässig. Als sie zurück in den Hafen segelten, war Peroni schlapp und verschwitzt, und jeder Knochen tat ihm weh, aber er hatte das Gefühl, er könnte mit einem Boot umgehen.
»Ich mache noch einen richtigen Segler aus dir«, sagte sie. »Und jetzt«, dabei sah sie auf die Uhr und hievte ihre hellblaue Tasche aus der Spaghetti Western, »muss ich gehen.«
Er war verwirrt und frustriert, sie dagegen war in Gedanken schon bei den rätselhaften Angelegenheiten, die sie offenbar irgendwo am See zu erledigen hatte. Er wollte sie danach fragen, aber sein Instinkt sagte ihm, dass das nicht gut ankommen würde. Also fragte er sie stattdessen, wann sie sich wieder treffen könnten.
»Die nächsten zwei Tage bin ich ziemlich beschäftigt«, sagte sie, »aber morgen Abend müsste ich Zeit haben. Ich treffe dich drüben in der Bar – sagen wir gegen acht. Wir können was trinken und dann noch eine Unterrichtsstunde machen.«
Damit musste Peroni sich zufriedengeben.
»Die Leiche einer jungen Frau wurde heute Morgen am Gardasee ans Ufer getrieben. Wie die Identifizierung ergab, handelt es sich um Cordelia Hope, eine 21-jährige Engländerin, die ihre Ferien im Dorf Garda verbracht hatte.«
Peroni saß an der Bar und hörte wie betäubt dem blechernen Transistorradio dahinter zu, dankbar, dass er allein war.
»Carabinieri haben bestätigt, dass sie irgendwann gestern am späten Abend, ihrer Gewohnheit entsprechend, mit ihrem Segelboot hinausgefahren ist. Sie wurde von einem plötzlichen Unwetter überrascht, und da sie eine unerfahrene Seglerin war, fiel sie über Bord und ertrank. Die Frau ist das dritte Opfer, das der See in dieser Saison gefordert hat …«
Das war unmöglich. Peroni hatte allen Grund zu wissen, dass es unmöglich war.
Einen Tag nach ihrer ersten Unterrichtsstunde kam er pünktlich um acht Uhr an der Hafenbar an, aber Cordelia war nicht da. Ein halbe Stunde und zwei Chivas Regal später war sie immer noch nicht eingetroffen. Er bestellte einen Dritten und überlegte, was er machen sollte. Er war es nicht gewohnt, auf Frauen zu warten; normalerweise warteten sie auf ihn. Seine männliche Eitelkeit als Südländer war tief gekränkt. Seine Ehre verlangte nach Rückzug. Andere Mütter hatten auch schöne Töchter.
Viertel vor neun, und er wartete noch immer. Soll sie doch in ihrer Enttäuschung schmoren, wenn sie kommt, falls sie kommt, redete er sich ein. Wenn sie dich hier jämmerlich wartend vorfindet, nach fast einer Stunde Verspätung, weiß sie, dass sie dich in der Tasche hat, und das wird sie dich spüren lassen. Lass sie zappeln.
Um neun gestand er einem vierten Chivas Regal kleinlaut ein, dass sie nicht der Typ war, der zappelte. Viel zu selbstbewusst. Und in diesem Fall, so ermahnte er sich selbst, wäre er ohne sie besser beraten. Komm, reiß dir irgendeine skandinavische Frau auf, die nach einem Latin Lover lechzt, und vergiss Cordelia.
Um zehn nach neun kam sie hereinspaziert. »Tut mir sehr leid, dass du warten musstest«, sagte sie, »aber mir ist was dazwischengekommen. Du hättest nicht warten sollen.«
»Ach, ist schon in Ordnung«, sagte Peroni heuchlerisch. »War nicht weiter schlimm.« Sie sah ungewöhnlich niedergeschlagen aus. »Ist etwas passiert?«
»Nein, nein – wahrscheinlich hab ich nur Hunger. Essen wir eine Pizza. Ich bin mit Zahlen dran. Und danach segeln wir raus.«
»Wird das nicht ein bisschen spät?«
»Quatsch. Nachts ist Segeln am schönsten.«
Es war fast elf und schon dunkel, als sie mit der Spaghetti Western aus dem kleinen Hafen glitten. Peroni war leicht nervös, aber das Wetter war wundervoll und der See glatt wie ein Mühlenteich, und schließlich, so sagte er sich, konnte ja niemand wissen, welche Veränderungen in ihrem sturen und bislang gänzlich unflexiblen Beharren auf Keuschheit eine nächtliche Segeltour auf samtigem Wasser mit sich bringen mochte.
»Du übernimmst«, sagte sie.
Peroni gehorchte. Glücklicherweise war nicht viel zu tun, und sie, noch immer in ihrer unerklärten Niedergeschlagenheit versunken, attackierte ihn weniger scharf wegen seiner Fehler. Dann schien sie sich plötzlich zusammenzureißen und fing an zu reden. Es war ein oberflächliches, aber geistreiches Gespräch über Politik (sie nahm die italienische Politikerkaste mit federleichten, aber messerscharfen Analysen auseinander), Essen (sie beschrieb ein extravagantes fernöstliches Gericht, das sie, wie sie versprach, eines Tages für Peroni kochen wollte), Bücher (es gab offenbar nichts, was sie nicht gelesen hatte) und über die Unterschiede zwischen England und Italien (»Es ist wie der ewige Kampf zwischen den Geschlechtern, nur dass man nie genau weiß, zu welchem Geschlecht das jeweilige Land gerade gehört.«).
Als eine kurze Gesprächspause entstand, sagte Peroni: »Weißt du, ich habe absolut keine Ahnung, wo wir sind. Ich meine, abgesehen davon, dass wir auf dem See sind.«
»Ich schon.«
»Du bestimmt«, sagte Peroni, und sie grinste ihn in der Dunkelheit an. »Wo?«
»Die Lichter da drüben, das ist Sirmione, und da ist Desenzano.« Dann seufzte sie mit plötzlicher Verzückung, als ob sie in ein besonders verlockendes Schaufenster blickte. »Ist das nicht schön?«
Es war schön. Das Südufer des Sees, schon bei Tag sehenswert, war bei Nacht ein Märchenland. Peroni betrachtete es mit Wohlgefallen, während sie über das Wasser glitten.
»Sieh mal die Villa«, sagte er, »dort drüben, mit dem Park drumherum. Da könnte ich leben. Wem die wohl gehört?«
»Auch das weiß ich. Warte mal – den Wind sollten wir mitnehmen. Lass mich kurz ans Ruder.« Er tat wie geheißen und beobachtete entzückt ihren geschmeidigen Körper, während sie sich ans Ruder setzte, um sie in frischen Wind zu drehen, weg vom Ufer. »Also diese Villa«, fuhr sie fort, als sie mit dem Richtungswechsel zufrieden war, »ist eins von diesen superteuren Alten- und Pflegeheimen, wo die Schwestern nicht gehen, sondern schweben und ein eingebautes Lächeln haben und wo die Gäste so ehrfurchtsvoll behandelt werden, als wären sie unbezahlbare Porzellanstücke. Wenn ich so alt wäre, würde ich die robuste Wirklichkeitsnähe eines altmodischen Armenhauses vorziehen. Ich meine, da ist zumindest echtes Leben.«
»Da bin ich mir nicht so sicher. Aber woher kennst du dich so gut am See aus?«
»Ich habe meine Zeit letzte Woche nicht vertrödelt.«
Sie waren der Frage nach ihren rätselhaften Aktivitäten am See gefährlich nahegekommen, und Peroni überlegte, ob sie in der Verschwiegenheit des nächtlichen Sees nicht vielleicht entgegenkommender auf Erkundigungen reagieren würde. Er beschloss, es zu riskieren. »Was machst du eigentlich, wenn du so allein losziehst?«, fragte er, und dann, als sie den Mund öffnete, um etwas zu sagen, fuhr er diplomatisch fort: »Schon gut, du musst es mir nicht erzählen, wenn du nicht willst. Aber vielleicht würde es dir ja guttun, wenn du mit jemandem drüber reden könntest – was immer es ist. Und vielleicht könnte ich dir sogar behilflich sein – vorausgesetzt, dass du das möchtest. Schließlich wird es ja wohl nichts Illegales sein.«
Wieder grinste sie ihn durch die Dunkelheit an. »Wer sagt das?«
Peroni hätte nicht verblüffter sein können, wenn sie ein obszönes Schimpfwort benutzt hätte. »Jetzt habe ich dich schon wieder schockiert«, fuhr sie fort. »Du bist aber auch leicht zu schockieren. Das kommt davon, wenn man ein Mann ist und noch dazu aus dem Süden. Wieso sollte ich nicht in etwas Illegales verwickelt sein? Weil ich eine wohlerzogene junge Dame bin und noch dazu in Oxford studiere?« Sie hatte Peronis Gedanken so genau erraten, dass er sie nur noch in der Dunkelheit anstarren konnte. »Du kannst mir glauben«, fuhr sie fort, »dass vermeintlich respektable Studentinnen Dinge aushecken können, die die rosaroten Männerphantasien bei Weitem übersteigen.« Sie stockte. »Aber eigentlich«, sagte sie, »weiß ich selbst nicht so recht, wie es ethisch einzustufen ist. Nach dem Gesetz falsch, moralisch gesehen richtig, könnte man vielleicht sagen.«
»Aber was ist es denn?«, sagte Peroni entnervt.
»Ein Abenteuer.« Sie brach ab, und als sie weiterredete, lag ein Klang in ihrer Stimme, der sich bestürzend nach Verzweiflung anhörte. »Ein Abenteuer, das, wie es aussieht, falsch gelaufen ist. Oder völlig im Sande verläuft.«
»Was für ein Abenteuer?«
Sie zögerte, offenbar unsicher, ob sie den unwiderruflichen Schritt wagen sollte, sich ihm anzuvertrauen; sie war drauf und dran. Dann plötzlich zog etwas anderes ihre Aufmerksamkeit auf sich. Er spürte es, aber er konnte es nicht benennen.
Sie bewegte sich rasch, um das Focksegel in Ordnung zu bringen, und ihm schien, als ob irgendwelche Erscheinungen, die noch zu weit entfernt waren, um sie zu erkennen, mit hoher Stimme singend über das Wasser auf sie zukamen.
»Was ist das?«, fragte er.
»Sturm.«
Dann begriff er, dass die Erscheinungen Wolken waren, die mit erschreckender Geschwindigkeit auf sie zukamen, und ihre Stimmen waren die Winde, die sie herantrugen.
»Halt dich einfach gut fest«, sagte Cordelia, »und keine Panik.«
Den ersten Teil ihrer Anweisung befolgte er inbrünstig, aber die Geschwindigkeit, mit der die Wolken auf sie zustürmten, und das heulende Crescendo des Windes machten ihm den zweiten Teil unmöglich.
Das Wasser unter ihnen und um sie herum wogte und toste zornig, fegte über Bug und Rumpf des Bootes, sodass Peroni bald durchnässt war. Die Wolken, die Entfernung oder beides hatten jeden beruhigenden Blick aufs Ufer verhüllt, sodass sie mit dem wilden, mordlüsternen Ungeheuer, als das sich der See plötzlich gebärdete, völlig allein waren.
Er spielte mit der Spaghetti Western wie eine gigantische Katze, warf sie hoch in die Luft, fing sie auf, wirbelte sie herum, ließ sie vor und zurück tanzen.
So sehr Peroni sich auch festklammerte, die Kraft der heranbrausenden Wellen, die ihn zu verschlingen drohten, war so gewaltig, dass er bei jeder neuen Welle damit rechnete, in den See gerissen zu werden. Und trotz seines Entsetzens bei dieser Vorstellung konnte er nur darüber staunen, dass Cordelia, die sich offenbar überhaupt nicht festhielt, im Boot blieb. Sie war überall zugleich, mühelos, passte ihren Körper an das wütende Schwanken und Rollen an, nahm Peronis Anwesenheit anscheinend nicht mehr wahr, völlig versunken in ihren einsamen Kampf mit dem See.
Die Dunkelheit war beängstigend, aber Peroni begriff bald, dass sie auch ihre Vorteile hatte, als ein heftiger und langgezogener Blitzstrahl, begleitet von einem apokalyptischen Donnergrollen, die nähere Umgebung erhellte und Peronis schlimmste Befürchtungen bestätigte. Die Wogen waren sogar noch höher, als er gedacht hatte.
Irgendwo in seinem Hinterkopf schrillte eine idiotische Stimme etwas, das er einmal irgendwo gehört und unklugerweise vergessen hatte. »Auf dem See können in Null Komma nichts Stürme losbrechen, die wirklich entsetzlich sind. Sie sind selbst bei den erfahrensten Fischern gefürchtet.«
Eine ganz besonders gewaltige Woge krachte auf sie nieder, und die Spaghetti Western bäumte sich auf, erbebte und neigte sich so weit zur Seite, dass Peroni einen Augenblick lang meinte, geradewegs in das tosende Wasser zu blicken. Sie war gekentert.
»Heiliger Januarius!«, schrie Peroni innerlich auf und beschwor den Schutzheiligen von Neapel, dessen Medaillon er immer um den Hals trug: »Bring uns hier raus, und ich lasse die größte Kerze der Welt für dich im Dom von Neapel anzünden!«
Er konnte nicht sagen, ob der heilige Januarius dieses Angebot unwiderstehlich fand oder ob Cordelias Segelkünste das Unmögliche möglich machten, aber irgendwie richtete sich die Spaghetti Western wieder auf und entkam kurz danach dem Auge des Orkans, der sie umgehend ihrem Schicksal überließ und auf der Suche nach anderer Beute davontobte.
Es regnete, und die Wellen waren noch immer ziemlich hoch, aber der Tod brüllte Peroni nicht mehr ins Ohr und die Uferlichter glitzerten tröstlich.
»Ein toller Spaß, nicht?«, erdreistete sich Cordelia zu sagen. »Aber wir machen trotzdem besser, dass wir zurück zum Hafen kommen. Wir wollen doch keine Zugabe, oder?«
Vielleicht hatte das Unwetter Cordelia bewogen, ihre Meinung dahingehend zu ändern, dass sie ihr Geheimnis nicht mehr mit Peroni teilen wollte, jedenfalls kam sie nicht auf das Thema zurück, und er war viel zu fertig mit den Nerven, um darauf zu bestehen. Sie segelten in den Hafen von Garda, legten an und verabschiedeten sich mit einem Händedruck.
3
Buon giorno, Dottore«, sagte der zynisch dreinblickende Brigadiere, der Peroni mit geheucheltem, übertriebenem Respekt empfing. »Setzen Sie sich. Was kann ich für Sie tun?«
»Die junge Frau heute Morgen am Strand …«
»Ach ja, die junge Engländerin, die bei dem Unwetter ertrunken ist …«
Die Augen des Brigadiere waren glasig und ausdruckslos, und offensichtlich stellte er im Kopf Spekulationen über das Motiv für diesen Besuch an. Peroni betrachtete ihn müde. Aus der Radiomeldung war eindeutig hervorgegangen, dass man Cordelias Tod für einen Unfall hielt. Aber jemand, der erst drei Nächte zuvor mit derart meisterlichem Geschick ein Boot beherrscht hatte, konnte doch nicht einfach so über Bord gegangen sein, und das in einem wesentlich harmloseren Sturm. Peroni hatte sofort beschlossen, dass er den Carabinieri die Unfalltheorie ausreden musste. Doch schon jetzt erfasste ihn der Verdacht, dass das nicht so leicht sein würde.
»… kaum zu glauben«, fuhr der Brigadiere fort, »aber die machen das dauernd, diese Ausländer. Wenn sie sich nicht selbst ertränken, indem sie nach einem sechsgängigen Menü schwimmen gehen, dann ziehen sie los und fallen von ihren Booten. Bringt man denen denn zu Hause überhaupt nichts bei?«
»Aber sie ist nicht von ihrem Boot gefallen.«
»Was?« Die verschlagenen, geistlosen Augen verengten sich.
»Sie ist nicht vom Boot gefallen.«
»Woher wissen Sie das?«
Peroni begriff, dass er die Frage nicht beantworten konnte, ohne zuzugeben, dass er bei ihrer ersten Begegnung gelogen hatte, was, gelinde gesagt, peinlich war. Aber die Peinlichkeit war unumgänglich, falls er den Brigadiere überzeugen wollte.
»Ich habe Ihnen gesagt, dass ich sie nicht gekannt habe«, sagte er. »Aber ich war schockiert, als ich sie so da liegen sah, und habe es unwillkürlich abgestritten. Ich habe sie doch gekannt. Erst drei Nächte zuvor war ich mit ihr zusammen während eines Unwetters auf dem See. Sie hatte das Boot perfekt im Griff.«
»Ich verstehe. Ihnen ist doch wohl klar, Dottore, dass ich jeden anderen jetzt wegen Irreführung der Behörden belangen müsste?«
»Ja, selbstverständlich, ich …«
»Ich nehme an, sie war eine Urlaubsbekanntschaft von Ihnen?«
»So könnte man es ausdrücken …«
»Ich verstehe.« Peroni wusste genau, was der Mann zu verstehen meinte, und der Gedanke an Cordelia machte die gewohnheitsmäßige Schlüpfrigkeit darin unerträglich abstoßend.
»Sie verstehen nicht«, sagte er, »aber das tut nichts zur Sache. Ich versuche Ihnen klarzumachen, dass sie unmöglich durch einen Unfall ertrunken sein kann.«
»Bloß weil sie ein paar Nächte zuvor nicht durch einen Unfall ertrunken ist? Das klingt wirklich nicht sehr überzeugend, Dottore, oder? Und nur mal angenommen, Sie hätten recht, welche Alternativen bleiben uns dann? Dass sie freiwillig ins Wasser gegangen ist? Wollen Sie das damit andeuten?«
Selbstmord? Der Gedanke war Peroni nie gekommen. Er erinnerte sich an den Klang ihrer Stimme kurz vor dem Unwetter, als sie von einem »Abenteuer, das anscheinend falsch gelaufen ist« gesprochen hatte. Sie war zu Verzweiflung fähig, dachte er. Aber dann erinnerte er sich an den Tag danach …
»Klar zum Start auf hohe See?«
»Ehrlich gesagt, ich hatte gedacht …«
»Kalte Füße, häh? Und das bloß wegen der Minibrise von letzter Nacht. Oh nein, mein Junge – das ist, wie wenn man vom Pferd fällt: Das einzig Richtige ist, sofort wieder aufzusitzen.«
Sie schien vor Übermut fast zu platzen, und Peroni beschloss, eine Frage zu wagen. »Läuft es mit deinem Abenteuer wieder richtig?«
»Vielleicht. Es besteht Hoffnung. Rein mit dir.«
Offensichtlich war sie nicht gewillt, darüber zu reden. Nach einem kurzen argwöhnischen Blick zum Horizont stieg Peroni ins Boot. Das Wetter, so stellte er erleichtert fest, hätte kaum besser sein können.
»Du steuerst sie aus dem Hafen. Dann segeln wir ein bisschen raus und dann die Küste entlang nach Malcesine. Falls du brav bist, kaufe ich dir ein Eis, wenn wir dort ankommen.«
»Aye Aye, Admiral.«
Sie segelten eine Weile, ohne zu reden, bis auf die kurzen Anweisungen von Cordelia.
Der Julinachmittag war vollkommen, und beide genossen ihn still, zufrieden damit, den eigenen Gedanken nachhängen zu können.
»Warum willst du es mir nicht sagen?«, fragte Peroni schließlich.
Sie dachte über die Frage nach. »Aus verschiedenen Gründen«, sagte sie nach einem Moment: »Erstens einmal möchte ich es für mich behalten. Zweitens, falls wirklich irgendwas daran illegal ist, möchte ich nicht, dass du mit hineingezogen wirst. Und drittens – na ja, ich bin ein bisschen abergläubisch. Ich habe Angst, wenn ich es dir erzähle, zerrinnt es mir irgendwie zwischen den Fingern.«
»Wirst du es mir irgendwann erzählen?«
Sie sah ihn auf eine neue Art an, prüfend und amüsiert zugleich. Und da lag noch etwas in ihrem Blick, was er nicht benennen konnte, aber was ihm gefiel. »Eines Tages vielleicht, wenn alles vorbei ist. So oder so.«
»Du bist sehr unabhängig.«
»Das muss ich sein.«
Sie hockte dicht vor ihm, und ihre sehr klaren blauen Augen, die ihn unverwandt anblickten, hatten einen Ausdruck, den er herausfordernd fand. Er reagierte. Lange berührten sich ihre Münder nur sacht. Dann zog Peroni sie näher an sich. Sie wollte sich von ihm lösen, doch dann gab sie nach, und allmählich wurde der Kuss intensiver und leidenschaftlicher.
Schließlich nahm sie ihren Mund von seinem und berührte seine Wange mit den Fingerspitzen ihrer rechten Hand. »Das hat mir gefallen«, sagte sie, »sehr sogar. Aber ich will es nicht. Das ist ein Unterschied, weißt du? Wie ich schon sagte, ich muss unabhängig sein. Außerdem«, fuhr sie plötzlich lächelnd fort und stand auf, »sollst du dich aufs Segeln konzentrieren. Unser Eis wartet dahinten.«
Und das war alles für den Tag.
»Selbstmord?«, fragte Peroni. »Nein.«
»Dann also Mord?« Das Wort schien aus dem Mund des Brigadiere zu springen wie eine Kröte.
»Möglich.«
»Welche Gründe haben Sie für diese Vermutung?«
Gerade noch rechtzeitig erkannte Peroni die Gefahr. Welche Gründe hatte er denn schon? Das Wissen darum, dass Cordelia irgendwelche nicht näher erläuterten Angelegenheiten in der Gegend am See verfolgt hatte? Das würde der Brigadiere schnell vom Tisch fegen. Er brauchte jemanden auf einer wesentlich höheren Ebene.
»Keinerlei Gründe«, sagte er und versuchte dabei demütig dreinzublicken.
»Sehen Sie?«, sagte der Brigadiere mit der Miene eines älteren Mannes, der weiß, wo es lang geht. »Natürlich ist es ganz verständlich, dass Sie so reagieren – das würde jeder Mann, der was mit einer jungen Frau hat und sie dann plötzlich tot vorfindet. Das ist ganz menschlich. Also ist die Sache damit wohl erledigt, häh, Dottore? Sie vergessen das mit dem Mord, und ich vergesse Ihre Falschaussage.« Er streckte die Hand aus, und Peroni ergriff sie widerstrebend. Es klopfte an der Tür, und als der Brigadiere »Avanti« rief, ging sie auf, und ein rotbackiger, energisch aussehender Mann um die Fünfzig trat ein, mit sonnenverbrannter Glatze und einem üppigen Flaum aus weißem Haar über den Ohren. Er war elegant gekleidet, hatte aber etwas Rustikales an sich, das darauf schließen ließ, dass er sich wohler gefühlt hätte, wenn er, ein Gewehr unterm Arm, in Stiefeln, Cordhose und ausgebeulter alter Jacke durch die Landschaft gestapft wäre. Beim Anblick dieses Herrn schoss der Brigadiere wie eine Rakete aus seinem Sessel, nahm Haltung an und grüßte.
»Buon giorno, signor sindaco!«, sagte er. Der Bürgermeister, dachte Peroni, das erklärte die Ehrerbietung.
»Setzen Sie sich, Brigadiere, setzen Sie sich – da fallen ja alle Spinnweben von den Wänden, wenn Sie so aufspringen.« Er sprach starken Dialekt – eine Marotte der besseren Gesellschaft im Veneto –, und der Brigadiere setzte sich, den Mund zu einem ergebenen Lächeln über die kleine Stichelei verzogen. »Sie werden verzeihen, dass ich Ihr reges Sozialleben störe«, fuhr der Bürgermeister fort und nickte Peroni freundlich zu, »aber ich habe eine Anfrage vom britischen Konsulat in Venedig vorliegen. Man bittet um Informationen über die arme junge Frau, die letzte Nacht ertrunken ist, und da ich gerade vorbeigekommen bin, dachte ich, ich schau mal rein und erspare Ihnen die Strapaze, extra ins Rathaus kommen zu müssen.«
»Sehr nett von Ihnen, signore sindaco. Ich habe die Akte gerade vor mir, wenn Sie hineinschauen möchten.« Er warf Peroni einen raschen verschlagenen Blick zu. »Das ist Dottor Peroni von der Pubblica Sicurezza«, fuhr er fort. »Er wollte auch mit mir über diese Frau sprechen.«
Peroni war der warnende Unterton nicht entgangen, und er hielt es für angebracht, sich zunächst fügsam zu zeigen.
»Ich habe sie zufällig vor ein paar Tagen kennengelernt«, sagte er, »und dachte, ich könnte vielleicht irgendwie behilflich sein.«
»Peroni, Peroni, Peroni«, sagte der Bürgermeister geistesabwesend und betrachtete ihn über die Halbgläser seiner Brille, die auf einer großen, marmorierten Nase saß. »Den Namen habe ich schon irgendwo gehört. Jetzt weiß ich! Der Rudolfo Valentino der italienischen Polizei! Der Polizist, der bei seinen Schnüffeleien dauernd über schöne Frauenleichen stolpert und sich von Dach zu Dach schwingt wie Tarzan. So ist es doch mehr oder weniger, oder?«
Peroni lächelte höflich und nickte. Früher einmal war er wegen seines Valentino-Beinamens eitel und stolz wie ein Pfau gewesen, doch er wurde ihn nicht mehr los, und mittlerweile hatte er ihn gründlich satt.
»Bombarone«, sagte der Bürgermeister und streckte eine Hand aus. Während Peroni sie ergriff, erinnerte er sich daran, dass er diesen Namen oft gehört hatte, als er noch in Verona stationiert gewesen war. Bombarone war ein bedeutender Lokalpolitiker der Christdemokraten, der in einem halben Dutzend politischer Spielchen gleichzeitig mitmischte. Er war ein Intrigant, ein Königsmacher, eine graue Eminenz. Und diese Erkenntnis erweckte in Peroni erneut eine Ambition zum Leben, die ihm in den letzten Monaten immer wieder durch den schöpferischen Kopf geschlichen war und die er durch die Begegnung mit Cordelia nur vorübergehend in den Hintergrund gedrängt hatte. Vielleicht war Bombarone genau der Mann, den er brauchte. Aber dann fühlte er sich bei dem Gedanken an Cordelia schuldig, weil sein persönlicher Ehrgeiz in ihm aufkeimte. Aber vielleicht war Bombarone ja auch genau der Mann, den er für sie brauchte. Vielleicht konnte Bombarone ihm auf mehr als nur eine Weise helfen.
»Kommen Sie doch mit in mein Büro, und wir machen eine Flasche Wein auf«, sagte er Bürgermeister gerade, was Peronis Plänen nur entgegenkam. »Jemand Berühmtes wie Sie haben wir hier nicht oft. Wo sind Sie jetzt stationiert – Mailand, nicht wahr?«
»Venedig.«
»Ach ja – Venedig, Venedig …« Er fing an, unmelodisch »La Biondina in Gondoleta« zu singen, und brach dann nach ein paar Zeilen ab. »Tja, also … Entschuldigen Sie mich einen Moment. Ich muss mir ein paar Notizen für das britische Konsulat machen, aber dann gehen wir.« Nachdem er seine Notizen gemacht hatte, legte er Peroni einen Arm um die Schulter und dirigierte ihn zur Tür. »Kommen Sie, kommen Sie«, sagte er, »wir wollen den wackeren Brigadiere allein lassen, damit er sein unterbrochenes Nickerchen fortsetzen kann, und uns eine Flasche echten Bardolino aufmachen – nicht den üblichen Dreck, den man im Supermarkt bekommt, sondern reinen Wein aus richtigen Trauben. Los geht’s.« Der Brigadiere nahm wieder Haltung an, und der Bürgermeister winkte ihm freundlich zu, als sie zur Tür hinausgingen.
Draußen stand ein Landrover für sie bereit. »Entschuldigen Sie das Transportmittel«, sagte der Bürgermeister beim Einsteigen, »aber ich fahre zur Genüge in schicken Limousinen, wenn ich runter nach Rom muss.«
Die Fahrt zum Rathaus von Garda war kurz. Als sie aus dem Landrover stiegen und ins Gebäude gingen, winkte Bombarone ununterbrochen, klopfte auf Schultern, drückte Hände und scherzte.
»Setzen Sie sich«, sagte er, als sie sein großes Büro im ersten Stock betraten. »Ich bin gleich wieder da.« Dann ging er hinaus und kam kurz darauf mit einer staubigen Flasche ohne Etikett, einem Korkenzieher und zwei Gläsern wieder. Nachdem er einen Berg von offiziell aussehenden Dokumenten auf seinem Schreibtisch kurzerhand beiseitegeschoben hatte – »dieser elende Papierkram« –, stellte er die Gläser ab und öffnete die Flasche.
»Nun, was sagen Sie dazu?«, wollte er wissen, als Peroni den Wein kostete.
»Wirklich vorzüglich«, sagte Peroni.
»Na, das nenne ich einen feinen Gaumen«, sagte der Bürgermeister und klatschte sich dabei anerkennend auf die Schenkel. »Und jetzt verrate ich Ihnen was, das Sie für sich behalten müssen. Wenn Sie ein paar Flaschen von diesem Wein haben möchten, sollten Sie General del Duca in Bardolino besuchen. Er stellt ihn her, und er wird Ihnen ein paar Kisten überlassen, wenn Sie ihm sagen, dass ich Sie schicke. Ein bemerkenswerter alter Herr, dieser General del Duca.«
Das Telefon auf Bombarones Schreibtisch klingelte, und während er Peroni zuwinkte, sich erneut einzuschenken, hob er den Hörer ab. Peroni folgte der Unterhaltung zunächst desinteressiert, doch dann mit wachsender Aufmerksamkeit, denn als er den Inhalt des Gesprächs mit dem Vornamen, den Bombarone nannte, in Verbindung brachte, hatte er keine Mühe, den passenden Nachnamen zu erraten. Ihm stockte beinahe der Atem. Der Bürgermeister verkehrte tatsächlich mit den höchsten politischen Kreisen des Landes. Der ruhelos drängende Ehrgeiz in Peroni schrie nach Befriedigung. Aber wie sollte er das Thema zur Sprache bringen?
»Freunde in unteren Positionen«, sagte Bombarone entschuldigend, als er schließlich wieder auflegte.
»Seit einiger Zeit«, sagte Peroni, der beschlossen hatte, dass der direkte Weg der beste sei, »trage ich mich mit dem Gedanken, für das Parlament zu kandidieren.«
»Schön, schön, schön«, sagte Bombarone und warf ihm einen schlauen, amüsierten Blick zu, während er ihre Gläser erneut füllte. »Ist das wahr? Der Rudolfo Valentino der Abgeordnetenkammer, was? Bedenken Sie, es ist ein hartes Leben.«
»Meinen Sie, ich hätte eine Chance?«
»Wieso nicht? Wieso nicht? An welche Partei hatten sie gedacht?«
»Natürlich die Democrazia Cristiana«, sagte Peroni leicht schockiert.
»So natürlich ist das gar nicht. Wir hätten Sie auch schön bei den Kommunisten oder den Faschisten unterbringen können. Aber alles in allem ist die DC vermutlich die beste Wahl. Ein interessanter Gedanke. Lassen Sie mich ein paar Tage darüber nachdenken, ja? Dann komme ich auf Sie zurück.«
Wieder klingelte das Telefon, und Bombarone hob mit gespielt gequälter Miene den Hörer ab. »Pronto, pronto. Ah Signora, buon giorno. Ich wollte Sie gerade zurückrufen.« Er legte die Hand über die Sprechmuschel und flüsterte Peroni zu: »Britisches Konsulat in Venedig – wegen des ertrunkenen Mädchens. Ja«, fuhr er fort, »ich habe die Einzelheiten jetzt vorliegen. Das arme Kind ist bei dem Unwetter letzte Nacht über Bord gegangen. Ja, schrecklich, schrecklich. Oh ja, zweifellos ein Unfall, keine Frage. Sie ist am 3. Juli hier angekommen und hatte ein Zimmer in der Via Mazzini Nummer drei gemietet …«
Peroni merkte sich die Adresse. Die übrigen Einzelheiten waren mager, und er erfuhr nichts Neues, außer dass Cordelias Leiche nach Abschluss der Formalitäten zurück nach England geflogen werden sollte.
»Das hätten wir«, sagte Bombarone, als er auflegte. »Ein tragischer Verlust. So jung. Traurig, traurig. Lassen Sie mich Ihnen einschenken. Sie kannten sie, wie Sie sagten?«