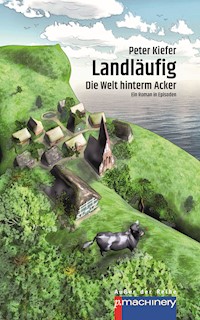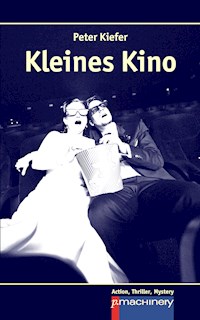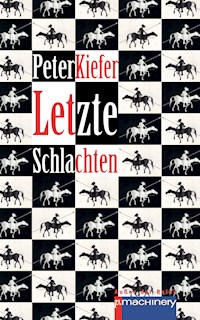
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Einer spielt Cowboy und stellt fest, dass Schießeisen einer ganz anderen Logik folgen. Einer begegnet seiner zusammenfantasierten Liebe, die freilich eine ganz andere ist, und gerät in einen Strudel politischer Handlungen. Einer leiht sich einen Hund aus, um einen Flirt in die Wege zu leiten, und findet sich im Bett mit einem Hundebaby wieder. Eine junge Frau krabbelt in fremde Hotelbetten und muss deshalb ihre beiden Tanten erschießen. Eine andere, die einen sanften Mord plant, wird vom Tod ihres Opfers überrumpelt. Einer bezieht evangelikale Prügel, weil er nicht von einer reuigen Sünderin lassen kann. Ein anderer will einen Einbrecher verprügeln und findet eine Frau, die ihm schon in selbiger Nacht untreu wird. Peter Kiefer erzählt schrille, seltsame und manchmal traurige Geschichten über Scheidewege und Scharmützel im Geschlechterreigen. Selbst kleine Terrorakte sind nur der Liebe geschuldet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Peter Kiefer
LETZTE SCHLACHTEN
Kurze Geschichten
Außer der Reihe 40
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: Juli 2019
p.machinery Michael Haitel
Titelabbildung: Charlotte
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda, Xlendi
Lektorat, Korrektorat: Michael Haitel
Herstellung: global:epropaganda, Xlendi
Verlag: p.machinery Michael Haitel
Norderweg 31, 25887 Winnert
www.pmachinery.de
ISBN der Printausgabe: 978 3 95765 170 9
Elinja
Der Schauplatz lag einige Zeit zurück. Iken hatte ich vormals an einem schneeverregneten und kalten Februartag geheiratet. Dieser Tag war mir auch in dem Sinn in Erinnerung geblieben, als er nach einer sonnigen, überraschend vorfrühlingshaften Woche den plötzlichen Wiedereinbruch des Winters markierte. Von da an war das Wetter bis in den Mai hinein überwiegend kalt und regnerisch geblieben. Später stand für mich dieser Wetterumschwung geradezu sinnbildlich für den Abwärtstrend, den unsere Beziehung nach der Hochzeit genommen hatte. Kaum merklich zwar und auch uns selbst erst Monate, wenn nicht Jahre danach richtig bewusst. In jene allererste Phase fiel die Reise zur Ostsee, es war eine Art nachholende Hochzeitsreise, die wir aber schon damals kaum noch so bezeichnen mochten.
Iken hatte bereits bei der Abreise eine heisere Stimme gehabt, nachdem wir angekommen waren, hatte sie leichtes Fieber. Ich fragte sie, ob wir die Sache nicht doch lieber abblasen und wieder umkehren sollten, aber sie meinte, dass ihr mit ihrer Erkältung gar nichts Besseres hätte blühen können als das Meer, die frische, salzige Luft, und so blieben wir.
Der erhoffte Effekt stellte sich freilich erst nach drei Tagen ein und Iken wäre in derselben Zeit vermutlich auch anderswo wieder auf die Beine gekommen. Nun war’s eben hier in diesem alten Badeort an der Ostsee geschehen. Während Iken meist auf ihrem Zimmer blieb, machte ich Spaziergänge am Strand entlang. Ich war ein nicht eben leidenschaftlicher Spaziergänger, aber hier schien ich das vergessen zu haben und entwickelte sogar einen unvermuteten Ehrgeiz, zuerst über diese und dann auch noch über die nächste Biegung des Strands hinaus zu wandern. So, als hoffte ich, etwas zu finden, oder würde, was näherlag, vor etwas weglaufen wollen.
Einmal kam mir eine Frau entgegen, wir nahmen kurz voneinander Notiz, grüßten uns. Am darauf folgenden Tag begegneten wir uns wieder. Anfänglich überlegten wir wohl beide, ob wir einen gewissen Abstand voneinander halten sollten. Aber dann lenkten wir wie auf Verabredung jeder ein Stück ein.
Sie war schlank, nicht groß gewachsen, aus ihrem schmalen Gesicht ragte eine leicht gekrümmte Nase hervor, das braune Haar hatte sie lose aufgesteckt. Ihre Herkunft vermochte ich nicht genau abzuschätzen. Erst später sollte ich erfahren, dass sie eine deutsche Mutter und einen persischen Vater hatte.
Beginnt da hinten schon das Naturschutzgebiet?, fragte sie.
Ja, antwortete ich, dort, wo der Wald liegt.
Kommt man denn zu Fuß da hinein?
Schon, aber nicht von der Strandseite aus. Es existiert ein Zaun, weiter geht’s also nicht.
Dann werde ich wieder umkehren müssen, sagte sie und sah mich dabei an.
Es entstand eine Verlegenheitspause, bis sie sich mit einem angedeuteten Gruß wieder von mir verabschieden wollte.
Ich habe denselben Weg, sagte ich. Wenn Sie wollen, können wir ihn zusammen machen.
Sie überlegte einen Moment.
Gut, sagte sie dann und erzählte mir, als wir nebeneinanderher gingen, dass sie jetzt eine Woche hier verbracht hätte und am morgigen Tag wieder abreisen werde. Viel gelesen habe sie, mehr als in den Jahren davor, und sie sei ein bisschen herumgewandert. Vom touristischen Trubel habe sie sich, so gut es ging, ferngehalten und ich sei nebenbei der Erste, mit dem sie sich mal länger als nur ein paar Minuten unterhielte. Aber genauso hätte sie sich’s vorgestellt, für sich zu bleiben und – wörtlich – keinen erotischen Stress zu haben. Dabei machte sie ein Gesicht, als hätte sie ein erfolgreiches Geschäft abgeschlossen.
Ich hoffe, dass ich Ihnen nicht am letzten Tag noch in die Quere komme, sagte ich etwas zu vorlaut.
Noch ehe ich sie dafür um Nachsicht bitten konnte, meinte sie vergnügt: Stress ist es ja nicht immer.
Wir verabschiedeten uns in der Nähe eines Strandcafés. Mein Versuch, sie dorthin einzuladen, schlug fehl.
Danke, sagte sie, vielleicht ein andermal.
Vermutlich war es reiner Zufall, dass es dieses andere Mal tatsächlich gab. Geschehen war er in einer Stadt, nicht allzu weit von jenem Badeort entfernt, den ich mit Iken besucht hatte, wenn auch zwei Jahre später.
Wir, ein kleines Archäologenteam, hatten im Auftrag der lokalen Denkmalbehörde in einem Bauloch neben dem Rathaus zu tun, nachdem ein Gebäude aus dem achtzehnten Jahrhundert durch einen Brand zerstört worden war und nun an seiner Stelle ein neues errichtet werden sollte. Da das alte ursprünglich mal eine Bank beherbergt hatte, hofften einige, dass wir auf alte Geldreserven stoßen würden, auf einen »Schatz«, wie es der Sprecher des Bürgermeisters bereits werbewirksam verkündete. Zugegeben, ein wenig Schatzsucherlaune steckt in jedem Archäologen, auch wenn er das Wort längst nicht nur auf Goldmünzen beziehen würde. Was wir schließlich fanden, waren aber lediglich Mauerreste unter anderem eines Latrinenschachts und statt Goldstücken ein paar wertlose Kleinmünzen.
Am vorletzten Tag dieser Grabung stand sie plötzlich da, ungefähr zwei Meter über mir am Rand der Baugrube. Sie war unter dem Absperrband hindurchgeschlüpft und ich sah zunächst nur ihre Beine. Als ich weiter zu ihr aufschaute, brauchte ich eine kleine Weile, bis ich sie genauer zuordnen konnte. Wohl ihrer dunkleren Hautfarbe wegen kehrte die Erinnerung zurück und das hinderte mich daran, ihr einen einfachen Verweis zu erteilen.
Die Frau damals vom Strand?, sagte ich.
Stimmt. Vorhin hatte ich Sie zufällig in diese Grube steigen sehen. Deshalb habe ich mich jetzt ein wenig vorgewagt.
Gehen Sie besser wieder zurück, sagte ich, ich werde in zwei Minuten bei Ihnen sein, wenn Sie so viel Zeit haben.
Die hatte sie und ich lud sie zu einer Tasse Kaffee ein, die sie mir dieses Mal nicht verweigerte. Dabei erfuhr ich ihren Namen, Elinja. Zu deutsch, erzählte sie mir, hieße das leuchtender Engel.
Wie sollte ich sagen, sie strahlte tatsächlich. Von innen, meine ich. Eitel und voreilig bezog ich es zunächst auf mich, aber im Verlauf des Gesprächs kam heraus, dass sie sich einer Freikirche angeschlossen hatte, einer Erweckungsbewegung und dass sie sich gerade neu hatte taufen lassen.
Mit Religion, Spiritualität und dergleichen konnte ich wenig anfangen. Das sagte ich ihr ganz offen, aber es schien sie in keiner Weise zu irritieren. Vielleicht betrachtete sie mich als missionarische Herausforderung, was wusste ich schon von derlei Gotteskindern.
Es brachte sicher nichts, das Thema weiter zu vertiefen. Im Vordergrund stand jetzt für mich diese Frau, die ich anders wahrnahm, als damals am Strand, körperlicher, und ich bildete mir ein, dass es ihr mit mir ganz ähnlich ging.
Ich machte ihr ein Kompliment, sagte, dass ihr innerer Wandel offenbar nach außen gedrungen sei, dass sie blendend aussehe.
Ein paar Momente lang sah sie mich halb fragend, halb schon mit einer Antwort in den Augen an. Sie schien zu spüren, dass ich ein bisschen übermütig wurde und vielleicht sogar auf den launigen Gedanken verfallen konnte, ihren frommen Panzer zu knacken.
Ich lud sie zum Essen ein.
Sie bedankte sich artig, sagte nicht Nein, sondern, wie um mir diese Idee wieder auszutreiben, dass sie Veganerin geworden sei. Versuchsweise jedenfalls.
Ich meinte, es würde bestimmt ein vegetarisches Restaurant in der Stadt geben und dann sei sicher auch für Veganer gesorgt. Mein Vorschlag scheiterte zwar, aber sie überraschte mich mit einem besseren. Sie bot mir nämlich an, sie zu besuchen, dann würde sie etwas für uns zubereiten. Gerade heute früh habe sie ein wunderbares Sauerteigbrot gebacken, ohne Hefe.
Ist Hefe denn verboten?
Nein, nein. Sie lachte. Hefe ist erlaubt, ich wollte es nur mal ausprobieren und finde, dass es ganz ordentlich gelungen ist.
Wir verabredeten uns für den morgigen frühen Abend.
Ich brachte ihr einen Strauß Wiesenblumen mit und wir küssten uns auf die Wange. Sie roch leicht nach einem Parfüm, das ich glaubte, noch aus meiner Jugend zu kennen. Ich hätte sie gerne dazu befragt, wollte sie jedoch mit diesem Verboten-Erlaubt-Thema nicht weiter belästigen. Die kleine Neubauwohnung, in der sie lebte, war unscheinbar eingerichtet, mir fiel allerdings auf, dass nirgendwo elektronische Geräte herumstanden, ein Laptop zum Beispiel oder eine Musikanlage.
Sie bat mich, ihr auf den Balkon hinaus zu folgen, einen kleinen Balkon, auf den gerade ein runder Tisch und zwei Stühle passten, wir beide also. Man blickte nicht weiter als auf die nächste Straßenseite und eine andere Fassade mit ähnlich kleinen Balkonen.
Was möchten Sie trinken?, fragte sie. Wasser, Saft oder einen Eistee?
Ein Glas Weißwein wäre mir, ehrlich gesagt, am liebsten gewesen, stattdessen sagte ich: Wasser.
Sie brachte eine Flasche in einem Kühler aus Ton und wir blinzelten in die Sonne des späten Nachmittags.
Erzählen Sie mir ein wenig von Ihrer Arbeit, meinte sie.
Sie werden es vermutlich in der Zeitung gelesen haben, was da vorgeht. Schauen Sie – ich zog ein kleines Geldstück aus der Tasche und gab es ihr zum Betrachten –, das ist der lang gesuchte Schatz, von dem mal die Rede war. Das hab ich zufällig heute gefunden.
Heißt das »drei«?
Ja, in römischen Ziffern.
Es handelte sich um ein kupfernes Dreipfennigstück von 1751. Die Umschrift auf der Vorderseite war etwas schwer zu entziffern, aber Elinja schaffte es erstaunlich mühelos: MONETA NOVA WISMARIENSIS, las sie vor und gab mir das Geldstück zurück.
Hat die Münze einen besonderen Wert?, fragte sie.
Ich zuckte mit den Schultern. Praktisch nicht, sie war damals massenhaft in Umlauf. Wenn Sie möchten, behalten Sie sie als kleines Souvenir.
Oh danke, meinte sie und sah mich fast ein wenig amüsiert an.
Ich erzählte ihr noch mehr über unsere Grabung, bis sie sanft ihre Hände auf meinen rechten Unterarm legte und sagte: Ich will Sie nicht unterbrechen, aber soll ich nicht inzwischen das Essen auftragen?
Ja, gern, meinte ich.
Sie brachte eine Schüssel mit einem bunten Couscoussalat, dazu einen Teller Walnuss-Paprika-Paste und das aufgeschnittene Sauerteigbrot, von dem sie gesprochen hatte. Es schmeckte viel besser, als ich erwartet hatte, offenbar verstand sie was vom Kochen.
Ich hatte Sie unterbrochen, meinte sie. Sie rührte mit einer Scheibe Brot in der rötlichen Paste, die sie ziemlich scharf gewürzt hatte.
Nein, nein. Die Grabung hier ist so gut wie beendet, die Ergebnisse sind kaum der Rede wert und die Bauleute warten nur darauf, endlich mit dem neuen Fundament beginnen zu können.
Eine Weile aßen wir schweigend.
Und was treiben Sie?, fragte ich schließlich.
Ich bin mal auf den Strich gegangen, Straßenstrich in Hamburg.
Was?
Danach hab ich in einem Club gearbeitet, anschließend freiberuflich als Hostess.
Es klang, als würde sie die Stationen ihrer letzten Urlaubsreise aufzählen.
Okay, sagte ich nur.
Ich hoffe, Sie wollen nicht noch mehr aus meiner Lebensgeschichte hören, sie ist öde genug. Aber jetzt liegt sie hinter mir.
Sie kaute auf einem Löffel Couscoussalat herum und rührte in ihrem Teller.
Und Ihre Kirche, fragte ich, ist die jetzt die Rettung?
Ich hab’s früher schon ausprobiert.
Was denn?
Religion. Ich trug immer ein kleines Amulett mit einem Buddhakopf in 3-D um den Hals. Allerdings wusste ich anfänglich nicht viel vom Buddhismus, nur, dass man etwas abstreifen soll. Für mich hieß das, mich fühllos machen, die Kerle, die auf mir rumrutschten, nicht mehr spüren zu müssen. Aber ich spürte sie doch und gelegentlich bereiteten sie mir auch Lust.
Mein Blick fiel auf einen fetten Kerl, der auf einem der Balkone gegenüber leicht über die Geländerbrüstung gebeugt stand, eine brennende Zigarette in der Hand hielt und irgendwem nachstarrte. Ich stellte mir vor, dass er einer von denen hätte gewesen sein können, die auf einem nächtlichen Parkplatz an Ikens Nippeln herumsuckelten. Sie hatte kleine Brüste, nichts zum Abtauchen, aber vielleicht brachte mich gerade das auf den Gedanken. Ich mochte kleine, mädchenhafte Brüste.
Lust?, fragte ich.
Aber Elinja antwortete nicht darauf, sondern sagte: Ich war keine billige Nutte, ich war gut, verstehen Sie.
Ich … höre Ihnen interessiert zu.
Wie ein Beichtvater?, fragte sie und ließ so ein Zwischending aus Lachen und Husten hören.
Ist es denn eine Beichte, die Sie da ablegen?
Bitte ich Sie für etwas um Vergebung?, fragte sie. Im Gegenteil.
Was meinen Sie?
Sie können sich’s nicht denken, obwohl sie mit genau dieser Absicht hergekommen sind, oder nicht? Sie hatten mir ja damals erzählt, dass Sie verheiratet sind. Es ist also überflüssig, mich nochmals daran erinnern zu wollen. Kommen Sie, ziehen Sie jetzt den Schwanz nicht ein.
Das Essen, das sie aufgetragen hatte, spielte inzwischen keine Rolle mehr.
Wie viel?, fragte ich und glaubte, ihrer Einladung damit auf den Grund gegangen zu sein.
Sie erhob sich kurz von ihrem Stuhl und setzte sich rittlings auf meinen rechten Oberschenkel. Ein Hunderter sollte reichen, sagte sie und berührte mit ihrer Nasenspitze die meine. Du siehst, ich bin großzügig.
Großzügig?
Etwa nicht? Soll ich noch was obendrauf legen? Einer wie du braucht sich nicht zu beklagen. Aber dafür musst du auch was leisten.
Sie fuhr mir mit der Breite ihrer Zunge übers Gesicht. Die Schärfe des Chilis brannte auf meiner Haut.
Ich schmiss sie von meinem Schoß.
Hör auf damit, sagte ich und lief einfach weg.
Meine Flucht endete jedoch schon an der Wohnungstür, sie war verschlossen. Ich hieb zuerst mit der Faust dagegen, dann wollte ich zurück zu Elinja rennen, rutschte aber auf einem billigen Teppich, der vor der Tür lag, aus und fiel zu Boden. Elinja stand bereits vor mir. Über mir, wie zuletzt am Grubenrand in der Stadt. Sie lächelte, wie man Kindern zulächelt.
Keine Sorge, du kriegst den Schlüssel.
Dann gib her, sagte ich. Meine linke Pobacke schmerzte und ich versuchte, mich aufzurichten.
Ich zeig ihn dir, ja?
Schließ die Tür auf und wir vergessen die Sache.
Du darfst sie aufschließen.
Sie öffnete den Knopf ihrer Hose und zog den Reißverschluss herunter. Eine Unterhose kam zum Vorschein, wie sie freikirchlicher kaum hätte sein können, groß, grob und beigefarben.
Was wird das?
Meine Frage war überflüssig, denn als Elinja nun auch diese Hose abstreifte, sah ich’s: den Wohnungsschlüssel.
Die Rasur ihrer Möse lag wohl schon ein paar Tage zurück, man sah dunkle Stoppeln. Aber das fiel hier nicht weiter ins Auge. Anders das Piercing in ihrer Schamlippe, der kleine goldene Ring, an dem ein anderer, weniger auffälliger hing und wiederum an diesem der Wohnungsschlüssel, grau und abgegriffen.
Hol ihn dir, sagte sie.
Ich kniete vor ihr wie ein Knappe, der gleich zum Ritter geschlagen wird.
Aber tu es behutsam, fügte sie hinzu. Wenn du willst, mit deiner Zunge.
Ich fing an, sie zu lecken. Zuerst unentschlossen, dann heftiger. Ich wartete darauf, dass sie zu stöhnen anfing, aber sie gab keinen Laut von sich. Nur einmal sagte sie: Mach so weiter.
Und ich machte so weiter, bis ich es selbst nicht mehr aushielt, mich erheben und ebenfalls meine Hose herunterziehen wollte. Doch sie rammte mir ihr Knie in die Brust und ich taumelte zurück. Nur lecken, sagte sie.
Ich leckte weiter. Doch schon kurz darauf war es soweit und mein Körper bog sich nach vorn. Meine Zunge, die sich nicht von Elinjas Haut lösen wollte, glitt langsam zu ihrem Knie hinab.
Der Schlüssel, erinnerte sie mich.
Noch ein wenig außer Atem pfriemelte ich seinen Ring aus dem anderen, dem Piercingring, heraus. Es war nicht mehr als eine nüchterne, gleichsam chirurgische Maßnahme. Zugleich war es, zumindest in diesem Moment, eine Herabsetzung, umso mehr, als sie sich durch Elinjas Vertrauen darauf, dass ich den Ring nicht einfach aus ihrem Fleisch reißen oder sie anderswie verletzen würde, in ein Spiel zu verwandeln schien.
Das Einzige, womit ich mich revanchieren konnte, war meine Zurückhaltung, die Weigerung handgreiflich zu werden oder auch nur diesen Schlüssel im nächsten Gully zu versenken. Wortlos und mit einem sichtbaren feuchten Fleck auf der Hose schloss ich die Tür auf und verließ die Wohnung. Sie warf mir noch einen zusammengerollten Hunderteuroschein hinterher, den sie wohl schon die ganze Zeit bereitgehalten hatte.
Iken und ich hatten uns nach einigen halbherzigen Anläufen schließlich voneinander getrennt. Es fühlte sich weder wie eine Befreiung an noch wie ein Tiefschlag. Gleichwohl überwog ein bitterer Geschmack, der sicher daher rührte, dass wir mit dieser Ehe unser Leben, ihres und meines, auf einen Umweg geleitet hatten, dass fortan ein Stück Zeit fehlte, das nicht mehr einzuholen war. Schuld hatten wir beide, hatte niemand, hatten die Umstände. Weil uns das bewusst war, ging die Trennung zumindest ohne Verletzungen vonstatten, einvernehmlich, wie es dann gewöhnlich heißt.
Wir hatten unsere Beziehung zuvor schon peu à peu ausgelagert. Iken hielt sich mit der Zeit häufiger in ihrer kleinen Zweitwohnung auf, die ihr ursprünglich – sie war Übersetzerin beim Gericht – nur als Arbeitsplatz hatte dienen sollen. Es hatte sich beiläufig so eingespielt und das Wenige, das in unserer gemeinsamen Wohnung zum Schluss von ihr übrig geblieben war, konnte sie in zwei Fahrten mit ihrem Golf wegtransportieren.
Den Wunsch, möglichst bald wieder eine feste Bindung einzugehen, hatte ich nicht. Übrig geblieben war nur so eine schmutzige und lüsterne Anwandlung, der Wunsch mich an einer Frau zu rächen. Von der gleichen Art vielleicht, wie Elinja sich stellvertretend für die Geilheit ihrer Freier an mir gerächt hatte. Einfach so.
Dabei besetzte gerade sie meine Gedanken.
Einmal lief sie an einem Laden vorbei, in dem ich an der Wursttheke anstand. Ich sah nur ihr leicht abgewandtes Profil, war aber sicher, dass sie es war, und eilte deshalb auf die Straße hinaus. Dort war sie aber wieder verschwunden. Weit konnte sie nicht gekommen sein und so warf ich in alle Geschäfte, die in der Richtung lagen, in der sie unterwegs war, einen kurzen Blick. Ohne Erfolg. Zuletzt betrat ich noch eine Modeboutique. Eine Verkäuferin kam auf mich zu und fragte nach meinen Wünschen, aber ich wimmelte sie ab und ging unverhohlen zu den beiden Umkleidekabinen. Bei einer war der Vorhang zugezogen. Ich bückte mich und sah zwei etwas angeschwollene Füße. Sie passten nicht zu Elinja, außerdem hatten sie eine hellere Hautfarbe. Ich ging wieder zum Ausgang zurück, grüßte die Verkäuferin, die mich nur stumm und vorwurfsvoll betrachtete, und hielt draußen erneut Ausschau nach dem leuchtenden Stern.
Und auch das noch. Es ereignete sich nach einem Verkehrsunfall. So etwas passiert dauernd: Du willst als Radfahrer auf einer Kreuzung geradeaus fahren, aber das Rechtsabbiegerauto übersieht dich und du fährst auf den Wagen auf. Im Ergebnis bescherte mir das ein kaputtes Fahrrad und eine ausgerenkte Schulter. Der Wagen hielt nicht einmal an und es gab im näheren Umfeld auch keine Zeugen. Ich stand kurz unter Schock und kam, auch meiner leichten Kurzsichtigkeit wegen, nicht mehr dazu, das Kennzeichen zu registrieren. In einer Mischung aus Wut und Schmerz schleppte ich mich auf den Bürgersteig. Eine ältere Dame kam herbei und hatte Mühe, ihre Nerven im Zaum zu halten. Mir fiel es schwer, mein Mobiltelefon hervorzukramen und einen Krankenwagen zu rufen. Zum Glück konnte die Frau mir den Namen der Straße nennen, in der wir uns befanden. Das reichte, um ein paar Minuten später abgeholt und in eine Klinik gebracht zu werden.
Es war, wie dann ein Röntgenbild zeigte, nichts gebrochen. Aber eine ausgerenkte Schulter bedeutet, dass die Muskulatur auf eine äußerst schmerzhafte Weise überdehnt wird und man, noch ehe größere Schwellungen einsetzen, wieder eingerenkt werden muss, um eine Operation zu vermeiden.
Zusammengesunken saß ich deshalb auf einer Bank, den rechten Arm in der Schlinge, und wartete auf den behandelnden Arzt, der meine Schulter wieder richten sollte. Der Korridor war durch eine Glasscheibe vom Warteraum getrennt und ich sah, wenn ich aufblickte, wie dahinter gestresste Schwestern und Pfleger vorbeiliefen. Und plötzlich war es Elinja, die ich sah. Sie lebte also doch in dieser Stadt.
Ich stöhnte laut auf. Eine Frau, die mir mit einem ausgestreckten lädierten Bein schräg gegenübersaß, schrak zusammen und starrte mich mitleidig an. Sie war sicher überrascht, als ich mich jetzt erhob und auf den Gang hinauswankte.
Das Laufen verursachte zusätzliche Schmerzen, aber ich musste sie stellen, Elinja. Ich behielt sie im Blick und versuchte, so gut es ging, ihr zu folgen. Weiter vorn wurde sie jetzt durch eine Krankenschwester aufgehalten, die gerade ihre im Bett liegende Patientin ins Zimmer nebenan manövrierte. So gelang es mir, ein wenig Boden gut zu machen. Da wir uns im dritten Stockwerk aufhielten, konnte ich davon ausgehen, dass Elinja, wenn sie im Begriff war, das Haus zu verlassen, geradeaus bis zu einem der Aufzüge laufen würde und die Wahrscheinlichkeit dann groß war, dass sie dort ein paar Augenblicke vor dem Aufzug warten musste. Die Schmerztablette, die ich zuvor eingenommen hatte, schien immerhin Wirkung zu zeigen, aber genauso gut konnte es der momentane Adrenalinschub sein, der nicht mehr jeden Schritt zur Qual werden ließ. Ich stellte mir vor, sie gleich in den leeren Aufzug zu schubsen, sie darin an die Wand zu drängen und sie meinen heißen Atem in ihrem Gesicht spüren zu lassen.
Und ich hatte richtig geraten, denn ich sah, wie sie vor den Aufzugtüren stehen blieb und einen Knopf drückte. Gleichzeitig tat ich mein Bestes, sie noch rechtzeitig zu erreichen. Ich musste es schaffen, musste sie fragen, warum sie mir hier über den Weg lief, ob sie mich gar verfolgte. Doch, dahinter steckte Kalkül und ich war nicht mehr bereit, an Zufälle zu glauben. Nicht einmal mehr daran, dass mein Unfall ohne Absicht geschehen war.
Ich hatte es jetzt nicht mehr weit zu ihr, als eine der Türen sich öffnete. Weil sie genau davor stand und niemand ihr den Weg versperrte, trat sie ein und drückte die Erdgeschosstaste.
Warten Sie!, rief ich. Ich hatte bereits die passenden Worte auf den Lippen.
Sie wandte sich zu mir um. Es war nicht Elinja. Sie hatte zwar von der Seite große Ähnlichkeit mit ihr, von vorn betrachtet, verwandelte sie sich jedoch in eine Frau, bei der ich ansonsten allenfalls mal kurz gestutzt hätte. Müde, abgekämpft und mit wieder einsetzenden Schmerzen sah ich sie an, schüttelte nur den Kopf und entfernte mich wieder. Ich fühlte mich haltlos und getrieben. Und hatte noch immer nicht genug von Elinja.
Ich war eingeschlafen, vermutlich aus innerer Erschöpfung. Jetzt rüttelte sie mich wach und stand wieder über mir, fast wie damals. Ich brauchte einen Augenblick, um zu begreifen, wo ich war. Elinja verriet dabei keine merkliche Überraschung, mich auf der Fußmatte vor ihrer Wohnungstür anzutreffen.
Dass ich mich dorthin gehockt und auf sie gewartet hatte, war nur einer blödsinnigen Hartnäckigkeit geschuldet, einem Wir-müssen-nochmal-drüber-reden, und auch ein wenig dadurch begünstigt, dass die Wohnung im oberen Stockwerk lag und mich treppensteigende Mieter im unteren Teil des Hauses nicht zu Gesicht bekommen hätten.
Ohne etwas zu sagen, schloss sie die Tür auf und ich rappelte mich auf und folgte ihr ins Innere der Wohnung. Sie ging direkt in die Küche, wo sie den Inhalt ihrer Einkaufstasche im Kühlschrank verteilte.
’n Kaffee?, fragte sie.
Ich sagte Ja und sie machte sich an der Kaffeemaschine zu schaffen. Als sie mir die volle Tasse reichte, ließ ich mich ungefragt am Küchentisch nieder.
Ich hab meine Tage, wenn’s darum geht, sagte sie mit fast der gleichen gelangweilten Selbstverständlichkeit, mit der sie mir zuvor den Kaffee angeboten hatte.
Weil mir nichts Besseres einfiel, fragte ich: Wie geht’s deiner Kirche?
Du meinst, ob ich noch die nötige Instanz für meine Moral behalten habe?
Eigentlich mein ich nichts Bestimmtes, sagte ich und verbrannte fast meine Lippe beim ersten Schluck aus der Tasse.
Warum bist du dann hier?
Weil …
Mir war klar, dass ich mich wie ein kleiner Junge verhielt, der irgendwas nicht wahrhaben wollte und nun den Beleidigten markierte.
… weil du mich verfolgst. In Gedanken jedenfalls.
Anders gesagt, du bildest dir was ein. Ist es das? Und gehst jetzt in die Offensive, um das Phantom am Kragen zu packen.
Du hast mich zur Nutte gemacht, sagte ich.
Stimmt und das ertragen Männer nicht so leicht. Ich hab die Rollen spaßeshalber vertauscht. Das Geld hast du genommen, jetzt hab ich dir sogar noch einen Kaffee spendiert. Das soll’s dann aber gewesen sein.
Es klingelte. Sie ging zur Tür und ich hörte, wie sie einen Mann begrüßte. Gleich darauf erschien sie mit ihm in der Küche.
Guten Tag, begrüßte mich der Mann und schüttelte mir die Hand. Er war groß gewachsen, hatte dunkles gescheiteltes Haar und ein eingefrorenes Gesicht. In der Hand hielt er ein Buch, auf dessen braunem Einband ein goldenes Kreuz geprägt war.
Das ist Bertolt, stellte Elinja ihn mir vor. Wir sind zu einem Lesekreis verabredet.
In ihrem Blick, den sie auf mich richtete, lag ein wenig Spott, als sie an Bertolt gewandt, sagte: Er wollte gerade aufbrechen. Und zu mir: Die Tür ist übrigens offen.
Sie wollte mich ein weiteres Mal abservieren. Das Blut stieg mir in den Kopf. Die noch fast volle Tasse Kaffee in der Hand erhob ich mich und hielt sie mir dicht unters Kinn, jederzeit bereit, sie über jemanden zu schütten.
Am besten du gehst mal raus, sagte ich zu diesem Bertolt, ich muss was mit ihr bereden.
Aber wir haben doch jetzt …
Er brachte den Satz nicht zu Ende, weil ich drei Schritte auf ihn zu machte und den vierten bereits andeutete. Elinjas Hand legte sich auf meine Schulter.
Komm, mach’s uns nicht schwer und stell’ die Tasse wieder auf den Tisch.
In ihrer Stimme lag plötzlich etwas Sanftes, Gesprächsbereites, das brachte mich, der ich allzu empfänglich war, zum Einlenken und ich stellte meine Tasse wieder auf den Küchentisch zurück. Als ich mich dann zu ihr umdrehte, scheuerte sie mir eine.
Er will mir an die Wäsche, rief sie aus. Hilf mir, ihn vor die Tür zu setzen.
Die Ohrfeige tat weh, das steigerte meine Wut. Ich wollte ihr zu Leibe rücken, aber Bertolt schob sich dazwischen.
Misch dich nicht ein, warnte ich ihn.
Was tust du meiner Schwester an?, fragte er in einem Ton, als würde er von einer Kanzel das göttliche Gericht anrufen, fasste mich in den Kragenbund meines T-Shirts und stieß mich auf den Flur hinaus.
Ich war zu aufgebracht und überrascht, um eine vernünftige Gegenwehr zu leisten. Ihn ans Schienbein zu treten, blieb kaum Zeit, weil er wie ein Berserker auf mich eindrang. Erst nachdem er mich mit einem abschließenden Stoß vor die Brust wieder losgelassen hatte, konnte die Schlacht von Neuem beginnen. Keuchend rannte ich auf ihn zu, in der Absicht, ihm meinen Kopf in die Magengegend zu rammen. Das war jedoch leicht zu durchschauen. Er wich kurz zur Seite und ließ mich ins Leere, genauer, gegen den Tisch rennen. Die Folge war, dass die Kaffeetasse umkippte und mir ein Teil der heißen Brühe über den rechten Oberschenkel lief. Für Bertolt war das ein wie bestelltes Ablenkungsmanöver. Er umschlang mit angewinkeltem Arm meinen Hals und drückte zu. Nicht zu fest, aber fest genug, um mich im Würgegriff zurück zur Wohnungstür zu schleppen.
Elinjas Gesicht huschte dabei an mir vorüber, ausdruckslos und weiß. Sie hatte ihren Blick abgewandt, sah nicht meine aufgerissenen Augen, die um Hilfe schrien.
Elinja!
Ich presste mühsam ihren Namen heraus, brachte aber bloß irgendein Röcheln zustande.
Bertolt, der Sadist, ganz in seinem Element, ganz der Zorn Gottes, der einem die Sünden aus dem Leib prügelt, begnügte sich nicht damit, mich bloß vor die Tür zu setzen, sondern zog mich bis zum Treppenrand. Dort verpasste er mir einen Tritt in den Hintern und ich stürzte vornüber die Stufen hinunter.
Den Schrei, den ich ausstieß, bildete ich mir vielleicht nur ein. Tatsache war, dass ich auf dem nächsten Treppenabsatz liegen blieb und in meiner verrenkten Stellung jetzt nur noch in der Lage war, dem Rhythmus meines Atems zu lauschen. Ich brauchte ein paar Sekunden, bis ich wieder etwas wahrnahm und das Erste war das Blut, das langsam aus meinem Unterarm quoll. Kleine Bläschen schwollen an und verzweigten sich zu schmalen Rinnsalen. Mir war, als sei ich im Dunkel eines Kinosaals versunken. Das Blut, das in leisen Tropfen aufs Linoleum fiel, war das nicht enden wollende Programm dieser Nacht.
Elinja traf ich noch einmal auf einem Bahnhof. Sie wartete auf einen Zug, neben ihr stand ein großer Rollkoffer. Ich stand auf dem Bahnsteig gegenüber und wartete darauf, dass sie mich bemerkte. Aber sie hatte mich wohl längst schon bemerkt, denn ehe sie noch meinem Blick begegnete, lächelte sie bereits ein spöttisches Lächeln, das keinerlei Erlösung versprach. Momente später verschwand es, als ihr einfahrender Zug es pfeifend abschnitt.
Einbruch
Jedes Mal, wenn er eine der zahlreich in diesem Sommer herumschwirrenden Motten totgeschlagen hatte, hielt er kurz inne und dachte, dass auch er einmal so sterben wollte: ohne Vorwarnung und so plötzlich, dass er selbst nichts mehr davon mitbekäme. Leonardo – seinen Namen verdankte er der Italienschwärmerei seines Vaters und er wollte ihn nicht auf Leo verkürzen – neigte zur Melancholie.
Er bewohnte ein kleines Haus in einer Gegend mit lauter kleinen Häusern, in die meist nur eine Familie passte. Die aber, zumindest eine Frau, fehlte ihm. Grund war seine Schüchternheit, die ihn in entscheidenden Momenten des Lebens mit eisernem Griff gefangen hielt. Sein Äußeres – breite Stirnglatze, fleischige Lippen, rundliche Figur – machte ihm ebenfalls zu schaffen. Dennoch empfing er gelegentlich Signale, auf die er gerne geantwortet hätte, wäre ihm nicht jedes Mal wieder seine mangelnde Courage im Weg gestanden.
Im Lehrerkollegium der Schule, an der er Erdkunde und Latein unterrichtete, war, Glück im Unglück, keine Frau dabei, in die er sich hätte verlieben mögen. Insofern fühlte er sich an der Stelle besser aufgehoben als im Vergnügungsdschungel der großen Stadt, dem er sich nicht gewachsen fühlte. Und auch wenn er sich das nicht eingestehen wollte, hatte er die Aussicht auf ein erfülltes Liebesleben bereits als Mittdreißiger mehr oder minder ad acta gelegt. Allenfalls ein wunderbarer Zufall konnte ihn noch retten.
Genau der schien sich eines Tages gegen zwei Uhr in der Nacht anzubahnen. Leonardo hatte an diesem Abend versucht Spinoza im lateinischen Original zu lesen, jenes geometrisch zurechtgeklügelte Werk zur Ethik. Er war am Schreibtisch darüber eingeschlafen, wieder aufgewacht und hatte das Gelesene inzwischen zur Hälfte schon wieder vergessen. Das ärgerte ihn. Er ging in die Küche und kochte sich eine Kanne Tee. Die nahm er mit ins Schlafzimmer, klemmte seine Leseleuchte an das Buch und vertiefte sich wieder in den dreißigsten Lehrsatz, der, wenn auch in einer trockenen Kathedersprache, von der Erregung der Lust handelte. Da vernahm er ein Geräusch.
Er konnte es nicht genau zuordnen, es klang auf seltsame Weise neutral, hatte nichts Fortdauerndes wie etwa das Scharren oder Knabbern von Mäusen, es flatterte, schmatzte oder klirrte auch nichts. Weil ein zweites Stockwerk ebenso wenig existierte wie ein Keller, konnte es nur aus einem der Nachbarzimmer kommen. Ruckartig erhob er sich aus seinem Bett, nahm, bereits in heller Aufregung, und weil keine passendere Waffe greifbar war, einen Schemel zur Hand und bewegte sich durch die offene Schlafzimmertür auf den schmalen Gang hinaus, der zu seinem Wohn- und Arbeitszimmer führte. Dort hinten blinkte tatsächlich eine Taschenlampe auf.
Leonardo hatte Mühe, an sich zu halten. Kein Zweifel, es schlich jemand durchs Haus. Am liebsten hätte er sich versteckt oder wäre abgehauen, um nicht mit diesem Einbrecher konfrontiert zu werden. Aber die Wut darüber, sich ohne Gegenwehr bestehlen zu lassen, trieb ihn auf Zehenspitzen weiter. Mit beiden Händen hielt er sich jetzt an jenem Schemel fest, seiner Lanze und seinem Schutzschild.
Als dann eine Gestalt im Türrahmen vorüberhuschte, wurden seine Knie noch weicher als ohnehin schon. Er hörte, wie sein Arbeitsschrank geöffnet wurde, das Geräusch der verzogenen Türen war eindeutig. Nur noch ein paar Schritte waren es bis zum Lichtschalter. Er konnte auf den Überraschungseffekt setzen und dann … keine Ahnung. Der Einbrecher – oder waren es sogar zwei? – würde wütend reagieren und es war fraglich, ob dann noch etwas von ihm übrig bleiben würde.
Was aber suchte jemand ausgerechnet in diesem Schrank, der vollgestopft war mit Elektroschrott, vergilbten Unterrichtsmaterialien, alten Steuererklärungen, längst vergessenen Quittungen, vergessenen Prospekten und weiterem Strandgut seiner papiernen und digitalen Lebensgeschichte.
Er pirschte sich weiter heran. Schließlich gelangte er bis nahe hinter die Gestalt des Einbrechers. Kaum zu glauben, dass der Kerl dabei nicht vom überlauten Schlagen seines Herzens aufgeschreckt wurde, was wohl nur geschah, weil dessen ungeteilte Aufmerksamkeit Leonardos Schrankinhalt galt. Mit einem gezielten Schlag des Hockers aufs Schulterblatt – das würde der Richter ihm später sicher als angemessene Notwehr zugestehen – konnte die Sache zu Ende gebracht werden. Immerhin hatte er noch nie, selbst nicht im Kindesalter, dem ja eine natürliche Boshaftigkeit zu eigen ist, jemandem ernsthaften Schaden zugefügt, er hätte sich das gar nicht getraut. Jetzt dachte er ans Mottenglück und an kurzen Prozess. Aber das da vor ihm war keine Motte, sondern eine Frau.
Statt draufzuhauen, machte er zwei Ausfallschritte und schaltete das Licht ein.
Die Frau schrie auf und wandte sich hastig zu ihm um. Die Szene hätte vielleicht in einer alten Hollywoodkomödie Platz gehabt: Cary Grant erwischt Doris Day, die eine heruntergezogene Schiebermütze trägt, beim Klauen und sie starrt ihn nun mit großen erschrockenen Augen an. Aber Leonardo hatte keinerlei Ähnlichkeit mit Cary Grant und auch diese fremde Frauengestalt hatte nichts lausbubenhaft Einnehmendes an sich. Sie mochte um die vierzig sein und erinnerte, unterstützt durch ihr wirres weißblondes Haar, ihre blasse Haut und ihr schmales Augenpaar, irgendwie an Nebel und November.
Wer sind Sie?
Sie hatte sich erhoben, presste ihren Rücken an den offen stehenden Schrank und hielt sich, ohne zu antworten, mit einer Hand daran fest. Sie antwortete nicht.
Also, fragte Leonardo scharf, der jetzt langsam wieder in die Spur fand, was suchen Sie hier? Sind Sie eine Diebin?
Diebin?, kam es in schreckverdünntem Tonfall zurück, der trotzdem einen höhnischen Beiklang hatte.
Wie würden Sie es denn nennen?, meinte Leonardo.
Augen und Mund der Frau waren zu ganz schmalen Streifen geworden, sichtbar staute sich Unmut dahinter. Sie atmete laut ein und langsam wieder aus und sagte dann: Sind nicht Sie der Dieb?
Erst bei dieser Frage wurde es Leonardo bewusst, dass er nichts weiter als seine ausgeleierte, auch noch grasgrüne Unterhose trug und damit jegliche Autorität verspielte. Am liebsten hätte er gesagt: Augenblick mal, ich ziehe mir nur kurz meinen Bademantel an, dann diskutieren wir das aus. Aber das ging natürlich nicht.
Er hob seine Stimme an, um von seinem Bauchspeck abzulenken, und sagte: Sie brechen hier ein, wühlen in meinen Sachen und haben dann auch noch die Frechheit mich zu fragen, wer hier der Dieb ist! Sind Sie bewaffnet?
Nein, natürlich nicht.
Ich hätte Ihnen eins überbraten können, das ist Ihnen hoffentlich bewusst. Ich habe Sie aber verschont und kann nun alles Weitere der Polizei überlassen.
Er streckte den Hocker wieder gegen die unbekannte Frau aus, wie um zu zeigen, dass nichts ihn jetzt daran hindern konnte, zum Telefon zu greifen.
Sie können mich damit nicht erschrecken, sagte sie gefasst und glitt im selben Moment zu Boden, wo sie im Schneidersitz hocken blieb. Die Handflächen legte sie auf die Knie, dann schloss sie die Augen.
Was machen Sie denn da?, fragte Leonardo vor den Kopf gestoßen.