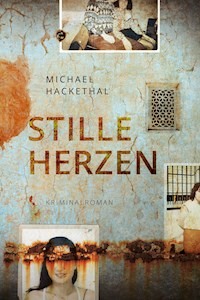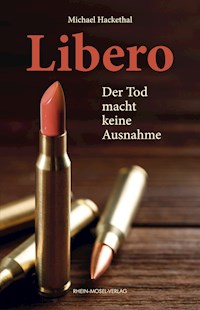
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
»Libero« ist der Deckname eines Killers. Nur zwei Menschen kennen seine wahre Identität. Aber auch Killer sind Menschen, und Menschen sind sterblich. Mit einer tödlichen Diagnose tritt er seinen letzten Job an, der ihm eigentlich das Geld für die Rente bringen sollte. Zunächst will er ihn wie gewohnt erledigen, doch dann findet er heraus, dass er einen 18-Jährigen beseitigen soll, um die schmutzigen Geschäfte reicher Geschäftsleute zu schützen. Er trifft eine folgenschwere Entscheidung und wird plötzlich selbst zum Gejagten. Seine Gegner sind einflussreich, zugleich setzt die Erkrankung dem Libero immer mehr zu. Aber er ist zäh – und er steckt voller Überraschungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 162
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2019 – e-book-Ausgabe RHEIN-MOSEL-VERLAG Zell/Mosel Brandenburg 17, D-56856 Zell/Mosel Tel 06542/5151 Fax 06542/61158 Alle Rechte vorbehalten ISBN 978-3-89801-875-3 Ausstattung: Stefanie Thur Titelfoto: Africa Studio/Shutterstock.com
Michael Hackethal
Libero
Der Tod macht keine Ausnahme
Kriminalroman
Rhein-Mosel-Verlag
Der Fehler
Die Welt hat einen Fehler, und dieser Fehler ist in meinem Kopf. Jeden Tag wird er ein wenig größer.
Ich habe schon als Kind gewusst, dass die Welt Fehler hat. Und die Erwachsenen? Mein Gott, die taten, als wüssten sie Bescheid, und hatten doch von nix ’ne Ahnung. Wie kann Gott vollkommen und allmächtig sein, hab ich mich gefragt, wenn der Teufel existiert und alles durcheinander bringt? Wie kann Gott zulassen, dass er die Menschen böse macht? Wieso hat Gott einen Plan und erschafft dann eine Kreatur, die ständig dagegen arbeitet? Das ergab überhaupt keinen Sinn für mich. Ich bin mit meiner Frage zum Pfarrer, der war schließlich Spezialist für Heiliges und Ewiges. Ich hätte es wissen müssen. Seine Antwort war so lang und verworren, dass ich gegangen bin, bevor er damit fertig war. Ich hab ihn nie wieder was gefragt.
Wer nicht in der Lage ist, eine klare Antwort zu geben, der hält besser die Klappe. Das wusste ich schon mit neun. Deshalb habe ich jahrelang selbst mein Maul gehalten. Kein Witz! Ich war in der Schule so gut wie stumm, hatte keine Freunde, hab zuhause im Zimmer gehockt und irgendwas gemacht, ganz still für mich. Meine Mutter hat mich oft gefragt, was mit mir los ist. Ich konnte es nicht sagen. Es war so kompliziert, dass es eh keiner verstanden hätte. Falls ich es überhaupt in Worte hätte fassen können. Also habe ich meine Fragen lieber bei mir behalten.
Irgendwann, dachte ich, kommt der richtige Moment, um sie zu stellen. Bei manchen Fragen war das tatsächlich so. Andere sind im Schweigen versunken.
Ich liebe Wörter. Vielleicht war ich deshalb so vorsichtig mit ihnen. Irgendwann habe ich sogar aufgehört, meinen Namen zu nennen. Ich wollte ihn auch von niemand anderem mehr hören.
So halte ich es bis heute, und ich fahre gut damit.
Gustav rief mich an, wie er das immer macht, kurz vor Mitternacht. Ich hatte gerade was eingeworfen, es ging mir mies, ich wollte nichts mehr hören, nichts mehr sehen, nichts mehr sagen. Nur noch staunen.
Na, gestaunt hab ich, als er’s mir erzählte. Der Job hörte sich nicht schwierig an und ich dachte, das ist schnell erledigt. Aber im Moment läuft bei mir alles anders, als ich es mir vorstelle. Das heißt, wenn ich ehrlich bin – eigentlich war das schon immer so.
Ich habe einen Job, der ziemlich viel einbringt. Ich bin gut, und ich bin gründlich. Das bringt lukrative Aufträge, seit über vierzig Jahren.
Da müsste ich eigentlich nicht mehr arbeiten, denken Sie jetzt sicher, und so war das auch, bis vor ein paar Jahren. Damals habe ich den größten Fehler meines Lebens gemacht, und ich habe große Fehler gemacht. Aber dieser stellt alle anderen in den Schatten. Nur wegen diesem Scheiß muss ich immer noch arbeiten. Und ich habe schon lange keine Lust mehr, das können Sie mir glauben.
Damals habe ich mir gesagt, dass es besser ist, wenn ich mein Geld irgendwie anlege. Also bin ich in eine Bank und habe mich beraten lassen, eine große Filiale der Deutschen Bank in Köln. Das hört sich so offiziell an, dachte ich, die müssen wissen, was sie tun.
Ich habe viel dazugelernt seitdem.
Aber die anderen hatten es nicht anders gemacht. Damals waren alle wie verrückt auf Aktien und Fonds und das ganze Zeug.
Zwei Jahre später war alles weg. Ich musste sogar mein Auto verkaufen.
Sie haben zu risikofreudig investiert, sagte mir der junge Bursche nachher. Dabei war es die Pappnase doch selber gewesen, die mir den Mist aufgeschwatzt hatte. Wäre ich damals nicht so viel unterwegs gewesen, dann hätte ich mich intensiv um diesen ›Berater‹ gekümmert. Wäre mir ein Vergnügen gewesen.
So musste ich weiter arbeiten, obwohl ich mich schon längst zur Ruhe setzen wollte. Zum Kotzen. Augen, Rücken und Beine werden ja nicht besser mit den Jahren. Ein bisschen was konnte ich zurücklegen, immerhin, aber es war nicht genug, um ganz ohne Arbeit über die Runden zu kommen. Vielleicht noch ein großer Job, dann könnte es hinhauen.
Und dann dieser Anruf mitten in der Nacht. Es war wie ein Geschenk.
Also hab ich gesagt, Gustav, du Arsch, ich mach’s, kenne dich ja lange genug. Aber nicht für billig, und danach ist Feierabend. Du weißt doch, ich bin nicht mehr so fit wie früher. Und er hat gesagt, ok, das ist der letzte Job. Endgültig.
Wir wussten beide nicht, wie recht wir hatten.
Der Typ, um den es ging, war ein wichtiger Zeuge, der von der Bullerei versteckt wurde. Klarer Fall für einen Spezialisten. Und genauso klar, dass Gustav an mich dachte.
Er vermittelt diese Jobs nur, die eigentlichen Auftraggeber sind andere. Mit Gustav bin ich meistens gut klargekommen, vielleicht mochte ich ihn sogar ein bisschen. Längst nicht so wie Kalle, klar, aber ich respektierte seine Zuverlässigkeit. Bei ihm war ein Wort ein Wort.
Wie gesagt, es war kurz vor zwölf in der Nacht. Ich hatte mal wieder Kopfschmerzen, ziemlich heftig, wollte mit keinem mehr reden. Als ich sah, dass er es war, ging ich doch dran, und dabei fiel mir das Handy hin. Ich hatte es nicht gespürt. Ich musste es mit der rechten Hand aufheben. Die linken Finger waren komplett taub.
Gustav war noch dran. Er bot mir diesen Job an, erklärte, wie viel Zeit ich hätte, dass es auf exakte Arbeit ankäme.
»Der Job ist nicht einfach. Aber er ist superwichtig. Mach keinen Fehler, Libero. Es wäre dein letzter.«
»Ich kann es nicht leiden, wenn man mir droht«, sagte ich.
»Ich bin sonst selbst erledigt«, sagte er.
Ständig bellte sein Scheiß-Dackel dazwischen. Ich war ziemlich genervt und sagte, es müssten hundertachtzig Riesen sein und sechzig vorab, drunter würde ich das nicht machen, und er meinte, das wär aber teuer und er müsste das klären und würde noch mal anrufen. Dann mach schnell, sagte ich, sonst weiß ich nicht, ob ich’s noch richtig mitkriege. Kurz darauf war er wieder dran und sagte, ok, wir sind im Geschäft.
Geht doch.
Ich weiß noch, wie ich die ganze Zeit verwundert meine linke Hand angeschaut habe. Die Finger waren immer noch gefühllos.
Das war Tag minus drei.
Ich rechne ab dem Tag, an dem man mir von dem Fehler erzählte. Alles andere ist relativ zu diesem Datum.
Datum, das heißt wörtlich »das Gegebene«. Scheiß-Latein.
Manchmal denke ich, dass Wörter einen zweiten oder dritten Sinn haben, einen, der viel wichtiger ist als der oberflächliche Sinn, den wir meinen, wenn wir sie benutzen. Aber sie verändern sich mit jedem Zusammenhang, und oft drücken sie sich weg, fließen in eine Sinnform, die nur in diesem Moment, unter diesen Umständen und vielleicht nur für einen einzigen Menschen erkennbar und verständlich ist. Beim nächsten Mal fühlen sie sich wieder anders an, lösen andere Gedanken aus. Unfassbar. Als hätten sie eine eigene Intelligenz.
Ich gehe an meine Arbeit sehr nüchtern heran, mit chirurgischer Präzision. Organisation ist alles. Name, Adresse, spätester Termin – mehr will ich gar nicht wissen. Nüchterne Betrachtung der Fakten und Ziele, Abwägung der Optionen, Entscheidung über das Vorgehen, dann Planung, Erkundigungen, Umsetzung. Fertig.
Ich bin ein absoluter Profi. Niemand, der etwas über meinen Job weiß, kennt mein Gesicht. Bis auf Gustav und Kalle. Gustav ist mein Auftraggeber, der wird die Klappe halten, und für Kalle lege ich meine Hand ins Feuer. Wir haben schon so viel gemeinsam durchgestanden.
Davon abgesehen wissen die beiden, was sie erwartet, wenn sie mich verarschen.
In der Branche bin ich bekannt als Ausputzer. Und weil hier alle so verrückt auf Fußball sind, nennen sie mich den Libero. Das ist italienisch und heißt »freier Mann«, hat mir Kalle mal erklärt. Ich verstehe nichts von Fußball, aber das gefällt mir. Auch wegen der Tarnung. Meine Freiheit ist mir wichtiger als alles andere.
Ben Hagenfeld hieß der Typ, wohnhaft in Düsseldorf. Der Name war mir bekannt, ich sag’ Ihnen auch gleich, wieso. Und ein Düsseldorfer mehr oder weniger – wen interessiert das außerhalb von Düsseldorf? Ich komme aus Köln, da schaut man nicht rheinabwärts, wenn man’s vermeiden kann.
Ich hatte vier Wochen Zeit für den Job, mehr als genug. Dachte ich jedenfalls.
Gleich am nächsten Tag habe ich die Adresse überprüft. Eine Wohngegend mit durchweg vier oder fünf Etagen, ein Bau am anderen, die ganze Straße runter. Hauptverkehrsstraße gleich nebenan, aber nicht so laut, dass es nervte.
Dachte erst, das kann nicht sein, wer in so einer Gegend soll es wert sein, dass ich mich um ihn kümmere? Und für hundertachtzig Riesen, ich bitte Sie!
Ich wollte die Namen checken, die da gemeldet waren. Es gab acht Klingelschilder. Und dann fiel mir wieder was auf. Ich schaute hin, und konnte immer nur die lesen, die ich gerade nicht anschaute. Der Name im Zentrum meines Blicks war wie weggeblasen. Ich kniepte dauernd und dachte, brauchst du jetzt eine Brille oder hast du eine von den Pillen gestern nicht vertragen? So stark hatte ich das noch nie gehabt.
Und der Name Hagenfeld war auch nicht dabei.
Das fängt ja gut an, dachte ich, und rief gleich Gustav an.
»Nee«, sagte der, »die Adresse ist ok, er heißt jetzt anders.«
»Wie, anders, hat der geheiratet oder was?«
»Quatsch«, sagte er, »Zeugenschutz und neue Identität.«
Sieh mal an. Gut, dass ich fett kalkuliert hatte.
Ich schaute mich um und überlegte. Sperrmüll vorm Eingang, neben der Tür ein Zettel mit der Nummer vom Hausverwalter. Vielleicht war ja gerade was frei geworden. Ich rief sofort an.
Im zweiten Stock war tatsächlich jemand ausgezogen. Die Wohnung wurde geräumt und renoviert. Ob ich sie mir anschauen wollte.
Klar wollte ich.
Er kam zehn Minuten später und zeigte mir die siebzig Quadratmeter. Was soll ich sagen? Auf einer Skala zwischen null und hundert holte sie eine souveräne Sechs. Verwohnt wäre noch geschmeichelt. Nur Kalles Bude konnte das unterbieten. Klar, Kalle definiert den Nullpunkt der Skala, nicht nur was Wohnungen angeht. Gib Kalle eine Woche, und er verwandelt jede Prinzensuite in einen Nullpunkt. Er ist der Emir der Entropie, der Kallebrierpunkt schlechten Geschmacks.
»Sind alle Wohnungen im Haus gleich angelegt?«, fragte ich.
»Ja, alle mit demselben Grundriss. Die auf der anderen Seite des Flurs sind genauso, nur seitenverkehrt.«
Praktisch, dachte ich.
Was soll ich sagen, ich hab die Bude gemietet. Sie sollte ja noch renoviert werden.
»Aber machen Sie flott«, sagte ich beim Gehen.
Irgendwie hatte ich’s eilig.
Mein persönlicher Nullpunkt kam zwei Tage später. Nicht, dass es mein erster Nullpunkt gewesen wäre. Ich hatte einige in meinem Leben. Dieser wird der letzte sein. Klingt fast wie ein Trost.
Aber der Reihe nach.
Gleich nach der Wohnungsbesichtigung bin ich zu einem Optiker, wollte wissen, ob ich eine Brille brauche. Er hat sich meine Augen angesehen und gemeint, ich müsste erstmal zum Augenarzt, und zwar unbedingt. Da wäre was im rechten Auge nicht in Ordnung. Er rief sofort einen an, damit ich schnell drankäme. Mist, ausgerechnet das rechte.
Gut, ich also zum Augenarzt. Nach nur zweieinhalb Stunden Warten bin ich schon dran. Der Mann schaut sich das an, nimmt sich Zeit, dann erklärt er mir, ich hätte ein Netzhaut-Ödem. Dadurch wäre meine Sicht eingeschränkt. Ob ich Diabetes hätte. Nein. Ob mir sonst irgendwas aufgefallen wäre. Ja gut, die Kopfschmerzen in den letzten Wochen, nachts und morgens vor allem. Ich bin in letzter Zeit manchmal ungeschickt, hab mich neulich beim Zwiebelschneiden in den linken Zeigefinger geschnitten, hab schon mal was fallen lassen. Ist mir früher nie passiert. Er fragt nach. Ja, immer mit links. Und morgens ist mein Blutdruck im Keller. Aber das geht ja vielen so.
Man kann das Ödem mit Injektionen behandeln, direkt ins Auge. Geht ambulant, aber nur bei klinischen Bedingungen. Er macht so was. Das Zeug ist ziemlich gut, allerdings nicht von der Kasse anerkannt, kostet 1500 Euro für die gesamte Behandlung. Und Termine sind schwierig, er ist ziemlich ausgebucht.
Ich sage, morgen fangen wir an und ich zahle bar, Rechnung nicht nötig.
Bestens, sagt er, gerade ist ein Termin frei geworden.
Dabei hat er nicht mal in seinen Kalender geschaut.
Er schickt mich noch am selben Tag in die Uniklinik, ich soll die Symptome auf jeden Fall prüfen lassen. Ruft sogar selbst da an und organisiert einen Termin. Sowas hab ich noch nie erlebt. Ich bin gleich anschließend mit einem Taxi dahin, wurde stundenlang durchgecheckt, mit EEG, EKG, MRT und Pipapo. Damit die Sache möglichst schnell ein Ergebnis brachte, hab ich jedem, der mir nicht blöd kam, einen Zwanziger Trinkgeld in die Hand gedrückt.
Und was denken Sie: Schon den Tag drauf sollte ich wiederkommen, um die Diagnose zu hören.
Am nächsten Morgen bin ich erstmal wieder zum Augenarzt, Spritze ins Auge abholen. War nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt hatte.
Danach ab in die Uni-Klinik.
Der Oberarzt war sehr professionell. Er meinte, das neuroektodermale Gewebe des zentralen Nervensystems sei betroffen, es handele sich um ein intrakranielles Meningeom vierten Grades.
Interessant, meinte ich, und was ist das?
Ein Tumor.
Das sagte mir mehr, als mir lieb war.
Bösartig.
Damit kannte ich mich auch aus.
»Wie viele Grade gibt’s denn?«, fragte ich.
»Vier«, sagte er.
Ich muss so blöd gekuckt haben, dass er mir das alles erklärte. Er meinte, der Tumor drückt auf Zentren im Hirn, die meine Bewegungen steuern (linker Arm, Hand), und auf den Sehnerv (rechtes Auge). Und warum ich so spät gekommen sei, operieren könne man jetzt nicht mehr, und er wolle mir keine falschen Hoffnungen machen. Ob ich ein offenes Wort vertragen könne. Nichts anderes, hab ich gesagt. Gut, er schätze, dass mir drei bis fünf Wochen blieben, schwer zu sagen. Aber zu Bestrahlung und Chemo würde er raten, das könne gleich nächste Woche losgehen.
Ach, und es könne in nächster Zeit verstärkt zu Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen, Gedächtnisverlust, Lähmungen, Krämpfen, epileptischen Anfällen, Wesensveränderungen und weiteren Symptomen kommen. Schwer zu sagen, weil man nie weiß, wie ein Tumor weiter wächst.
»Und die Behandlung?«, fragte ich.
»Chemotherapie und Bestrahlung. Sie müssen für ein, zwei Wochen regelmäßig in die Uniklinik fahren, bei schlechter Verträglichkeit auch stationär.«
Die möglichen Folgen seien ja bekannt: Haarausfall, Übelkeit, Schwäche, Müdigkeit, Überempfindlichkeit bei Geräuschen, Gerüchen, Helligkeit usw. Zusätzlich zu den Symptomen, die der Tumor verursacht.
»Geht mir auch ohne Behandlung schon beschissen genug«, sagte ich.
Ob ich noch Fragen hätte.
Hatte ich erstmal keine.
Dann hat er mir ein Rezept geschrieben und alles Gute gewünscht.
Wie gesagt, an dem Tag hab ich meinen persönlichen Zähler auf Null gestellt.
Tag eins
Nach dem Augenarzt bin ich rüber in die neue Wohnung.
Es war der sparsamste Umzug meines Lebens. Ich hab die alte Wohnung erstmal behalten, nur die wichtigsten Sachen mitgenommen, Küchenkram und ein paar kleine Möbel. Ein Bett gekauft, einen Kleiderschrank, Tisch und Stühle, eine Miniküche, alles gebraucht. Für ein paar Scheine und Trinkgeld wurde der ganze Rotz geliefert und aufgestellt.
Ich hab noch alle Fenster aufgerissen, um den Gestank nach Farbe und Lack möglichst schnell loszuwerden, und mich gleich wieder davon gemacht. Mir wurde schlecht davon.
Dann bin ich zu Gustav, den Vorschuss abholen. Obwohl ich gerne einen Packen Scheine in der Tasche habe, war ich total schlecht gelaunt. Erst hab ich mich noch über mich selbst gewundert, denn das Wetter war gut und ich bin eigentlich nicht leicht kleinzukriegen, aber dann fiel mir ein, dass ich durchaus einen Grund hatte, stinkig zu sein.
Irgendwie ist das noch nicht ganz bei mir angekommen.
Den Rest des Tages habe ich in einem Kiosk in der Nähe gesessen, Kaffee und einen Cognac getrunken und den Hauseingang beobachtet. Wollte sehen, ob ich diesen Hagenfeld zu Gesicht kriegen würde. Er kam aber nicht raus.
Die meiste Zeit war ich damit beschäftigt, nicht an diesen Arsch von Arzt zu denken. Nicht besonders erfolgreich, muss ich zugeben.
Tag zwei
Siehe oben. Und ich hab die alte Wohnung doch gekündigt. Muss man ja mindestens sechs Wochen vor Auszug.
Dürfte hinhauen, dachte ich.
Den Kaffee verdünne ich mir jetzt gerne mit Cognac. Mit ordentlich Cognac, meine ich. Aber nicht vor zwölf.
Am späten Vormittag kam ein junger Bursche aus dem Haus, ziemlich dünn, mit Begleiter. Der war bestimmt zehn Jahre älter, durchtrainiert, sehr wachsam. Ein Auto kam aus der Tiefgarage um die Ecke direkt vor den Eingang gefahren, sie sind reingesprungen und sofort losgefahren. Das wird er gewesen sein. Es war ein schwarzer Kombi, Marke VW, mit dunklen Scheiben.
Ich gleich Gustav angerufen.
»Sag mal«, meinte ich, »der Typ ist ja noch ein Kind!«
»Ist das ein Problem?«, fragte Gustav.
Ich musste einen Moment nachdenken. Hundertachtzig Riesen. Cash. Fetter Vorschuss.
»Eigentlich nicht.«
»Warum rufst du mich dann an?«
»Arschloch«, murmelte ich, aber er hatte schon aufgelegt.
In einer Apotheke habe ich dann das Rezept eingelöst. Die Frau im weißen Kittel hat mich angesehen, als ob sie alles gewusst hat.
Tag drei
Hab’s erst jetzt so richtig kapiert. Bin nur zum Augenarzt, danach gleich wieder ins Bett. Hab versucht mich zu sortieren, mein Leben zu sortieren, das, was davon übrig ist. Viel ist es ja nicht.
Irgendwann bin ich aufgestanden und durch die Zimmer gegangen. Ein paar Regale mit Büchern, Möbel, Schränke voll Zeugs, das weggeschmissen wird, wenn ich –
Man will gar nicht darüber nachdenken. Und dabei müssen wir doch alle gehen, irgendwann.
Ja, irgendwann schon. Aber so bald?
Warum hat es ausgerechnet mich erwischt? Die Frage stellt sich in so einer Situation von selbst, aber es gibt keine Antwort darauf. Es ist einfach so, und es ist zum Kotzen. Und was heißt schon »ausgerechnet«. Es erwischt so viele.
Nicht, dass ich ständig darüber nachdenke, denn ich verschwende nicht gerne meine Energie. Aber es nagt doch an mir. Du fühlst dich unsterblich, bis dir irgendwann klar wird: Auch du wirst gehen. In meinem Fall: bald gehen.
Warum? Wohin?
Scheiß drauf. Werd’ ich bald genug erfahren.
Wenigstens brauch ich mir um so was wie Grab und Erbe keine Gedanken zu machen. Bin allein, hab genug Geld, das ich noch ausgeben kann. Oder verschenken. Der ganze Plunder hier interessiert mich nicht mehr. Nur um die Bücher ist es schade.
Ich hab mal kurz überschlagen: Sechzig Riesen Anzahlung macht bei vier Wochen zweitausend Euro am Tag, die ich ausgeben kann. Da kann man doch endlich mal ganz entspannt einkaufen gehen. Es sei denn, ich bin zäher als gedacht oder der Onkel Doktor hat sich verrechnet. Wäre nicht das erste Mal. Aber dann kommt ja die Restzahlung. Dann kann ich nochmal richtig auf die Kacke hauen. Ich muss nicht mal an meine Barreserven ran.
Ich sollte trotzdem eine zweite Meinung einholen. Nur um sicher zu sein.
Tag vier
Ich hab es in der Wohnung nicht mehr ausgehalten. Bin losgegangen, einkaufen. In der Nähe ist ein Supermarkt, wo es alles gibt, was ich brauche. Laufen ist ja kein Problem. Eher das Lesen der Preisschilder. Aber mir ist egal, ob der Wein 13,99 kostet oder 18,99. Hauptsache, er schmeckt und schlägt an.
Mit viel Geld in der Tasche macht Einkaufen ja eigentlich Spaß, aber an dem Tag war ich die ganze Zeit stinkig. Als ob es nichts gab, das gut genug für mich wäre. Nichts, das mir irgendwie hätte helfen können. Wahrscheinlich gibt es auch nichts.