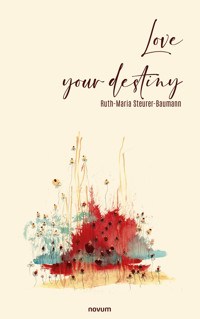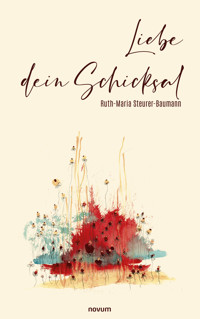
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum pro Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Lipburger – eine Familie mit sechs herausragenden Frauen und drei Männern, deren Schicksale von nie ausgesprochenen dramatischen Erlebnissen geprägt waren. Die ganze Sippe scheint nur ein Problem zu haben, das von jeder Person auf eine andere Art ausgelebt wird. Ruth-Maria Steurer-Baumann erzählt von den Verstrickungen und Schmerzen, die aus einem nicht authentisch gelebten Leben resultieren. Die Autorin entführt uns in ein österreichisches Dorf im zwanzigsten Jahrhundert, in eine Zeit, in der Totschweigen zum Alltag gehört und die öffentliche Meinung weit mehr zählt als das persönliche Glück. Kann es ein Schicksal geben oder sind all die Parallelen, die Sorgen und Traumata dem Zufall geschuldet?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2023 novum publishing
ISBN Printausgabe: 978-3-99146-336-8
ISBN e-book: 978-3-99146-337-5
Lektorat: DK
Umschlagabbildung: Manja Roos
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
Innenabbildungen: Ruth-Maria Steurer-Baumann
www.novumverlag.com
Prolog
Wer bin ich?
Woher komme ich?
Bei mir zu Hause wurde immer von Vererbung geredet.
Es war wie ein ungeschriebenes Gesetz, dass man jemandem in der Sippe ähnlich ist.
Wie oft habe ich gehört: „Du bist auf und ab wie Tante Mik.“
Es gab noch viele solcher Beispiele. Ich glaube, die meisten Menschen kennen das auch.
Natürlich hat mich das total genervt. Ich wollteIchsein. Ich wollte nicht das Blaupapier von jemand schon Existierendem sein.
Mein Ziel war eine eigene Identität, die einzigartig war.
Diese zu erreichen, dauerte Jahre, besser gesagt Jahrzehnte.
Aber irgendwann habe ich angefangen zu reflektieren.
Nun, warum habe ich das getan?
Weil ich mich fragte, woher meine Charakterzüge kommen. Warum ich ein solcher Freigeist und sicher auch eine Querulantin bin.
Habe ich dieses Drehbuch über mich ganz allein geschrieben? Oder schleppe ich irgendwelche nicht erledigten Anteile meiner Vorfahren mit mir herum?
Gleichzeitig fragte ich mich, ob dies nur eine Ausrede war, mit der ich gewisse Charakterzüge gerechtfertigt habe.
Quasi: „Es ist nicht meine Schuld, das liegt in der Familie.“ Aber ich wollte der Sache schon etwas mehr auf den Grund gehen.
Ich hatte schon als Kind sämtliche Antennen ausgefahren. Ziemlich früh habe ich mitbekommen, dass man über vieles nicht wirklich reden durfte.
Daraus entwickelte sich mein Vorhaben, mich mit den Vorfahren meiner Mutter und denen meines Vaters auseinanderzusetzen.
Ich fing meine Recherchen bei den Lipburgern an, der Sippe meiner Großmutter väterlicherseits.
In meiner Kindheit waren die Lipburger sehr präsent in unserem täglichen Leben.
Dies kam sicher davon, dass sie irgendwie anders waren als die meisten Leute in unserem Dorf.
Das Glück war auf meiner Seite. Mein kanadischer Cousin zweiten Grades hatte einen Koffer voller Dokumente, Briefe und Fotos aufbewahrt.
Darin konnte man das „Drehbuch“ bis zu meinen Urgroßeltern und deren Verwandtschaft zurückdrehen.
Ein wahrhaftiger Schatzfund.
Ich hatte mir nicht einmal in meinen wildesten Träumen vorstellen können, auf was ich da alles stoßen würde.
Je mehr ich mich damit beschäftigte, desto mehr fühlte ich, dass es die gleichen Verstrickungen und Thematiken immer noch gab. Die Parallelen waren unübersehbar.
Dies war etwas anderes als Vererbung. Waren es die unsichtbaren Fäden des Ausgleiches, die uns in der Sippe zusammengeführt hatten?
Karma ist in der Zwischenzeit ein geläufiger Ausdruck, mit dem man gerne etwas herumscherzt. Aber ist dies wirklich nur ein Modephänomen?
Mir fiel die Filmkomödie „Und täglich grüßt das Murmeltier“ ein. In diesem Film geht es um einen arroganten, egozentrischen und zynischen Meteorologen, der in einer Zeitschleife festsitzt und ein und denselben Tag immer wieder erlebt, bis er als geläuterter Mann sein Leben fortsetzen kann.
War ich die Person, die diesen Job annehmen sollte, um aus dieser Ahnenschleife rauszukommen?
Natürlich fehlten mir gewisse Zusammenhänge, also recherchierte ich in Archiven. Ich versuchte auch, noch lebende Zeitzeugen zu befragen. Leider stieß ich manchmal auf ein gewisses Zögern. Es war, als ob man sich damit lieber nicht beschäftigen wollte.
In einem Tausend-Seelen-Dorf redet man auch heute nicht gerne über schon längst vergangene Skandale.
Handelte es sich um meinen inneren Widerstand? Wollte ich nicht unter den Teppich schauen?
Auf was hatte ich mich da eingelassen?
Es wäre sicher einfacher gewesen, den Koffer wieder einzupacken und nach Kanada zurückzuschicken.
Aber war dies meine Art?
Nein, definitiv nicht!
Mein Vater und auch meine Tante hatten recht gehabt. Schon als Kind rieben sie mir, zu meinem Verdruss, meine Ähnlichkeit mit meiner Großtante Maria Katharina unter die Nase, die besser unter den Namen Mik oder Mikle bekannt war.
Sie hatte sich nie vor irgendetwas gedrückt.
Auch ihre Art ist nicht immer mit Begeisterung aufgenommen worden.
Hatte sie sich darum geschert?
Nein, sie tat, was sie zu tun hatte, und stand zu ihrer Persönlichkeit.
Darum habe ich mein ganzes Herz in diese Aufarbeitung gelegt, auch wenn es manchmal frustrierend war. Es gab jedoch immer wieder Unterstützung, die mir Mut gemacht hat.
Ich wollte ebenfalls die Geschichte meiner Vorfahren von der Sippe meines Großvaters väterlicherseits, Leo Steurer, aufarbeiten, aber abgesehen von ihm bin ich leider auf keine wirklichen Informationen gestoßen.
Der Hausname dieser Steurer-Sippe ist Schlosser und sicherlich sehr passend.
Man kann das auch heute noch in dieser Sippe spüren. Der Schlosser macht seinen Schlüssel und damit kann er sich einschließen. Nur weiß er oft selbst nicht mehr, wo der Schlüssel ist. Der Schlüssel zu den Gefühlen ist ihm verloren gegangen.
Wenn er ihn wieder finden will, muss er sein Herz öffnen und sich zeigen, wie er mit Leib und Seele ist. Alle Masken müssen abgenommen werden.
Es war sicher kein Zufall, dass ich mit einem Rechtsanwalt intervenieren musste, um Einblick in die Verlassenschaft von meinem Großvater, „Schlossers Leo“, zu erhalten. Mein Großvater ist 1956 gestorben. Aber wenn man ein Schlosser ist, will man nicht, dass etwas an die Öffentlichkeit kommt. Denn auch nach dem Ableben möchte man den Ruf waren.
Da die Aufarbeitung der Lipburger-Familiengeschichte ein viel größerer Aufwand war, als ich mir je vorgestellt hätte, habe ich mich hier nur auf diesen Teil der Ahnenlinie konzentriert.
Ich fühlte seit meiner Kindheit eine Melange aus Faszination und Abscheu gegenüber der Lipburger-Sippe.
Das Folgende ist eine fiktive Korrespondenz zwischen mir und meinen Vorfahren.
Die Recherchen haben mir geholfen, dem Leben und den Gefühlen meiner Ahnen näher zu kommen.
Meine Vorfahren sind nicht mehr auf dieser Welt und es handelt sich um eine romantisierte Art von Briefwechsel.
Ich bereue keinen Moment den immensen Zeit- und Energieaufwand.
Durch diese spannende und aufschlussreiche Erfahrung konnten die in mir schlummernden Facetten meiner Persönlichkeit beleuchtet werden.
Auch wenn meine Vorfahren nicht immer die konventionellsten Wege gegangen sind, bin ich ihnen dafür dankbar. Somit war der Pfad schon etwas ausgetrampelt.
Ich bin vor Kurzem durch einen glücklichen Zufall auf den nachfolgenden Nahuatl-Segen gestoßen, geschrieben im siebten Jahrhundert in der Zentralregion von Mexiko.
(Bendicion Nahuatl, „Yo libero“)
Ich befreie …
„Ich befreie meine Eltern von dem Gefühl, mir zu wenig gegeben zu haben, und von dem Glauben, bei mir versagt zu haben.
Ich befreie meine Kinder von der Notwendigkeit, mich stolz machen zu müssen. Mögen sie ihre eigenen Wege gehen, je nachdem, was ihnen ihr Herz immerzu zuflüstert.
Ich befreie meinen Partner/meine Partnerin von der Verpflichtung, mich zu vervollständigen. Mir fehlt nichts, ich lerne die ganze Zeit mit allen Wesen.
Ich danke meinen Großeltern und meinen Vorfahren, die zusammengekommen sind, sodass ich heute das Leben atmen kann.
Ich befreie sie von den Misserfolgen der Vergangenheit und unerfüllten Wünschen, wissend, dass sie ihr Bestes getan haben, ihr Leben zu bewältigen, in dem Bewusstsein, das sie damals hatten.
Ich achte sie, liebe sie und erkenne sie als unschuldig an.
Ich entblöße meine Seele vor ihren Augen, deshalb wissen sie, dass ich nichts verberge oder schulde, als mir selbst und meiner eigenen Existenz treu zu sein. Indem ich der Weisheit meines Herzens folge, bin ich mir dessen bewusst, dass ich meinen Lebensplan erfülle – frei von sichtbaren und unsichtbaren familiären Loyalitäten.
Mein Friede und mein Glück liegen in meiner eigenen Verantwortung.
Ich verzichte auf die Rolle des Retters, ich verzichte darauf, die Erwartungen anderer zu erfüllen.
Ich lerne durch die Liebe und nur durch sie, achte meine Essenz und segne mein Wesen und meine Art, mich auszudrücken, auch wenn mich einige vielleicht nicht verstehen.
Ich verstehe mich selbst, denn nur ich habe meine Geschichte gelebt und erlebt. Weil ich mich selbst kenne, weiß ich, wer ich bin, was ich fühle, was ich tue und warum ich es tue.
Ich achte mich und nehme mich an.
Ich ehre das Göttliche in mir und in dir.
Wir sind frei …“
Jeder hat seinen eigenen Seelenweg und keiner ist identisch, jedoch haben wir alle das gleiche Ziel.
AMA FATUM – Liebe dein Schicksal.
Gebhard Lipburger
(* 16.10.1858 in Langenegg, † 03.10.1917 ebenda)
Liebster Urgroßvater Gebhard,
ich bin auf einen gewissen Widerstand gestoßen, als ich meiner Verwandtschaft erzählte, dass ich mich mit dem Leben unserer Vorfahren auseinandersetzen wolle.
„Lass die Toten ruhen.“ Wurde mir gleich anempfohlen.
Nach meinem Gefühl ist der wirkliche Grund jedoch ein anderer.
Ist es die Angst, dass ich eventuell etwas Glanzloses entdecken könnte?
Was ist dieser Widerstand? Ist es Angst? Ist es Scham, die in unserem Unterbewusstsein vergraben ist?
Dein Bruder war Dr. Medizinalrat Josef Lipburger. Wir sind auch heute noch alle stolz und erwähnen gerne, dass wir mit ihm verwandt sind. Stell dir vor, sogar die Kinder deiner Enkelin Mariele, die nach Kanada ausgewandert ist, sind bestens über deinen Bruder informiert.
Irgendwie finde ich das total hirnverbrannt. Warum prahlt man mit jemandem, der schon seit fast hundert Jahren gestorben ist?
Wahrscheinlich, weil man sich selbst klein fühlt und sich mit den Federn dieses Urgroßonkels etwas schmücken kann.
Ich habe auch vor Kurzem herausgefunden, dass du einen Neffen hattest, der ebenfalls einen Doktortitel hatte. Er hat in Genf studiert und war Chemiker in Rom. Ich frage mich immer, wie denn die Leute aus einem Unter-Tausend-Seelen-Dorf im Bregenzerwald so etwas schafften.
Dein Vater war der Vorsteher, der Bürgermeister von Oberlangenegg. Auch wenn ihr sicher eine herausstechende Familie im Dorf oder wahrscheinlich im ganzen Bregenzerwald wart, hatte dies sicher nichts mit der K.-u.-k-Noblesse zu tun.
Darum frage ich mich, wie es kam, dass in diesem Lipburger Clan so viele Leute mit einer höheren Schulbildung waren.
Wie ist dein Bildungsweg verlaufen?
In unserer Verwandtschaft wurde immer etwas über deinen Tod gemunkelt. Niemand gab eine wirkliche Erklärung darüber ab.
Ich bin eine Stöbernase und habe ein Foto von einem Mann mit einer Postmütze vor dem „Gasthaus – Pension Hirschen – Post“ gefunden. Neben diesem Mann steht eine Frau mit zwei kleinen Mädchen.
Ich bin mir fast sicher, dass auf diesem Foto du mit deiner Frau Leopoldina abgebildet bist. Die beiden Mädchen daneben sind wahrscheinlich deine Töchter. Die größere von den beiden muss meine Großmutter Paulina, die andere meine Großtante Maria-Katharina sein.
Ich habe auch noch ein anderes Foto gefunden, auf dem du nicht zu sehen bist, aber ich bin trotzdem stolz auf diese Aufnahme und gleichzeitig stimmt sie mich wehmütig.
Das Foto wurde 1927 gemacht. Der Musikverein „Bergesecho Langenegg“ ist auf dem Gruppenbild zu sehen. Es wurde vor deinem Haus aufgenommen.
Obwohl du damals schon seit zehn Jahren auf dem Friedhof lagst, steht auf der Tafel:
„Gasthaus zum Hirschen des Gebhard Lipburger.“ 1927 gehörte dein schönes Gasthaus leider nicht mehr der Familie Lipburger, aber die neuen Besitzer hatten die Tafel noch nicht gewechselt.
Bei einer anderen Aufnahme überlege ich, ob es sich ebenfalls um deine Person und die meiner Urgroßmutter handelt.
Es ist sogar möglich, dass es das Hochzeitsbild von euch beiden ist. Die Frau trägt eine typische Wälder Juppe mit dem Spitzhut. Diese Frau hat den gleichen Gesichtsausdruck wie deine Angetraute Leopoldina auf einem Foto, auf dem sie schon über sechzig ist.
Der Mann daneben hat feine und sensible Gesichtszüge. Aber irgendwie schaut er traurig oder, vielleicht besser gesagt, melancholisch in die Welt hinein.
Wie ist es dazu gekommen, dass du zum Hirschenwirt geworden bist? War dieses Gasthaus schon im Familienbesitz?
Du hast im Alter von dreiunddreißig Jahren in Rankweil Leopoldina Fuchs, die ebenfalls aus Langenegg war, geehelicht. Ich muss zugeben, ich finde das sehr überraschend, dass zwei Langenegger zur damaligen Zeit so weit entfernt geheiratet haben. Rankweil war mit den zur Verfügung stehenden Verkehrsmitteln mehr als eine Tagesreise von eurem Heimatort entfernt.
Die Wälderbahn wurde erst 1902 in Betrieb genommen, so müsst ihr auf Kutschen diese Reise unternommen haben, denn Automobile gab es sicherlich damals auch noch nicht im Bregenzerwald.
Du hattest vier Töchter und einen Sohn. Wie war dein Verhältnis zu ihnen? Welche waren deine geheimen Hoffnungen für das Wohlbefinden und den Werdegang deiner Kinder?
Wie war das Verhältnis zu deiner Frau?
Gab es damals Liebeshochzeiten? Aus welchem Grund hast du geheiratet?
Ich kann mir vorstellen, dass ich dich mit meiner angeborenen Neugierde etwas aus der Fassung bringe. Ich bitte dich, mir dies zu verzeihen.
Es ist für mich von Wichtigkeit, zu wissen, wie dein Leben verlaufen ist und wer du wirklich warst.
Ich bitte dich, mir mit der größten Aufrichtigkeit zu antworten. Ich kann dir jetzt schon bezeugen, dass ich nicht über das urteilen werde, was auch immer du mir erzählen wirst.
Bitte lieber Urgroßvater, akzeptiere meine respektvollen Grüße.
Deine Urenkelin
Ruth-Maria
***
Sei gegrüßt, Kindeskind meiner ältesten Tochter,
es berührt mich sehr, dass du dich auf den Weg gemacht hast, um dich mit der Geschichte deiner Vorfahren auseinanderzusetzen.
Es ist kein einfaches Unterfangen. Du hast sicherlich schon bemerkt, dass es einen Widerstand gibt.
Die wenigen meiner Nachfahren, die noch etwas wüssten, wollen sich damit nicht konfrontieren. Sie werden alle Geheimnisse und vertuschten Geschichten mit ins Grab nehmen.
Nimm es ihnen nicht übel. Es ist nicht jedermanns Neigung, sich zu sagen, dass man mit all diesen Verstrickungen, die es in unserer Familie gegeben hat, weiterhin verbunden ist. Es ist wie eine Art Nabelschnur, die nie richtig durchtrennt werden kann. Solange sich keiner traut, zu sagen: „Ja, das ist auch mein Blut und ich muss lernen, damit umzugehen“, wird es leider immer wieder in sicher völlig verschiedenen Vorkommnissen mit den gleichen Handlungsweisen zu den gleichen Schicksalsfügungen kommen.
Auch die Talente unserer Sippe werden weitervererbt und dies ist erst mal eine freudige Botschaft.
Liebste Ruth-Maria, ich frage dich: Kennst du die Talente der Lipburger?
Sicher kommt dir jetzt gleich in den Sinn, was dir meine Enkelin, die deine Taufpatin ist, immer gesagt hat: „Die Lipburger sind hoch intelligent.“
Die Lipburger haben eine sehr schnelle Auffassungsgabe. Dies hat sicher einiges dazu beigetragen, dass wir viel Interesse an allem hatten, was zur Verbesserung und Modernisierung unseres Alltagslebens beitrug. Heute würde man sagen, wir hatten Pioniergeist.
Unsere Sippe ist sehr wissbegierig, wir geben uns ungern mit dem schon Dagewesenen ab. Wir wollen Neues kennenlernen und verstehen.
Du hast eine sehr große Ähnlichkeit mit meiner Tochter Maria-Katharina. Sie hatte ebenfalls die Gabe, sich mit sehr viel Vehemenz und Engagement mit der Denkweise ihrer Mitmenschen zu beschäftigen.
Wir nehmen ungern hin, wenn wir etwas nicht richtig finden. Wir haben unsere Meinung und wir stehen dafür ein. Manchmal sorgt dies natürlich für viel Schmerz und stößt auf Unverständnis.
Ich wünsche dir, meiner lieben Urenkelin, und allen anderen Nachfahren von Herzen, diese Talente weiterzuentwickeln und dazu zu stehen. Gleichwohl gab es in unserer Sippe nicht nur positive Charakterzüge.
Wir hielten uns sicher für die besseren Leute im Dorf. Jedoch hatte ich nicht das Gefühl, dass wir auf andere hinunterschauten. Nur manchmal fand ich, dass andere nicht offen genug für neue Ideen waren.
Viele wollten am Alten festhalten. Ich machte nie einen Unterschied zwischen meinen Töchtern und meinem Sohn. Ich war überzeugt, dass meine Töchter die gleichen Fähigkeiten und die gleiche Klugheit wie ein Mann hatten. Ich wollte, dass meine Töchter ebenfalls die Möglichkeit hatten, einen Beruf auszuüben und das dafür nötige Wissen durch ein Studium zu erwerben.
Für meine Ideen fand ich sehr viel Unterstützung bei meinem Bruder Josef. Obwohl er ein Junggeselle war, pochte er immer darauf, dass aus seinen Gotakindern einmal etwas werden sollte.
Mein um zwei Jahre älterer Bruder war der Obermedizinalrat Dr. Josef Lipburger. Ich war sehr stolz auf ihn. Er war eine renommierte Persönlichkeit. Gleichzeitig war es nicht einfach, einen so studierten Bruder zu haben. Ich stand immer in seinem Schatten. Ich will ehrlich mit dir sein, ich verspürte eine gewisse Eifersucht ihm gegenüber, denn ich fühlte mich ihm unterlegen. Heute würde man sagen, ich hatte einen Minderwertigkeitskomplex.
Ich ließ ihn dies jedoch nie spüren. Wir hatten 1870 unsere drei älteren Geschwister verloren, die zwischen fünfzehn und achtzehn Jahre alt waren. Sie sind alle an einer Rötelepidemie gestorben. Du musst wissen, damals gab es noch keine Impfung dafür und nur sehr wenige Medikamente.
Mein Bruder Josef wurde in gewisser Weise zum Erstgeborenen. Er sagte immer, er sei Arzt geworden, weil er miterlebt hat, wie es seine Geschwister hingerafft hat.
Besonders für unsere Mutter war dies ein schweres Schicksal.
Du musst dir vorstellen, die drei Geschwister starben am neunzehnten, zweiundzwanzigsten und dreiundzwanzigsten Januar 1870. Der Schreiner kam dreimal innerhalb von fünf Tagen mit jeweils einem Sarg und der Totengräber schaufelte dreimal hintereinander das Grab der Lipburger-Sippe auf.
Natürlich starben die Menschen damals oft sehr jung, aber es war trotzdem für die ganze Familie ein schweres Los. Unsere liebe Mutter ist ihren drei ältesten Kindern fünf Jahre später gefolgt. Sie hatte noch fünf andere Kinder, aber sie hatte nicht mehr die gleiche Lebensfreude. Wir fünf am Leben gebliebenen Kinder waren zwischen zehn und neunzehn Jahre alt, als unsere Mutter starb.
Mein Vater verehelichte sich kurz darauf mit unserer Haushälterin.
Er war ein Visionär und wollte, dass sich der Bregenzerwald weiterentwickelte. Seine Kinder sollten dazu beitragen und dafür brauchte man eine Schulbildung.
Daher hielt mein Vater es für eine gute Idee, dass ich eine Ausbildung als Postexpeditor machen solle. Gleichzeitig würde ich als Gastwirt fungieren. Er ließ ein Gasthaus mit einer Pension bauen, dass sich gegenüber der K.-u.-k Post befand. Ich wurde nun zum Hirschenwirt.
Um ganz ehrlich zu sein, ich hätte lieber ein höheres Studium gemacht und wäre Pfarrer geworden, denn dann hätte ich nicht heiraten müssen. Aber man erwartete von mir etwas anderes in meinem jungen Leben.
Mein Bruder Josef war sehr begeistert von der Idee, dass Oberlangenegg einen gewissen Anschluss an die Welt bekommen würde. Ich wollte ihm beweisen, dass ich es auch zu etwas bringen würde.
Aber als Hirschenwirt sollte ich mich verehelichen. Mein Vater pochte sehr darauf. Ein Gastwirt konnte nicht als Junggeselle leben. Meine zukünftige Gattin Leopoldina Fuchs war ein recht hübsches und vor allem gesundes Weibsbild. Sie war im Verhältnis zu uns Lipburgern relativ klein gewachsen. Mir war das irgendwie nicht so wichtig. Um ehrlich zu sein, hat mich das Weibervolk nie so recht interessiert. Aber mit meinen gestandenen dreiunddreißig Jahren musste ich mich jetzt wohl oder übel verehelichen. Auch Leopoldina war mit ihren achtundzwanzig Jahren nicht mehr die Jüngste, als wir heirateten.
1891 fand unsere Hochzeit in Rankweil statt. Ja, ich weiß, du hast dich gefragt, warum wir nicht in unserem Heimatdorf geheiratet haben.
Wir waren zuvor auf dem Bezirksgericht gewesen. Ich wollte gesetzlich festlegen, was mit unserer Hinterlassenschaft passieren würde, wenn unsere Ehe kinderlos bleiben sollte.
Falls du dir jetzt die Frage stellst, wie ich auf eine solche Idee gekommen bin, kann ich das verstehen. Der Grund ist dieser, liebes Kindeskind meiner Tochter: Als meine Mutter gestorben ist, hat mein Vater, wie du weißt, kurz danach seine Haushälterin geheiratet.
Diese Frau hat meinen Vater aber bei Weitem überlebt, ist von Oberlangenegg weggezogen und hat sich wieder verehelicht. Obwohl sie sich nie um uns gekümmert hat, hatte meine Stiefmutter Anrecht auf den Fruchtgenuss, der jährlich an sie bezahlt werden musste. Ich wollte einfach, dass bei meiner Verehelichung alles von vornherein klar war.
Wenn ich nicht der Hirschenwirt geworden wäre, hätte ich sicher nie geheiratet, sondern wäre, wie mein Bruder Josef, ledig geblieben.
Leopoldina war ein nettes Weibsbild, aber sie interessierte sich nicht für die gleichen Sachen wie ich. Sie konnte lesen und schreiben und, wie ich später herausfand, sie war gut im Rechnen. Dies half ihr mit der Gastwirtschaft und der Pension.
Als ich in unserer Hochzeitsnacht mit ihr in die nun gemeinsame Kammer ging, mich ins Bett begab und ihr eine gute Nacht wünschte, spürte ich ihre Überraschung.
Ich wusste, dass ich jetzt etwas anderes zu tun hatte, als zu schlafen. Aber ungeachtet meines Alters hatte ich bisher noch nie irgendetwas mit einem Weibsbild gemacht, und das, obwohl ich schon dreiunddreißig war.
Mit der Gastwirtschaft und der Post hatten wir mehr als genug zu tun. Neben der Post hatte ich mich entschlossen, einen Gemischtwarenladen aufzumachen. Wir hatten eine Magd und zwei Knechte angestellt.
Leopoldina hatte sich schnell eingelebt und war ein arbeitsames Weibsbild.
Nach einigen Monaten, als ich mich zur Nachtruhe neben Leopoldina legte, sagte sie: „Gebhard, wir wollen doch Nachfahren haben, damit der ‚Hirschen‘ auch nach unserer Zeit noch weiterbestehen kann.“
Ich war froh, dass es dunkel war und ich so mein Erröten verbergen konnte.
Es war nicht so, dass ich keine Nachfahren wollte, ganz im Gegenteil. Mir wäre es einfach lieber gewesen, wenn das Kinderkriegen auch ohne körperliche Vereinigung hätte zustande kommen können.
Leopoldina hatte recht. Ich musste wohl oder übel meinen ehelichen Pflichten als ihr Mannsbild nachkommen.
Leopoldina sagte mir, dass sie eine Stube voller Kinder wolle.
Doch es dauerte fast drei Jahre, bis unser erstes Kind geboren wurde. Es war eine Tochter und wir tauften sie Paulina.
Seit es die Wälderbahn gab, kamen noch mehr Leute durch Oberlangenegg.
Ich hatte eine Idee und besprach sie mit meinem Bruder Josef.
Wir könnten einen Postkutschendienst machen, der zweimal täglich vom Bahnhof bis nach Krumbach fahren würde. Die Reisenden hätten dadurch weniger Strapazen und es ginge auch viel schneller per Ross und Kutsche als zu Fuß. Gleichzeitig könnte der Postdienst davon profitieren und die Briefe schneller befördern.
Mein Bruder fand diese Idee brillant und wir machten eine Anfrage für die Instandsetzung der Postkutschenlinie zwischen dem Bahnhof Langenegg und Krumbach Dorf.
Wir erhielten die Erlaubnis vom K.-u.-k.-Postamt des Kronlands Vorarlberg.
Diese Postkutschenlinie gab dem Dorf einen richtigen Aufschwung.
Es hieß, dass die „Gretas“, wie man uns auch nannte, immer mit etwas Neuem daherkamen. Gretas war unser Hausname, aber ich weiß nicht, weshalb wir so genannt wurden.
Nach einem Jahr war Leopoldina wieder in froher Erwartung. Sie hatte mich mehrmals daran erinnert, dass drei meiner Geschwister fast gleichzeitig gestorben waren und dass es besser sei, viele Kinder zu haben. Man wisse ja nie, was für Seuchen daherkommen könnten.
1896 kam Maria-Katharina zur Welt. Mich störte es nicht, dass ich keinen Stammhalter hatte. Nur Leopoldina schien es zu wurmen.
Ich sagte zu ihr: „Du wirst schon sehen, meine Töchter werden genauso wichtig wie Männer sein. Ich werde sie zum Studieren schicken.“
„Also, Gebhard, ich weiß, dass du es gerne hast, wenn Modernität ins Dorf kommt. Aber Weibsbilder bleiben nun einmal Weibsbilder. Glaubst du etwa, dass ein Weibsbild der Vorstand sein könnte?“
„Ja, warum nicht? Die Kaiserin ist auch die Königin von Ungarn“, antwortete ich, etwas irritiert über diese engstirnige Einstellung.
Leopoldina erwiderte trocken: „Aber regieren tut schon der Kaiser.“
Ich hatte auch noch einen anderen Bruder, Engelbert. Er wohnte in Krumbach und hatte dort einen Hof. Leider verstarb Engelbert sehr jung und hinterließ drei Kinder. Ich wurde zum Vormund erklärt. Die Witwe Ludwina heiratete wenige Jahre später einen Halder in Dornbirn.
Meine Mündel waren zwischen vierzehn und sechszehn Jahre alt. Oskar und Engelbert waren intelligente und folgsame Buben. Nur mit Peter war es ein Leid. Er war ein trotziger und fauler Bursch. Eine Zeit lang ist er auf das Gymnasium gegangen, aber bald hat er vor lauter Faulheit alles an den Nagel gehängt. Dann arbeitete er in einer Fabrik, aber auch das war ihm zu anstrengend. Er war ständig in irgendwelche Streitigkeiten verwickelt.
Seine Mutter schrieb mir fast wöchentlich, dass ich mich um ihn kümmern sollte. Der Halder wollte natürlich keinen Heller für diesen Faulpelz ausgeben.
Folglich musste ich jede Woche für jedes Mündel drei Gulden Kostgeld zahlen. Aber bei Peter tat ich das nicht, denn laut seiner Mutter saß er nur in Dornbirn auf dem Kanapee. Gleichzeitig flehte mich Ludwina an, ihn zu uns zu nehmen, da der Halder sonst mit ihr schimpfen würde.
Ich wollte Peter aber nicht bei uns haben, auch wenn ich für ihn Arbeit gehabt hätte. Besonders wollte ich nicht, dass er meine Kinder schlecht beeinflusste. Was wäre das nur für ein Beispiel gewesen?
Es gab ein langes Hin und Her zwischen mir und der Mutter. Am Schluss musste das Gericht entscheiden, was mit diesem Mündel getan werden sollte. Ludwina schlug vor, ihn bis zu seiner Volljährigkeit auf die Erziehungsanstalt Jagdberg zu schicken. Mir kam das gelegen.
Ich war gerne bereit, für die anderen zwei Mündel, Engelbert und Oscar, eine Schulbildung zu bezahlen. Sie waren ganz anders als Peter, der nur ein Flegel war.
Auf Oscar war ich sehr stolz. Er war ein richtig intelligenter und feinsinniger Lipburger. 1914 ging er nach Genf, um Chemie zu studieren, und später lebte und arbeitete er in Rom und Genua.
Auch Engelbert hat es nach der Handelsschule zu etwas gebracht. Er fand eine gute Anstellung in Linz.
Nach dem Aufenthalt im Jagdberg verdiente Peter sich sein Taggeld als Maurer. Aber wirklich viel ist nie aus ihm geworden.
Seit die Postkutsche zweimal täglich bei uns Halt machte, florierten unser Gasthaus und die Pension.
Wir brauchten mehrere Mägde und Knechte zum Mithelfen. Leopoldina war zwar gerne Wirtin, aber mit unseren beiden Töchtern Paulina und Maria-Katharina hatte sie alle Hände voll zu tun. Wir hatten auch einen schönen Gastgarten. Die blühenden Rosenstöcke, die den Garten umzäunten, waren der Stolz von meinem Weibsbild.
Mein Bruder Josef kannte als renommierter Medizinalrat viele wichtige Leute. Er erzählte gerne von unserer Gegend und von der Gastwirtschaft, die von uns geführt wurde. Dies nährte meinen Wunsch, den „Hirschen“ auch für die besseren Leute aus der Stadt zu einem Ort zu machen, an dem sie bei uns im Bregenzerwald ausspannen konnten.
Um diese bei uns einzulogieren, brauchte es entsprechenden Komfort und Sauberkeit.
Aus diesem Grunde überzeugte ich Leopoldina, einen Bügelkurs für sich und die Mägde zu machen. Die Weibsbilder lernten, wie man ein Plätteisen benutzte.
Mein Bruder und ich sprachen auch darüber, dass es in unserem Dorf ein Sennhaus geben sollte. Alle Bauern könnten ihre Milch abliefern und diese müsste jeweils gemessen werden. Damit könnte man Käse fabrizieren, der anschließend wieder an die Bauern aufgeteilt werden sollte. Es bräuchte natürlich eine genaue Abrechnung, damit keiner übervorteilt würde.
Die Dörfler waren an dieser neuen Idee sehr interessiert, aber niemand wollte seinen Grund hergeben, um ein Sennhaus darauf bauen zu lassen. Daher entschloss ich mich, den Grund, der neben unserem Gasthaus stand, dem Dorf zur Verfügung zu stellen.
Es gab wieder ein längeres Hin und Her, wer den Bau des Sennhauses bezahlen sollte. Schlussendlich wurde man sich einig, dass die Dörfler, die mitzahlten, vom Gewinn der Milchprodukte zurückbezahlt würden.
Die Jahre vergingen und Leopoldina forderte wieder ein Kind von mir.
Sie sagte: „Gebhard, mit allem, was du an Vergrößerungen vorhast, sind unsere zwei Töchter dem nicht gewachsen.“
So musste ich wohl oder übel wieder meinen Ehepflichten nachkommen, bis mein Weibsbild in anderen Umständen war.
Im Dezember 1900 gebar Leopoldina einen Sohn. Wir tauften ihn auf den Namen Josef-Peter. Leopoldina war sehr davon angetan, dass es jetzt einen Stammhalter gab.
Sie kümmerte sich mit sehr viel Achtsamkeit um unseren Sohn, denn Josef-Peter war ein schmächtiges Kind. Ich fühlte das Bangen meiner Angetrauten, dass unser Bub, wie so viele andere Kinder, nicht das Kindsalter erreichen würde.
Josef-Peter war zwar schmächtig und blieb das auch als Kind, doch er sollte sich wie alle Lipburger zu einem schlanken und hochgewachsenen Mensch entwickeln.
Mein Bruder Josef kam wieder mit einer neuen Idee daher. Er wusste, dass ich ihm immer dazu verhalf, seine Ideen zustande zu bringen. Zumal er für das allgemeine Wohl im Dorf sorgen wollte.
Es hört sich zwar lächerlich an, aber ich tat alles, um auch einmal so renommiert dazustehen wie Josef. In gewisser Weise wetteiferte ich mit meinem Bruder. Natürlich war ich ein angesehener Mann im Dorf, aber Josef war der Studierte, zu dem jeder hochschaute. Keiner hier hatte je einen Titel von unsrem geliebten Kaiser erhalten.
Josef fand, dass ein Armenhaus im Dorf nicht fehlen dürfe. Es gab unter den Dörflern Leute, die hatten niemanden, der nach ihnen schauen konnte, wenn sie alt und gebrechlich waren. Als ich dieses Anliegen dem Vorsteher unterbreitete, war er sofort davon überzeugt. Bald wurde ein Haus in der Parzelle Kuhn gefunden, das einem alleinstehenden und pflegebedürftigen Mannsbild gehörte. Nach kurzen Verhandlungen wurde das Haus zum Armenhaus. Die Idee wurde auch vom Herrn Hochwürden unterstützt und die Kirche steuerte dazu bei, dass man Betten kaufen konnte.
Wer würde für die anderen Kosten aufkommen?
Zwei Barmherzige Schwestern aus einem Kloster in Bludenz übernahmen das Armenhaus.
Josef machte eine Spende. Ich wollte nicht dahinterstehen und tat das Gleiche.
Manchmal hatte ich das Gefühl, dass ich mit meinem Bruder einen versteckten Machtkampf führte. Dies entfremdete mich von mir selbst.
Leopoldina schien nie genügend Kinder zu haben. Sobald sie aus dem Kindbett heraus war, wollte sie schon wieder eines.
Sie sagte immer zu mir: „Gebhard, wir brauchen Kinder zum Arbeiten. Wenn wir einmal alt sind, ist es wichtig, genügend Nachfahren zu haben, um all das, was wir hier haben, weiterzuführen.“
Sie hatte recht, ich hatte es zu etwas gebracht. Ich spürte jedoch immer mehr, was ich zu unterdrücken versuchte.
Leopoldina mit ihrem ständigen Drängen nach noch mehr Kindern war für mich wie ein Plagegeist.
Aber ich wollte sie nicht erzürnen.
1903 kam Margreth zur Welt.
Was mir zum Sinnieren gab, war, dass Leopoldina, die jetzt schon im vierzigsten Lenz stand, immer noch die gleiche Energie hatte. Immer, wenn sie in froher Erwartung war, schien sie wie ein junges Fräulein.
Kurz nach der Geburt von Margreth meinte sie, ein zweiter Bub wäre schon wünschenswert. Man wisse ja nicht, wer bei uns alles studieren würde. Am Schluss sei keiner da, um den „Hirschen“ und die Liegenschaften zu übernehmen. Sie wünsche sich noch ein Kind. Denn bald sei es für sie zu spät zum Kinderkriegen.
1905 gebar Leopoldina unsere Tochter Elisabeth. Ich sagte gleich nach dem Kindbett zu ihr, dass wir jetzt genügend Nachfahren hätten und sie mit ihren fast zweiundvierzig Jahren auch nicht mehr die Jüngste sei.
Paulina und Maria-Katharina gingen schon in die Dorfschule Oberlangenegg und beide waren begeisterte und wissbegierige Mädchen.
Als ich zu Leopoldina sagte, dass ich vorhätte, beide Mädchen nach der Pflichtschule nach Bregenz oder sonst irgendwo im Kronland in eine Klosterschule zu schicken, stieß ich auf Unverständnis.
„Weibsbilder sind doch nicht da, um zu studieren. Was soll das nur? Wenn sie später verheiratet sind, wird ihnen das, bei Gott, nicht weiterhelfen“, meinte Leopoldina vehement.
Sie fuhr fort: „Ich habe auch nichts studiert und du auch nicht sehr viel. Aber wir kommen doch gut mit dem Gastgewerbe und dem Lebensmittelladen zurecht. Obendrauf bis du der k.-u.-k.- Postexpedient von Oberlangenegg, das ist auch nicht jeder hier.“
Was Leopoldina aber nicht verstand und ich ihr auch nicht sagen wollte, war, dass ich gerne studiert hätte und Pfarrer geworden wäre. Ich wollte, dass meine Kinder die Möglichkeit hatten, eine bessere Schulbildung zu erhalten.
In meiner Jugendzeit wurde entschieden, dass Josef studieren konnte, weil er der Älteste war. Man konnte es sich nicht leisten, dass zwei in der Familie studierten. Wir waren schon die besseren Leute im Dorf und darum konnte immerhin ein Bub studieren.
Ich wollte nicht, dass meine Kinder das Gleiche erlebten, selbst wenn sie Weibsbilder waren. Sie konnten ja eigentlich nichts dafür. Sie hatten sich das bei der Geburt sicher nicht aussuchen können.
Meine liebe Urenkelin, heute würde ich sagen, dass ich mein ganzes Leben versucht habe, meinen Bruder Josef zu übertreffen.
Für einen Außenstehenden verstanden sich mein Bruder Josef und ich bestens.
Ich bin mir sicher, dass Josef nie auf die Idee gekommen wäre, dass ich ihm nacheiferte. Dies war auch gar nicht möglich, denn ich war nun einmal kein renommierter Arzt.
Ich tat alles, um auch so angesehen zu sein wie mein illustrer Bruder Josef Lipburger.
Man konnte nicht sagen, dass ich erfolglos war. Ich hatte es zu viel gebracht. Der „Hirschen“, der Gemischtwarenladen und die Post wurden von mir geleitet.
Ich hatte auch eine Tabaktrafik im „Hirschen“ eröffnet. Wir verkauften Tabakwaren, Zeitungen, Fahrscheine für die Postkutsche und Schreibwaren. Es war eine gute Idee von mir gewesen, denn so kamen noch mehr Leute ins Gasthaus und viele setzten sich auch hin, um noch etwas trinken.
Jeder sah in mir eine angesehene Person, die viel für das allgemeine Wohlwollen der Dörfler getan hatte.
Aber in meinem Inneren nagte es täglich. Ich war nun einmal ein typischer Lipburger und sinnierte viel zu viel.
Mein angetrautes Weibsbild Leopoldina war da ganz anders. Sie schien mit dem, was sie hatte, umzugehen, und war mit sich und der Welt zufrieden.
Es hat mich in einen geistigen Abgrund getrieben, dass ich meine eigenen Gefühle und Bedürfnisse nicht ungehindert ausleben konnte.
Täglich versuchte ich, mich wieder aufzuraffen, und ließ mir nichts anmerken.
Als meine älteste Tochter Paulina die Dorfschule absolviert hatte, schickte ich sie nach Bregenz auf die Klosterschule Marienberg. Maria-Katharina tat das Gleiche zwei Jahre später. Beide absolvierten eine Handelsschule.
Leopoldina schüttelte den Kopf und meinte: „Glaubst du, zum Heiraten braucht man eine höhere Schule?“
„Vielleicht will keine von ihnen heiraten oder sie bekommen keinen Mann“, antwortete ich und dachte, dass ich ja auch nicht unbedingt hatte heiraten wollen.
„Nichtwollen ist eines, aber so gute Partien wie unsere Töchter kommen sofort unter die Haube“, bekräftigte mir Leopoldina. „Bei Paulina mach ich mir da gar keine Sorgen. Maria-Katharina muss aufpassen, dass sie nicht zu ‚selbherr‘ wird. Dann will sie am Schluss keiner“, sagte mein Weibsbild mehr zu sich selbst als zu mir. Wahrscheinlich kennst du diesen Ausdruck nicht. Damit meinte Leopoldina, dass unsere Tochter einen zu herrschsüchtigen Charakter hätte. Als Frauenzimmer war dies nicht von Vorteil.
Schon sehr früh ist mir aufgefallen, dass ich nicht wie ein richtiges Mannsbild war. Außer meiner viel zu früh verstorbenen Mutter fand ich kein Weibsbild schön.
Als ich gut über zwanzig war, spürte ich, dass ich Mannsbilder schön fand. Ich mochte ihre starken Körper und ihre männliche Art. Diese fehlte mir bei mir selbst. Ich war ein hochgewachsenes, schlankes Mannsbild. Meine Hände waren fast wie die von einer Frau, ich hatte lange dünne Finger und nichts war wirklich sehr männlich an mir.
Als ich um die zwanzig war, habe ich in einer Truhe die Juppe meiner verstorbenen Mutter gefunden. Ich habe sie mir angezogen und sie passte mir perfekt. In der Juppe hab ich wie ein Weibsbild ausgeschaut.
Als ich zwei Jahre vor meiner Verehelichung in Bregenz war, um dort eine Ausbildung als Postexpeditor zu machen, lernte ich einen um einige Jahre jüngeren Mann kennen. Ich fand ihn sehr anziehend. Dies brachte mich total durcheinander und ich versuchte, mich gegen diese Gefühle zu wehren.
Es war aber nicht möglich und wir trafen uns mehrmals. Dieser Mann, Ferdinand war sein Name, hatte schon Erfahrung mit Mannsbildern gehabt.
Er wohnte in einer kleinen Kammer, nicht weit vom Kloster Mehrerau entfernt. Er sagte, ich solle mit ihm kommen.
Wir trieben Unzucht wider die Natur. Ferdinand sagte, es gebe viel mehr schwule Mannsbilder, als man sich vorstellen könnte. Natürlich redete niemand davon.
Ich war über mich selbst bestürzt. Gebhard Lipburger, der Sohn vom Vorsteher von Langenegg und Bruder vom Dr. Medizinalrat Josef Lipburger, durfte doch nicht schwul sein.
Nach der Erfahrung mit Ferdinand versuchte ich, diese Gefühle zu unterdrücken. Als ich heiratete, sagte ich mir, wenn ich mich mit einem Weibsbild vereine, könnte ich damit sicher auch glücklich sein.
Leider war das nicht der Fall. Ich tat, was ich zu tun hatte, damit die Lipburger-Sippe Nachfahren bekam. Aber ich hatte nie in meinem Leben auch nur die geringste Lust, mich mit meinem Weibsbild zu befriedigen.
Für Jahre bekämpfte ich diese Gefühle in mir. Aber dann kam ein neuer Knecht zu uns, er war ein junges, schlank gewachsenes Mannsbild mit einem dunklen Haarschopf und einem großen Schnurrbart.
Er war nicht aus der Gegend, sondern aus dem Kronland Tirol. Er kam eines Tages in die Wirtsstube und fragte Leopoldina, ob wir einen Knecht brauchten. Sie sagte zu ihm, er solle mit mir reden. Ich war gerade dabei, die Briefe auf dem gegenüberliegenden Postamt zu sortieren.
Als ich ihn sah, wusste ich, dass ich ein Wagnis einginge, wenn ich ihn als Knecht anstellen würde.
Er schaute mir ins Gesicht und seine kohlschwarzen Augen hielten meinem Blick stand. „Die Wirtin hat mir gesagt, dass ich mit Ihnen verhandeln soll. Ich bin zwar nicht von hier, aber ich kenne mich gut im Stall mit dem Vieh und auch den Pferden aus. Arbeitsscheu bin ich auch nicht, und wenn man mir Kost und Unterkunft gibt, bin ich bereit, für vier Gulden in der Woche zu arbeiten. Ich habe auch ein Schreiben von meinem letzten Herren.“
Ich fragte ihn: „Ja, warum bist du denn nicht bei ihm geblieben?“
„Ich will einfach etwas anderes sehen und man hat mir gesagt, im Bregenzerwald gibt es Arbeit“, antwortete er und schaute mich mit dem gleichen feurigen Blick an.
Ich wusste, dass dieses Mannsbild alle meine unterdrückten Gefühle geweckt hatte.
Wir hatten zwar schon zwei Knechte, aber mit dem Postdienst, dem „Hirschen“ und dem Lebensmittelladen konnten wir gut noch jemanden brauchen. Die Wiesen und Wälder gaben auch viel zu tun.
„Ich heiße Josef, aber man nennt mich Peppi“, sagte der dunkelhaarige Fremde. „Ich bin aus Bozen“, fügte er hinzu, obwohl ich ihn nicht gefragt hatte.
„Wenn du bei mir anfangen willst, dann kannst du aber nicht oft heimkehren. Das ist weit weg“, sagte ich zu ihm.
Ich fühlte mich verlegen und traute mich nicht, ihm richtig ins Gesicht zu schauen.
„Das macht nichts, ich hab eh niemanden mehr“, sagte Peppi.
Von diesem Tag an ging mir dieses Mannsbild nicht mehr aus dem Kopf.
Wenn er am Morgen dabei war, die Milch zum Sennhaus hinüberzutragen, und man seine prallen Muskeln unter seinem Hemd sah, wurde mir ganz komisch. Erst jetzt kam mir in den Sinn, dass ich eigentlich gar nicht wusste, wie der Körper von Leopoldina wirklich ausschaute. Ich hatte mit ihr fünf Kinder gezeugt, aber ich hatte sie dabei nie richtig angesehen.
Peppi half überall mit, er war ein arbeitsamer Knecht.
Eines Morgens gab es eine neue Wein- und Bierlieferung und Peppi half mir, die Fässer in den Keller zu bringen. Es war recht düster. Ich spürte seinen warmen Atem ganz in meiner Nähe.
Ich weiß nicht, wie es geschehen ist. Plötzlich spürte ich seinen heißen Körper und seine starken Arme hielten mich fest.
Es gab kein Zurück mehr. Es war, als ob ich mein ganzes Leben nur auf diesen Mann gewartet hätte.
Nach diesem ersten Mal schaute mich Peppi immer etwas herausfordernd an. Nach ein paar Tagen sagte er halblaut zu mir, damit es niemand hören konnte: „Hirschenwirt, wann kommt die nächste Bierlieferung?“
Ich wusste genau, was er damit meinte.
Ich überlegte mir fieberhaft, was ich mir einfallen lassen könnte, um mit Peppi alleine eine Arbeit erledigen könnte.
Es war am Ende des Sommers und ich sagte zu ihm: „Heute Nachmittag kommst du mit mir, um zu schauen, welche Tannen im Wald gefällt werden können. Wir brauchen Brennholz für den kommenden Winter.“
Ich fand immer wieder neue Arbeiten, die ich mit dem Knecht machen konnte.
Leopoldina fragte mich nach einiger Zeit: „Was hast du denn immer mit dem neuen Knecht? Man könnte meinen, dass nur er was vom Arbeiten versteht.“
„Ich muss ihn halt zuerst etwas einarbeiten, damit er nachher allein weiß, was er zu tun hat“, log ich meine Angetraute an. Ich weiß nicht, ob Leopoldina bemerkte, wie es mir die Schamesröte ins Gesicht trieb.
Gleichzeitig fühlte ich mich schlecht. Ich war der Hirschenwirt, Vater von fünf Kindern und trieb Unzucht wider die Natur mit meinem Knecht.
Ich traute mich nicht einmal, zur Beichte zu gehen. Der Herr Hochwürden kannte mich als guter Katholik. Um beim Herrgott Abbitte zu leisten, entschloss ich mich, für die Kirche zu spenden. Ich ging zum Herrn Hochwürden und sagte, dass ich gerne eine Spende in Form einer Statue oder eines Kreuzes machen würde. Der Herr Hochwürden schien von meinem Vorschlag dankend angetan. Er würde sich mit einem Holzschnitzer im Kronland Tirol in Verbindung setzen.
Mir fiel natürlich gleich Peppi ein, er war ja auch aus dem Kronland Tirol.
Der Herr Hochwürden schlug vor, dass ein Holzkreuz beim Seitenaltar unser Gotteshaus sicher noch verschönern würde.
Ich stimmte ihm zu und sagte, er müsse mir nur mitteilen, wie viel das kosten würde.
Der Geistliche bedankte sich bei mir und gab mir seinen Segen, bevor ich den Pfarrhof wieder verließ.
Ich fühlte mich nicht wie ein besserer Christ, ganz im Gegenteil. Es war, als ob ich mich von meiner Schuld freikaufen wollte.
Liebe Ruth-Maria, ich erzähle dir dies alles, denn ich weiß, zu deiner Zeit wäre es sicher einfacher gewesen.
Vor hundert Jahren war dies in einem Dorf im Bregenzerwald einfach undenkbar. Ich wusste, wenn irgendetwas jäh auffliegen würde, wäre unsere ganze Sippe zerstört. Es war undenkbar, dass der Hirschenwirt, ein verheiratetes Mannsbild mit fünf Kindern, ein Warmer war.
Ich vernachlässigte meine Arbeit als Postexpeditor, denn ich fand immer wieder eine Ausrede, um mit Peppi irgendwo allein zu sein.
Paulina und Maria-Katharina hatten die Handelsschule in Marienberg beendet und ich führte die beiden in die Abwicklung des Postdienstes ein, um mich regelmäßig zu vertreten.
Im Juni 1914 wurde an alle Postämter telegrafiert. Es wurde kundgegeben, dass der Erzherzog Franz-Ferdinand und seine Gemahlin in Sarajevo ermordet worden waren.
Einige Zeit später brach der Krieg aus. Viele junge Leute mussten an die verschiedenen Fronten, um für den Kaiser zu kämpfen.
Bei uns spürte man den Krieg nicht besonders, da keine Frontlinien durch das Kronland Vorarlberg liefen.
Abgesehen davon, dass es weniger Durchreisende gab, bekamen wir von den grauenhaften Schlachten nichts mit.
Regelmäßig berichteten Briefe an die Angehörigen, dass wieder ein junges Mannsbild für den Kaiser und das Kaiserreich gefallen sei.
Manchmal kam auch der eine oder andere zurück. Es fehlte ihm ein Bein oder ein Arm und er konnte nicht mehr weiterkämpfen.
Wenn diese Mannsbilder dann am Wirtshaustisch von den blutigen und unbarmherzigen Kämpfen erzählten, waren alle Anwesenden still. Jeder schien dankbar dafür, entweder zu alt oder zu jung zu sein, um einen Einrückbefehl zu bekommen.
Die Jahre vergingen und der Krieg zog sich hin. Es gab fast keine jungen Männer mehr im Dorf.
Das Kreuz für den Seitenaltar wurde trotz des Krieges geliefert und es gab eine Einweihung am ersten Adventssonntag 1916.
Peppi machte sich über mich lustig und fragte mich ganz unverblümt: „Glaubst du, dass du besser dastehst, wenn du dem Herrgott ein Kreuz spendierst?“
Peppi wusste, dass ich um meinen Ruf bangte, und mehrmals sagte er: „Was würdest du tun, wenn ich ein Blatt an die Kirchentüre nageln würde und die Leute draufkommen würden, was der Hirschenwirt für Geschichten macht mit seinem Knecht?“
Mir stieg jedes Mal der Schweiß hoch bei solchen Bemerkungen.
„Halt’s Maul, Peppi, sonst kannst du dich gleich anderswo verdingen“, antwortete ich einmal.
„Oh, der saubere Hirschenwirt sollte nicht so mit mir reden“, antworte Peppi hämisch. „Gib mir einen Gulden und ich halt’s Maul“, sagte er und schaute mich rotzig an.
So fing dieser Handel an. Peppi drohte, die Katze aus dem Sack zu lassen, wenn ich ihm kein Geld gab.
So musste ich jetzt regelmäßig Geld geben, denn seine Drohungen wurden immer dringlicher.
Wegschicken konnte ich ihn nicht, denn wie er mir schon gedroht hatte, würde dann alles ans Tageslicht kommen.
Ich hoffte, dass er vielleicht von alleine gehen würde. Aber er machte keine Anstalten, wieder ins Kronland Tirol zurückzuwollen.
Ich versuchte, ihm aus dem Weg zu gehen. Oft passte er mich ab und lachte hämisch über mein Zusammenzucken, wenn er auf einmal ganz unerwartet alleine neben mir stand. Er sagte dann: „Na, Hirschenwirt, gefalle ich dir jetzt nicht mehr? Wir hatten doch eine rechte Freude miteinander. Vorher wolltest du immer mit mir allein sein und jetzt tust du, als ob ich nicht mehr da wäre.“
Ich sagte gequält: „Peppi, höre auf mit dieser Rederei. Es wird sonst ein schlechtes Ende nehmen. Ich habe eine Familie zu ernähren und ich habe sicher Falsches getan.“
„Ach, der Hirschenwirt will sich wieder reinwaschen“, sagte er mit rotziger Miene.
Jede Woche gab ich ihm neben seinem Taglohn Extrageld, damit er schwieg.
Peppi war nun schon für zwei Jahre als Knecht im Hirschen.
Mein Leben war zur Hölle geworden. War dies die Strafe, die mir der Herrgott schickte, weil ich mich wider die Natur benommen hatte?
Ich wusste weder ein noch aus. Täglich erwartete ich, dass Peppi irgendein Gerücht aufkommen lassen würde.
Ich lag oft nächtelang wach und auch tagsüber konnte ich mich nicht von meinen Ängsten befreien.
Leopoldina war kein Weibsbild, das sich schnell Sorgen machte, aber eines Morgens schaute sie mich streng an und meinte: „Gebhard, was ist mit dir eigentlich los? Du schaust schon zu lange aus, als ob du krank wärst. Geh zu deinem Bruder, er soll dich untersuchen.“
„Ich weiß auch nicht, vielleicht komme ich in die Jahre. Meine Mutter ist ja auch früh gestorben“, wich ich ihrer Frage aus.
Ja, die einfachste Lösung wäre zu sterben, dachte ich mir.
Peppi wollte immer mehr Geld und seine Drohungen wurden immer dringlicher.
Ich war auf dem Postamt, um noch das Postwesen vor dem Sonntag zu erledigen, und in meine Zahlen vertieft, als auf einmal Peppi vor mir stand.
„Hirschenwirt, am Sonntag wird es an der Kirchentür zu lesen sein, was für ein schwuler Sauhund du bist“, sagte er höhnisch.
Ich zuckte zusammen. Ich hoffte, dass ja niemand anderer jetzt hereinkommen würde.
„Peppi, bitte höre damit auf“, flüsterte ich. „Ich zahle dir die Reise, wenn du aus meinen Diensten trittst. Auch einen Extralohn gebe ich dir.“
„Vergiss das, Hirschenwirt, du denkst, du kannst mich wohl immer kaufen“, antwortete er und lachte mich maliziös an.
Die Tür vom Postamt öffnete sich und Paulina kam herein.
Peppi drehte sich um und sagte über die Schulter: „Morgen ist ein großer Tag, Hirschenwirt.“ Dann war er auch schon wieder draußen.
Ich konnte ihm jetzt natürlich nicht nachrennen, denn Paulina stand ja vor mir.
Sie schaute mich etwas verwundert an und sagte: „Was meint denn der Peppi damit, Däta?“
„Ach, nichts Besonderes“, antwortete ich ihr.
„Ich wollte wissen, ob die Wochenabrechnung stimmt, da ich diese Woche ja fast alleine hier auf dem Postamt gearbeitet habe“, fragte mich Paulina.
„Es scheint alles in Ordnung zu sein“, sagte ich zu ihr. Meine Gedanken waren jedoch ganz woanders.
Wie konnte ich diese Schande abwenden? Ich stellte mir vor, wie meine leibeigenen Kinder erfahren würden, dass ihr Vater ein Warmer war.
Nein, diese Schande wollte ich nicht miterleben. Was konnte ich nur tun?
Als Paulina wieder gegangen war, schloss ich das Postamt zu und schaute, ob ich Peppi irgendwo finden würde.
Aber er schien wie vom Erdboden verschluckt.
Wollte er mich nur triezen?
Ich verwarf diese Idee jedoch schnell. Denn Peppi schien seine Drohungen, die er mir nun schon so lange machte, immer ernster zu meinen.
Was sollte ich tun? Ich war total ratlos, und umso mehr ich sinnierte, umso mehr wusste ich, dass er es dieses Mal ernst meinte.
Ich fragte mich, ob er vielleicht schon dabei war, etwas an die Kirchentür zu plakatieren. Ich wollte auf Nummer sicher gehen.
Kurzentschlossen ging ich zum Gotteshaus. Es war nichts zu sehen. Also besuchte ich das Grab meines Vaters und meiner Mutter.
Ich konnte nicht einmal beten. Wofür sollte ich beten? Ich war ein Sünder, aber beichten konnte ich auch nicht gehen. Es wäre für mich undenkbar gewesen, meine Unzucht wider die Natur dem Herrn Hochwürden zu beichten. Nur die Idee, dass er es wüsste, war für mich schon angsteinflößend.
Als ich wieder zu Hause war, suchte ich gleich nach Peppi. Aber er war immer noch unauffindbar. Ich fragte Leopoldina und die Kinder. Aber niemand hatte ihn gesehen.
Leopoldina fragte mich: „Was hast du denn so Dringendes zu tun für ihn?“
„Ich wollte, dass er das Pferdegeschirr putzt“, sagte ich, denn es fiel mir nichts anderes ein.
„Aber das wurde doch vor zwei Tagen schon gemacht“, sagte mein Weibsbild und schaute mich kopfschüttelnd an.
Den ganzen Abend war ich am Wirten. Als dann endlich der letzte Gast die Stube verlassen hatte, schaute ich, ob Peppi in seiner Kammer war.
Aber auch dort war er nicht auffindbar.
Ich ging nochmals zum Gotteshaus. Es war nichts zu sehen. Bis jetzt hatte Peppi seine Drohung noch nicht wahr gemacht.
Nein, ich wollte diese Schande nicht miterleben.
Hätte ich doch Priester werden können, dann wäre dies alles sicher nicht passiert.
Warum war ich auf solche Abwege gekommen? Ich war dabei, das Leben meiner Angetrauten und das meiner Nachfahren zu zerstören.
Alles schien ausweglos. Ich wusste, dass ich feige war. Wenn morgen alles aufflog, wollte ich den Blick meiner Kinder nicht ertragen.
Ich öffnete die Türe zum Speicher, der sich über dem Postamt und dem Gemüseladen befand. Mein Herz pochte, als ich die Stiege hochging. Sobald sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, suchte ich nach einem Strick. Ich nahm die Leiter, die ebenfalls dort verstaut war, stieg hinauf und befestigte den Strick am Balken. Danach knotete ich ihn mir um den Hals. Ich wusste, wenn ich von der Leiter spränge, würde ich stranguliert werden.
Für mich gab es jetzt kein Zurück mehr.
Liebe Kindeskind meiner lieben Tochter Paulina, ich bitte dich und all meine Nachfahren auf das Innigste, mir meine Schwäche zu verzeihen.
Mit dieser Tat habe ich sicher viel Leid ausgelöst, denn all meine Nachfahren, auch über Generationen, haben dieses Trauma in sich.
Der Verlust meines Selbst hat mich dazu gebracht, diese Geste zu vollziehen.
Darum bitte ich dich und all meine Nachfahren, euer Selbst nicht zu verleugnen. Verleugnung führt zu Selbsthass.
Er ist überall dort zu finden, wo Gehorsam Kinder dazu zwingt, sich selbst und ihr Erleben zu verleugnen.
Ich wollte der Lipburger-Sippe treu sein. Ich habe mich anders gegeben, als ich war, nur um den guten Ruf dieser Familie zu bewahren.
Lebe dein Leben, auch wenn es unkonventionell ist. Es ist dein Leben und niemand soll dir befehlen, wie du es leben sollst.
Ich weiß, liebste Ruth-Maria, es braucht viel Courage, aber es gab auch starke Menschen in unserer Sippe, die nicht von ihrer wirklichen Persönlichkeit abgekommen sind.
Bleibe stark und verbinde dich mit den unverfälschten Menschen.
Ich danke dir auf das Innigste, dass ich durch dich die Möglichkeit bekommen habe, die Wahrheit zu beleuchten. Mein Geist wurde dadurch befreit.
In tiefster Verbundenheit.
Dein Urgroßvater,
Gebhard Lipburger
Leopoldina Lipburger, geborene Fuchs
(* 16.11.1863 in Langenegg, † 07.12.1942 ebenda)
Liebe Urgroßmutter Leopoldina,
mir scheint, du bist von einem Schleier verhüllt.
Nach längerem Suchen habe ich immerhin eine Bemerkung über dich in einem Brief deiner Tochter Maria-Katharina entdeckt.
Ich habe auch einige sehr vergilbte Fotos von dir gefunden, die vor einem eurer Häuser gemacht wurden. Du stehst zwischen deinem Sohn Josef-Peter und deiner Tochter Margreth. Ich schätze, dass du so um die sechzig bist. Du trägst die typische Bregenzerwälder Tracht. Deine Arme sind vor der Brust verschränkt und du stehst breitbeinig zwischen zwei deiner schon erwachsenen Kinder. Dein Blick scheint mir etwas grimmig, als ob du der Welt sagen möchtest, dass dich nichts aus der Bahn schmeißen kann. Man sieht dir an, dass du mit beiden Beinen auf dem Boden stehst und nicht viel für Firlefanz übrig hast.
Auf dem anderen Foto sitzt du vor dem Haus auf einem Stuhl und trägst wieder die Bregenzerwälder Tracht, diesmal mit einer sehr schönen Schürze. Neben dir steht deine Tochter Elisabeth, besser unter Liseth oder Elisa bekannt, sowie dein Sohn Josef-Peter. Ich schätze, dass es sich bei dem Mädchen, das neben dir steht und um die fünf Jahre alt ist, um eine deiner Enkelinnen Maria oder Herma handelt. Sie hat ihre Hand auf deinem Schoß und schmiegt sich an dich. Auf diesem Bild schaust du nicht so finster drein, aber man sieht dir die Autorität an. Was mir besonders aufgefallen ist, sind jedoch deine beiden Kinder und deine Enkelin. Sie waren für die damalige Zeit äußerst modern angezogen und sahen aus, als ob sie in einer großen Stadt wie Wien oder Linz wohnten.
Dein Name bedeutet die Kühne, die Mutige. Ich finde, wenn ich diese Fotos anschaue, dass er sehr passend ist. Du schaust aus, als ob dich nichts ängstigen könnte.
Aber sonst scheinst du nicht zu existieren, obwohl du deinen Gatten um fünfundzwanzig Jahre überlebt hast.
Du hast sogar einen Teil des Zweiten Weltkriegs miterlebt. Niemand sprach je von dir.
Auch mein Vater, meine Tante und mein Onkel müssten dich bestens gekannt haben. Es wurde nie ein Wort über dich verlautet. Wie kommt das?
Deine Tochter Maria-Katharina, oder Tante Mikle, wie wir sie nannten, sagte immer, wenn sie mit ihrer Schwester Elisabeth stritt, mit einer gewissen Verächtlichkeit: „Du falsche Füchsin.“
Ich hatte natürlich nicht den blassesten Schimmer, was sie damit meinte. Niemand klärte mich darüber auf.
Erst jetzt ist mir aufgefallen, dass dein Mädchenname Fuchs ist.
Wie war dein Verhältnis zu deinen Kindern und deinen Enkeln?
Ich kann mir vorstellen, dass es als Witwe nicht einfach war, sich alleine durchzusetzen. Wie bist du mit dem plötzlichen Tod deines Angetrauten umgegangen?
Liebe Urgroßmutter, ich möchte dich wirklich besser verstehen, denn auch du bist ein Teil von mir. Bitte hilf mir, diesen mysteriösen Anteil von mir aufzudecken.
Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Antwort.
Akzeptiere meine respektvollen Grüße.
Deine Urenkelin
Ruth-Maria
***
Habe die Ehre, Kindeskind meiner Tochter Paulina,
ich glaube, du bist dir selbst schon darüber im Klaren und vielleicht ist es gar nicht nötig, das Folgende noch zu erwähnen:
Du hast eine sehr große Ähnlichkeit mit meiner Tochter Mikle. Aus diesem Grunde überrascht mich dein Brief nicht besonders. Sie wollte auch immer alles auf das Genauste wissen und ständig allen Angelegenheiten auf den Grund gehen. Man konnte sie nicht hinters Licht führen.
Du scheinst eine waschechte Lipburgerin zu sein. Einfach ist dieser Charakter jedoch nicht. Wenn du dessen Schwächen jedoch kennst, kann es dich sicher sehr stark machen.
Da ich nur hineingeheiratet habe, waren die Lipburgerischen für mich immer etwas fremd in ihrer Denkweise.
Du hast es richtig analysiert. Über mich sprach und spricht man nur ungern in der Verwandtschaft.
Meine Enkelin, die deine geliebte Tante ist, könnte dir von mir erzählen, aber sie will es um alles in der Welt nicht.
Um ehrlich zu sein, ich hätte dir von meinem irdischen Leben auch nichts erzählt.
Jetzt bin froh, dass du mit diesen ganzen Geschichten ins Reine kommen willst. Ich gratuliere dir zu deinem Mut.
Wo soll ich anfangen, liebe Ruth-Maria?
Bis zu meiner Verehelichung mit deinem Urgroßvater Gebhard verlief alles normal in meinem Leben. Ich habe für die damalige Zeit verhältnismäßig spät geheiratet.
Dein Urgroßvater suchte eine Frau, die ihm beim Wirten unter die Arme greifen konnte. Mein Angetrauter war ein sehr spezielles Mannsbild, er war einfach nicht wie die anderen Leute im Dorf. Aber er war eben ein Lipburger, die dachten ganz anders als die Normalsterblichen. Sie waren „großkopferte“ Leute. So sagte man das damals. Sie waren ständig beim Überlegen. Ich habe das Gefühl, auch du bist so eine.
Zusammen mit seinem Bruder, dem Medizinalrat, wollte er immer die Modernität in den Bregenzerwald bringen.
Dein Urgroßvater war kein Süßholzraspler. Die Weibersleut interessierten ihn gar nicht. Er hat mich geheiratet, weil er eine Wirtin brauchte.
Seinem Bruder ist es ja auch nie in den Sinn gekommen, zu heiraten. Diese Art von Menschen ist einfach nicht dafür geschaffen.
Gebhard legte sich auch nur zu mir, um Kinder zu zeugen. Er gehörte nicht zu jenen Männern, wie der Angetraute meiner armen Tochter Paulina einer war.
Vor unserer Hochzeit hat Gebhard sofort einen Vertrag bei einem Notar gemacht. Er wollte festlegen, wer den „Hirschen“ erben würde, falls unsere Eheschließung kinderlos bliebe.
Ich war etwas vor den Kopf gestoßen. Wem wäre so etwas gleich vor der Trauung eingefallen? Das war wieder typisch für die Lipburger. Alles war bis ins Kleinste überlegt.
Zwischen 1994 und 1905 gebar ich vier Töchter und einen Sohn.
Nach diesen fünf Geburten hat mich Gebhard nie wieder berührt. Er war auch nicht enttäuscht, dass er nur einen Sohn hatte.
Für ihn gab es keinen Unterschied zwischen seinen Töchtern und seinem Sohn. Im Gegenteil, er wollte, dass unsere Töchter den gleichen Wert wie unser Sohn Josef-Peter hatten.
Mir kam dies wirklich etwas seltsam vor. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass mir ein Mann vorlebte, dass Weibsbilder den gleichen Wert wie Mannsbilder hatten.
Ich war nicht so großgezogen worden. Meine Mutter hatte mir immer beigebracht, dass wir Weibersleut weniger wert seien und die Mannsbilder für uns entschieden.
Nach meiner Eheschließung mit Gebhard entdeckte ich eine ganz andere Lebenseinstellung bei meinem Angetrauten.
Er sah mich als seinen Sozius. Ich hatte anfänglich alle Mühe, mich daran zu gewöhnen. Er gab mir freie Hand bei vielen Entscheidungen oder fragte mich nach meiner Meinung, wenn es um einen Beschluss ging.
Später war ich ihm dankbar dafür. Sonst hätte ich sicher viel mehr Mühe dabei gehabt, mich als Witwe durchzusetzen.
Als unsere älteste Tochter Paulina die Pflichtschule absolviert hatte, gab es für Gebhard keinen Zweifel, dass sie nach Bregenz in die Klosterschule Marienberg gehen sollte, um eine Handelsschule zu absolvieren. Mikle folgte diesem Wege ein Jahr später. Im Dorf war es wirklich sehr ungewöhnlich, dass man Frauen zu einer höheren Schulbildung schickte.
Ich war mir nicht sicher, ob dies wirklich eine gute Idee war. Sonst wären sie bestimmt nicht so selbherr geworden. Vielleicht wäre auch das Leben deiner Großmutter anders verlaufen, wenn sie weniger gelernt hätte.
Mikle wäre vielleicht sogar unter die Haube gekommen, obwohl ich da meine Zweifel habe. Denn auch ohne Schule wäre ihre selbstsicherere Persönlichkeit jedem Mannsbild zu viel gewesen.
Ich war immer etwas hin- und hergerissen zwischen den sehr neuzeitlichen Einstellungen meines Angetrauten und der mir anerzogenen Einstellung als Bregenzerwälderin.
Um ganz ehrlich zu sein, ich hatte mir einen Ehebund anders vorgestellt. Ich hätte sicher mit Gebhard drüber reden können, denn er debattierte so oder so gerne über alle möglichen Sachen. Besonders mit seinem Bruder, dem Medizinalrat. Ich saß oft dabei und schüttelte den Kopf über ihre Diskurse, die für mich weder Hand noch Fuß hatten. Auch Paulina und Mikle taten das später fürs Leben gerne und irgendwie fand ich dies fast gefährlich. Später nannte man meine Töchter die verrückten Hirschenwirtweiber. Die beiden Ältesten, Paulina und Maria-Katharina, waren sicher sehr von ihrem Vater und der Lipburger-Sippe beeinflusst.
Bei den drei Jüngeren spürte man das weniger, denn sie waren noch Kinder, als ihr Vater starb.
Mein Angetrauter hatte nicht die gleiche Art wie die anderen Mannsbilder im Dorf. Er war in gewisser Weise fast wie ein Weibsbild. Sie schienen ihn nicht das Geringste zu interessieren.
Sein Bruder, der Medizinalrat, war ihm da sehr ähnlich. Bei ihm fand ich das irgendwie normal, denn er war ein wirklich sehr studierter Mann. Es wär mir nie in den Sinn gekommen, dass jemand wie er eine Familie haben könnte.
Gebhard war jemand, der ständig neue Ideen hatte, um unserem Dorf und den Dorfbewohnern das Leben zu erleichtern.
Vieles tüftelte er mit seinem Bruder, dem Medizinalrat, aus. Ich glaube, er wollte aus uns eine Art noble, um nicht zu sagen adlige Familie von Oberlangenegg machen. Sein Vater war ja für längere Jahre der Vorsteher des Dorfs gewesen.
Ich fragte mich öfters, ob Gebhard das nicht auch noch tun wollte. Er war ständig dabei, neue Ideen umzusetzen.