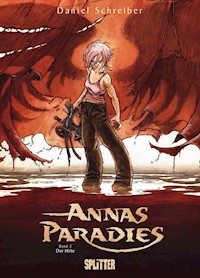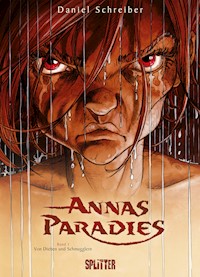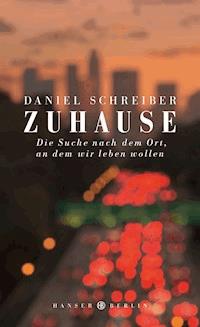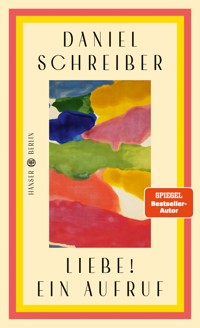
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein persönlicher Aufruf des Bestsellerautors Daniel Schreiber zum aktiven Widerstand gegen eine Kultur des Hasses. Ohnmacht ist zum politischen Grundgefühl unserer Zeit geworden. Eine Rhetorik des Hasses und der Menschenverachtung hat den politischen Diskurs gekapert. Unser Zusammenleben ist wieder von mehr Gewalt geprägt. Kein Wunder, dass sich immer mehr Menschen vom Glauben an politisches Handeln verabschieden und ins Private zurückziehen. Dabei wissen wir genau, dass es gerade jetzt auf aktiven Widerstand ankommt, auf gemeinschaftliches Handeln. Doch wie kann es gelingen, zu einer politischen Haltung zu finden, die dem sich ausbreitenden Klima des Hasses etwas entgegenzusetzen vermag? In seinem neuen Buch zeigt Daniel Schreiber einen radikalen Weg auf: Die Rückbesinnung auf eine Idee der Liebe als politische Kraft. Anhand politischer, philosophischer und sozialhistorischer Beispiele zeigt er, dass diese Vorstellung die größten politischen Revolutionen angestoßen hat. Ein Buch über Widerstand und Trost – und das Wiederfinden einer eigenen politischen Stimme.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Ein persönlicher Aufruf des Bestsellerautors Daniel Schreiber zum aktiven Widerstand gegen eine Kultur des Hasses.Ohnmacht ist zum politischen Grundgefühl unserer Zeit geworden. Eine Rhetorik des Hasses und der Menschenverachtung hat den politischen Diskurs gekapert. Unser Zusammenleben ist wieder von mehr Gewalt geprägt. Kein Wunder, dass sich immer mehr Menschen vom Glauben an politisches Handeln verabschieden und ins Private zurückziehen. Dabei wissen wir genau, dass es gerade jetzt auf aktiven Widerstand ankommt, auf gemeinschaftliches Handeln. Doch wie kann es gelingen, zu einer politischen Haltung zu finden, die dem sich ausbreitenden Klima des Hasses etwas entgegenzusetzen vermag? In seinem neuen Buch zeigt Daniel Schreiber einen radikalen Weg auf: Die Rückbesinnung auf eine Idee der Liebe als politische Kraft. Anhand politischer, philosophischer und sozialhistorischer Beispiele zeigt er, dass diese Vorstellung die größten politischen Revolutionen angestoßen hat. Ein Buch über Widerstand und Trost — und das Wiederfinden einer eigenen politischen Stimme.
Daniel Schreiber
Liebe!
Ein Aufruf
Hanser Berlin
I
Ein Schritt nach dem anderen. Ein Atemzug nach dem anderen. Über mir schloss sich das immer noch helle Grün der frühsommerlichen Buchen zu einem lockeren Blätterdach, der Waldweg, den ich schon oft genommen hatte, war in das sanfte Spiel des Lichts getaucht. Von allen Zeiten des Jahres ist mir diese am liebsten. Das klare Licht, die vollen Farben, die Exaltation der Natur, die wie in einem Rausch zu voller Pracht erwacht und über sich hinauszuwachsen scheint. Das Versprechen eines langen Sommers. Gerade war ich im Seminarhaus in der hügeligen Landschaft der Mitte des Landes angekommen, wo ich seit einigen Jahren meine Schreibworkshops gebe, und wie immer zu einem Spaziergang aufgebrochen, um noch einmal durchzuatmen, mich noch einmal zu bewegen. Um ein Gefühl für meinen Körper zu bekommen, nach den Stunden im Zug und vor den Stunden der ersten Sitzung. Um die Welt meines Alltags hinter mir zu lassen.
Ich habe dieses Waldgebiet in den vergangenen Jahren zu allen Jahreszeiten kennengelernt. Im Spätherbst und im Winter bringe ich immer meine Wanderschuhe mit, um gut über die feuchten Wege oder durch den Schnee zu kommen. Im Frühjahr lässt sich das Wiedererwachen der Welt beobachten und ich zerreibe Waldmeisterblätter zwischen meinen Fingern, weil ich nicht genug von ihrem Duft bekommen kann, den es nur ein paar Wochen im Jahr gibt. Im Frühsommer bewundere ich, wie sich Roter Fingerhut mit seinen violett-weißen Blüten auf den Lichtungen des Waldes ausbreitet, pflücke ein paar Walderdbeeren, nehme mir vor, sie im Hotel zu waschen, und esse sie dann trotzdem schon unterwegs auf. Im Spätsommer und im Herbst ist der Wald voller Pilze, wie ich eines Tages feststellte, als ich auf einen Steinpilz nach dem anderen und Unmengen schwarzer Herbsttrompeten stieß und diese in meiner Jacke sammelte, um sie dem Koch des Seminarhauses mitzubringen. Manchmal taucht in sicherer Entfernung ein Reh auf und springt erschrocken davon, wenn es mich sieht oder mit seiner feinen Nase wittert. Einmal sah ich einige Meter vor mir etwas Rotgoldenes zwischen den Baumstämmen aufblitzen. Es zog mich unweigerlich in seinen Bann, bis ich erkannte, dass es sich um ein Stück Rotwild handelte, das mich zu spät bemerkt hatte und nun mit großen, eleganten Sprüngen das Weite suchte.
Schon seit meiner frühen Kindheit mache ich solche Spaziergänge, wenn auch nicht immer in einer so schönen Umgebung wie dieser Mittelgebirgslandschaft mit ihrem dichten Baumbestand, den gelegentlichen Gesteinsbrocken, ihren sich jahreszeitlich wandelnden Kräutern, Blumen und Sträuchern. Ich gehe durch den Park bei mir zuhause in Berlin und, wenn ich auf Lesereisen bin, am Mainufer, an der Alster oder im Englischen Garten spazieren. Ich versuche, zweimal die Woche joggen zu gehen, egal, wo ich bin, was mir nicht immer gelingt. Seit ein paar Jahren gehe ich wandern, wann und wo ich kann, allein oder zu zweit, in Bayern und Brandenburg, Österreich und der Schweiz, auf Mallorca oder den Kanarischen Inseln. Nur wenig gibt mir so sehr das Gefühl, in der Welt zuhause zu sein.
Auch jetzt stellte sich wieder dieses mir so vertraute Gefühl des Staunens ein, als ich die Stimmen der Vögel und das Rauschen der Baumwipfel wahrnahm. Im Stillen benannte ich unwillkürlich die verschiedenen Pflanzen, die ich sah, ein Überbleibsel kindlicher Versuche, mir ihre Namen einzuprägen. Von irgendwoher wehte der Wind einen Hauch Holunderblütenduft herüber, ich zog meine Jacke aus, weil mir warm geworden war, und nahm sie in die Hand. Ich bin nicht immer empfänglich für dieses Gefühl, doch auch wenn ich es nicht erfahre, sorgt schon das besänftigende Grün um mich herum dafür, dass sich mein Nervensystem beruhigt. An jenem Tag nahm es mich ein, dieses fast kindliche Gefühl der Ehrfurcht vor der großen, nicht verstehbaren und manchmal überwältigenden Natur, und ich begann mich zu entspannen.
Ich genoss die Stunde, die ich noch hatte, bevor ich ins Hotel zurückkehren würde, um die Teilnehmenden des Workshops zu begrüßen. Doch während ich weiter durch den Wald ging, trat auch etwas anderes wieder in mein Bewusstsein. In den vergangenen Monaten hatte sich immer häufiger eine Einsicht eingestellt, die ich fast körperlich spürte, eine Einsicht, die ich versuchte von mir fernzuhalten, obwohl mir das nur noch selten gelang. Sie gehörte zu jenen Dingen in meinem Leben, von denen ich eigentlich so wenig wie möglich wissen wollte. Auch jetzt wehrte ich mich dagegen. Am besten ließ sich diese Einsicht als eine umfassende Desillusionierung beschreiben. Ich fühlte mich in der Gesellschaft, in der ich lebte, immer weniger zuhause. Die Nachrichtenlage ließ mich jeden Tag von Neuem bestürzt zurück, fassungslos und traurig. Mir war die Fähigkeit abhandengekommen, die Welt zu lieben. Und ich wusste nicht, wie ich den damit einhergehenden Gefühlen von Ohnmacht und Lähmung begegnen konnte.
*
Ein paar Wochen zuvor war ich bei der Lektüre von Hannah Arendts Denktagebuch auf einen kurzen Eintrag gestoßen, der eine ähnliche Einsicht zum Ausdruck zu bringen schien. Er bestand aus einer einzigen Frage: »Amor Mundi — warum ist es so schwer, die Welt zu lieben?«1 Die Philosophin selbst hatte ihr Arbeitsjournal, das sie zwischen 1950 und 1973 führte, nicht Denktagebuch genannt, doch es war genau das: eine Sammlung täglicher, häufig philosophischer Gedanken. Diese waren weniger von persönlichen Reflexionen geleitet, als dass sie rohe Bausteine für spätere Publikationen bildeten, für Aufsätze und Bücher, die sie veröffentlichen würde, aber auch welche, die nie entstanden und die sie vielleicht geschrieben hätte, wenn ihr ein längeres Leben beschieden gewesen wäre.
Am meisten faszinierten mich darin die wiederkehrenden Aufzeichnungen zum Wesen der Liebe und ihrer möglichen politischen Kraft.2 Liebe und speziell die Liebe zur Welt waren Themen, mit denen sich Hannah Arendt zeit ihres Lebens auseinandersetzte. Dabei entstanden Überlegungen und Gedankengänge, die aufeinander aufbauten und sich komplettierten, sich aber auch widersprachen. Immer wieder betrachtete sie diese Themen aus verschiedenen Perspektiven. Gleich in ihrem ersten Buch, ihrer Dissertation, hatte sich Arendt mit dem Liebesbegriff bei Augustinus auseinandergesetzt und die Frage erörtert, ob dessen Verständnis von Nächstenliebe Gemeinschaft stiften kann.3 Während sie in einem Aufsatz zur Politik die Welt als ein Produkt des menschlichen amor mundi, der Liebe des Menschen zur Welt, beschrieb und damit die Fürsorge für nachfolgende Generationen ins Zentrum politischen Handelns rückte4, machte sie in ihrem Hauptwerk Vita activa oder Vom tätigen Leben unmissverständlich klar, dass ihr »alle Versuche, die Welt durch Liebe zu ändern oder zu retten, als hoffnungslos verlogen« erschienen.5 Trotz dieser vehement geäußerten These wollte sie jedoch gerade diese Abhandlung lange Amor Mundi nennen, wie sie 1955 in einem Brief an ihren Lehrer und Freund Karl Jaspers erwähnte.6
Von der Liebe und der Liebe zur Welt schien für Arendt eine grundlegende politische Kraft auszugehen, doch dieser Kraft begegnete sie mit großer Skepsis.7 Wie bei einigen der faszinierendsten Begriffe ihres Denkens waren ihre Ideen auch hier von einer unergründlichen Ambivalenz geprägt. Vielleicht ließ mich jener Eintrag im Denktagebuch auch deshalb nicht mehr los. Er stellte eine Frage, die mich aufwühlte — und ließ diese Frage unbeantwortet, in all ihrer Mehrdeutigkeit. In all ihrer Wucht.
Warum fiel es mir so schwer, die Welt zu lieben? Auch auf diesem Spaziergang wollte es mir nicht gelingen, die Verbundenheit, die ich für die natürliche Welt, für die Schönheit des sommerlichen Waldes empfand, auf die Gemeinschaften, in denen ich lebte, zu übertragen. Erst recht auf den Zustand der Welt nicht, und ebenso wenig auf die Menschheit im Allgemeinen. Ich war vom Glauben an die Menschen abgefallen, an die Menschen in meinem Leben, an das Land, in dem ich lebte. Vom Vertrauen in die politischen Strukturen, die den Alltag hier, in Europa und anderswo bestimmen. Ich hatte die Gewissheit verloren, dass wir als Gesellschaft den sich schon lange deutlich abzeichnenden bedrohlichen Entwicklungen etwas entgegensetzen würden. Dass Menschen überhaupt etwas anderes als Chaos, Gewalt, Krieg und Zerstörung produzieren könnten.
Manchmal hatte ich den Eindruck, dass ich die Welt nicht lieben konnte, weil dieser selbst jede Form von Liebe abhandengekommen war. Weil ihr neuerdings mehr denn je Freundlichkeit und Fürsorge zu fehlen schienen, Solidarität und Empathie, Verantwortungsbewusstsein, Gesprächsbereitschaft und Menschlichkeit. Der Soundtrack der Zeit hatte sich unaufhaltsam verändert. Die Nachrichten waren in einem Perpetuum mobile aus Entrüstungs- und Empörungsschleifen gefangen, das nicht nur häufig von den eigentlichen Problemen ablenkte, sondern von vielen politischen Akteurinnen und Akteuren bewusst als ein Instrument der Kontrolle eingesetzt wurde, das ihnen zur Macht verhelfen oder ihre schon vorhandene Macht festigen sollte. Politische Diskurse hatten dem Ethos von freiem Meinungsaustausch und demokratischer Kompromissbereitschaft den Rücken gekehrt und inszenierten unterschiedliche Ansichten und Weltsichten als Ausdruck von Feindschaft. Anstatt sich um die Pflege des Gemeinwohls zu bemühen, mobilisierte man lieber durch die Kraft des Ressentiments. Die rechtsextreme Bewegung sorgte dafür, dass die demokratisch ausgerichteten konservativen Teile der Bevölkerung implodierten, und brachte diese zunehmend dazu, ihre geschichtsvergessenen Erzählungen von Hass und Unterwerfung zu übernehmen. Auch einige progressive Teile der Bevölkerung konnten sich dem Sog autoritärer Erzählungen nicht entziehen. Diese waren zwar anders ausgerichtet, ihrem Wesen nach aber ebenfalls antidemokratisch und häufig ähnlich hasserfüllt. Der Rest der Progressiven — noch nie eine einheitliche Bewegung — zersplitterte in zahlreiche Untergruppen. Deren Positionen waren sich häufig gar nicht unähnlich, führten aber dennoch immer wieder zu Grabenkämpfen und wurden regelmäßig als völlig unvereinbar empfunden.
Der schon seit einigen Jahrzehnten andauernde Einfluss des rechten Rands hatte viele von uns dazu gebracht, die Ideen von Fürsorge und sozialer Gerechtigkeit als einen Luxus anzusehen, den wir uns nicht mehr leisten konnten, und jede menschliche Regung auf der politischen Bühne als etwas Lächerliches oder Sentimentales abzutun. Dieser rechte Rand hatte es vollbracht, aus dem guten Menschen ein Schimpfwort zu machen. Trotzdem schien man sich darauf geeinigt zu haben, dessen Akteurinnen und Akteure, die immer häufiger mit »Bürgerkrieg« drohten, mitsamt ihren kontrafaktischen Opfererzählungen, ihrem Fremdenhass und ihren autoritären Forderungen mit Samthandschuhen anzufassen, während man sich dafür untereinander umso erbitterter bekämpfte. Diese Krise des demokratischen Miteinanders war nicht nur auf Deutschland beschränkt. In den Vereinigten Staaten und vielen Teilen Europas war sie noch viel weiter fortgeschritten.
All das wurde von einer systemischen Krise begleitet. Überall auf der Welt war zu spüren, dass wir uns in einer grundlegenden Transformationsperiode befanden, die mit neuartigen Verteilungskämpfen und beträchtlichem Wohlstandsverlust einherzugehen drohte. Die massiven Umbrüche auf allen Ebenen von Politik, Wirtschaft und Sozialem sorgten dabei für eine kollektive Erklärungsnot, wie ich sie noch nicht erlebt hatte. Renommierte Historikerinnen und Historiker fragten sich inzwischen öffentlich, ob wir gerade den letzten Sommer in Frieden erleben würden.8 Bekannte Intellektuelle überlegten in Podcasts und Interviews laut, ob wir uns nicht schon längst, ohne dass wir es wahrhaben wollten, in einem weiteren, bislang hybrid geführten Weltkrieg befänden. Das vergangene Jahrzehnt habe zu einer grundlegenden Destabilisierung der internationalen Ordnung geführt, die mehr und mehr durch Chaos ersetzt werde, hieß es, und die derzeitigen Kriege zwischen Russland und der Ukraine und Israel und Gaza würden sich über kurz oder lang territorial ausweiten.9 Man fand Worte für ein Weltgefühl, das in den Ländern des globalen Nordens lange nicht vorstellbar gewesen war.
Die wirtschaftliche und politische Vormachtstellung der westlichen Industrienationen verringerte sich von Jahr zu Jahr. Was zum einen zwar dazu führte, dass sich der Einfluss ökonomischer Schwellenländer vergrößerte, zum anderen aber mit dafür sorgte, dass die westliche Demokratie als Staatsform immer mehr zu einer Randerscheinung wurde. Inzwischen lebten nur noch 6,6 Prozent der Weltbevölkerung in vollständigen Demokratien. Eine Reihe von Ländern, die bis vor Kurzem als solche galten, etwa die Vereinigten Staaten, entsprachen nicht mehr dieser Definition.10
Viele Ökonominnen, Politiker und Historikerinnen beschrieben diesen Prozess mit ungewöhnlicher Klarheit. Sie gingen davon aus, dass wir an der Schwelle einer neuen Weltordnung standen, die die Nachkriegsweltordnung ablösen werde. Noch sei unklar, hieß es, welche Allianzen sich bilden würden, doch es zeichne sich ab, dass diese Weltordnung stärker auf militärischer Macht beruhen werde als die bisherige. Manchmal wurde diese Entwicklung als »Wiederkehr einer imperialen Politik« beschrieben, als ein neues Zeitalter des Imperialismus, das an die Großmächte des 19. Jahrhunderts erinnere.11 Manchmal als ein weltweiter Siegeszug des Faschismus.
Zudem wurde immer wieder vor einer neuen »Tech-Oligarchie« oder einem neuen »technologischen Kolonialismus« gewarnt. Die großen Technologieunternehmen der Welt traten aufgrund ihrer Vormachtstellung über soziale Netzwerke, künstliche Intelligenz und zunehmend auch die Finanzwelt immer mehr wie die ehemaligen Kolonialreiche auf. Mithilfe politischer Lobbyarbeit und wirtschaftlicher Erpressung begannen sie ihre eigenen Gesetze zu schaffen und eine Form quasistaatlicher Souveränität zu erlangen. Sie agierten über internationale Grenzen hinweg und schienen zu glauben, dass ihre technologische Überlegenheit eine angemessene Entschuldigung dafür sei, Gesetze und Menschenrechte zu missachten, weltweit Menschen auszubeuten und sogar vor Gewalt nicht zurückzuschrecken.12
Viele Forschende schließlich wiesen eindringlich auf die weltweite Vermögensungleichheit hin, die in keiner Periode der Geschichte so groß war wie heute. Diese Ungleichheit schien zu einer immer größeren Unwucht im alltäglichen Leben zu führen, trieb den Abbau von Sozialsystemen voran, die Umverteilung von der Mittelschicht zu den reichen und überreichen Teilen der Gesellschaft und die Überführung von Allgemeingütern wie Grund, Wasser und Rohstoffen in die Hände von wenigen. Einige erkannten in ihr eine Bedrohung für das Überleben unserer Gesellschaft.13 Andere warnten davor, dass wir den Beginn einer neuen Ära des Feudalismus beobachteten. Und tatsächlich schien sich diese Tendenz etwa in der Errichtung sogenannter »Freedom Cities« zu verwirklichen, an der die US-amerikanische Regierung arbeitete. In diesen Sonderwirtschaftszonen, Substaaten und Unternehmen zugleich, sollten eigene Gesetze, eigene Steuern und eigene Währungen gelten. Jeder demokratischen Regulierung entzogen, sollte sich hier eine radikale anarcho-kapitalistische Fantasie verwirklichen, die zu Menschenrechtsverletzungen, Umweltkatastrophen und neuen Formen von Sklaverei führen könnte.14
Nicht nur unsere politischen und sozialen Systeme erwiesen sich während dieser Transformation als sehr viel verletzlicher als angenommen. Die ineinandergreifenden Entwicklungen spielten sich vor einem Hintergrund ab, der von fast allen Regierungen der Welt systematisch ausgeblendet wurde und der unter immer größeren Teilen der Bevölkerung auf Desinteresse und Apathie stieß. Der Weltklimarat korrigierte aufgrund neuer Forschungsstände seine Voraussagen. In allen klimatischen Bereichen sei die Situation sehr viel dramatischer als angenommen, hieß es. Wir müssten uns schon in naher Zukunft auf Extremwetterereignisse einstellen, die viele Gesellschaften der Welt radikal überfordern würden. Mit unabsehbaren Folgen. Doch anstatt weiter gegen den menschengemachten Klimawandel anzugehen, sorgten viele Regierungen der Welt, darunter jene in Deutschland und den Vereinigten Staaten, dafür, dass der Ausbau erneuerbarer Energien gestoppt wurde, und investierten wieder in großem Stil in fossile Brennstoffe. Weltweit wurden die Fortschritte im mühsamen Kampf gegen die Erderwärmung um viele Jahre zurückgeworfen. Es wirkte so, als seien die meisten Menschen müde geworden, auch nur an den Klimawandel zu denken. Währenddessen verkleinerte sich nicht nur das Fenster einer lebbaren Zukunft, sondern drohte sich ganz zu schließen. Alles, was das Thema betraf, schien sich verändert zu haben, außer der Eindringlichkeit der Warnungen aller, die dazu forschten.15
Warum fiel es mir so schwer, die Welt zu lieben? Wie viele Menschen gab es überhaupt, denen das derzeit leichtfiel? Fast allen meiner Freundinnen und Freunde ging es ähnlich wie mir. Manchmal reichten ein paar Worte, ein Kopfschütteln oder ein Verdrehen der Augen, um diese Wirklichkeit anzuerkennen und sich dann über etwas anderes zu unterhalten. Manchmal kam es zu langen, ernsten Gesprächen, die sich mal hoffnungsvoll, mal hoffnungslos anfühlten, die mit der Erleichterung endeten, nicht allein mit diesem Gefühlszustand zu sein, aber auch mit der Einsicht, wie herausfordernd es war, angesichts der Lage der Welt, die seit Jahren ungebremst eskalierte, Zuversicht zu bewahren.
Ich ging weiter den vertrauten Weg durch den frühsommerlichen Wald entlang, atmete die klare Luft ein, versuchte mich auf das Geräusch der Baumwipfel und den Gesang der Vögel zu konzentrieren. Ein Teil von mir schämte sich dieses Gefühlszustands der Ratlosigkeit und der Lähmung. Er erinnerte mich an meine Kindheit und Jugend und reaktivierte etwas, das ich, wenn nicht vergessen, dann doch vergangen geglaubt hatte. Es war ein Gefühlszustand, der meinem derzeitigen Leben, das seit ein paar Jahren von einem gewissen, unsicheren Wohlstand geprägt war, nicht wirklich entsprach. Ein Gefühlszustand, der der Realität nicht Rechnung trug, dass ich Handlungs- und Selbstverwirklichungsmöglichkeiten hatte, eine Stimme, über die ich als Jugendlicher nicht verfügte. Ein Gefühlszustand, der außer Acht ließ, dass ich Dinge verstand, die ich als Kind nicht verstehen konnte. Manchmal fühlte ich mich, als hätte es drei Jahrzehnte Therapien, Psychoanalysen, Selbsthilfegruppen und Körperarbeit nicht gegeben. Ich konnte nicht sagen, ob es überhaupt eine Möglichkeit geben konnte, mit dieser Ohnmacht umzugehen.
Mir war bewusst, dass dieser Zustand auch die Folge einer nachhaltigen Retraumatisierung war. Selbst an so schönen Frühsommertagen wie diesem gelang es mir nicht, sie einzudämmen. Diese Retraumatisierung hatte sich schon länger abgezeichnet, doch mit den Wahlen in den Vereinigten Staaten und den parallelen Entwicklungen in unserem Land war sie spürbar in meinen Alltag eingebrochen. Ihre Ursachen reichten in das letzte Jahrzehnt der DDR und in meine Jugend in den 1990er Jahren im ländlichen Mecklenburg-Vorpommern zurück, zu Erfahrungen der Ausgrenzung, des Hasses und der Gewalt, die sich unauslöschlich in mein Gedächtnis und meinen Körper eingebrannt hatten. Ich hatte geglaubt, wir als Gesellschaft hätten diese Phase hinter uns gelassen. Für immer. Doch jene Jahre schienen nicht nur einfach wieder da zu sein. Sie waren mit der Wucht des Unbearbeiteten, des lange Verdrängten und Aufgestauten zurückgekehrt.
Ich hatte Angst. Angst davor, dass die Autokraten und Despoten, die in den vergangenen Jahren weltweit die Macht ergriffen hatten, den Planeten weiter zerstören, weiter in Hass und Krieg stürzen würden. Angst davor, dass die Rechtsextremen und die ihnen nahestehenden autoritären, nicht länger an der Demokratie interessierten Konservativen auch hierzulande für die Implosion hart erkämpfter Freiheiten und des sozialen Fortschritts sorgen und die Uhr um Jahrzehnte zurückdrehen würden, so wie sie es schon in vielen anderen Ländern getan hatten. Dass die in den vergangenen Jahren vorangetriebene Verrohung des politischen Miteinanders ihre ganze destruktive Kraft freisetzen würde. Es war wieder allerorten selbstverständlich geworden, nach unten zu treten und von oberster Stelle der Politik systematisch auf die Schwächsten der Gesellschaft einzuhauen. Statt die Vielzahl von strukturellen Problemen des Landes anzugehen, mussten Bürgergeldempfangende, Arbeitslose und Geflüchtete als Sündenböcke herhalten und wurden mit weiterer Ausgrenzung und weiteren Benachteiligungen für ihre Hilfsbedürftigkeit bestraft.
Die Politik des Hasses schien immer mehrheitsfähiger zu werden. Es gehörte wieder zum Alltag vieler Menschen, auf der Straße verbal und oftmals auch körperlich angegriffen zu werden. Ich hatte viele Jahre lang nicht mehr damit rechnen müssen, als schwuler Mann auf der Straße beschimpft, bedroht oder angespuckt zu werden, und mich in Sicherheit gewiegt. Doch das hatte sich geändert. Teile der Regierung des Landes befeuerten diese Entwicklung, indem sie öffentlich postulierten, dass es gegen ihre politische Neutralität verstoße, sich für die Gleichberechtigung queerer Menschen einzusetzen, auch wenn diese wie andere Menschenrechte in der Verfassung verankert ist. Rechtsextreme Übergriffe, Körperverletzungen und Morde waren in den vergangenen Jahren exponentiell angestiegen. Es gab wieder ganze Gegenden in Deutschland, in denen Menschen nicht mehr sicher waren. Dennoch spielten die Regierenden diese Gefahr herunter und stellten sie mithilfe falsch visualisierter Statistiken auf eine Ebene mit anderen politisch motivierten Straftaten. Auch medial fand die alltäglich gewordene rechtsextreme Gewalt wenig Aufmerksamkeit. Über Gewalttaten wurde vor allem dann berichtet, wenn sie von migrantisierten Menschen begangen wurden.