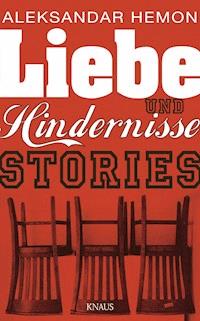
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hemon at his best: Stories zwischen Joseph Conrad und Led Zeppelin
»Es gibt immer einen Tunnel am Ende des Lichts.« Bogdan, der jugendliche Held in den Geschichten von Aleksandar Hemon, lässt sich schon mit sechzehn nicht von sinnlosen Sprüchen irritieren. Auch wenn ein Aufenthalt in Afrika ihm zeigt, dass er noch nicht einmal ahnt, was er alles nicht weiß, auch wenn der bosnische Krieg ihn heimatlos macht und ein Pulitzer-Preisträger sein Selbstbewußtsein als Schriftsteller hart auf die Probe stellt. Wie unwegsam und steil die Straße des Lebens auch sein mag, eines hat er verstanden: Es gibt keinen Weg zurück ins Paradies, aber wir können wenigstens versuchen, so hoch wie möglich zu steigen. Frech, herrlich schräg und voller hintergründigem Humor erzählt Aleksandar Hemon die Geschichten Bogdans, der sich durch nichts und niemanden am Erwachsenwerden und am Dichten hindern lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Aleksandar Hemon
Liebe und Hindernisse
Stories
Deutsch von Rudolf Hermstein
Knaus
Die Originalausgabe erschien 2008 unter dem Titel «Love and Obstacles» bei Riverhead Books, New York
1. Auflage Copyright © der Originalausgabe 2008 by Aleksandar Hemon Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2010 beim Albrecht Knaus Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Umschlaggestaltung: semper smile Werbeagentur, München Gesetzt aus der Minion von Greiner & Reichel, Köln
eISBN: 978-3-641-18743-9
www.knaus-verlag.de
www.randomhouse.de
Für meine Eltern
Inhaltsverzeichnis
Stairway to Heaven
Es war eine vollkommene afrikanische Nacht, wie bei Joseph Conrad: Die Luft war teigig und reglos vor Feuchtigkeit, die Nacht roch nach verbranntem Fleisch und Fruchtbarkeit, die Dunkelheit draußen war weiträumig und undurchdringlich. Mir war, als hätte ich einen Malaria-Anfall, aber es war wohl nur die Reisemüdigkeit. Ich stellte mir Myriaden von Tausendfüßlern vor, die sich an der Decke über meinem Bett versammelten, ganz zu schweigen von den zahllosen Fledermäusen, die in den Bäumen unter meinem Fenster umherflatterten. Am meisten irritierte mich das endlose Trommeln: dieses dumpf dröhnende, sonore Pulsieren um mich herum. Ob es von Krieg, Frieden oder Gebet kündete, wusste ich nicht zu sagen.
Ich war sechzehn, ein Alter, in dem Angst die Fantasie beflügelt. Also machte ich Licht, kramte ein nagelneues Moleskine-Tagebuch aus meinem Koffer – die Trommeln beschworen noch immer die Mächte der Finsternis – und schrieb auf die erste Seite
Kinshasa, 7.7.1983
nur um zu hören, wie die Schlafzimmertür meiner Eltern aufgerissen wurde und Tata fluchend davonstampfte. Ich sprang aus dem Bett – Sestra fing vor Schreck an zu weinen – und lief Tata nach, der bereits die Lampen im Wohnzimmer angemacht hatte. Ich stieß mit Mama zusammen, die ihren beschwerlichen Busen auf den Armen trug. Inzwischen waren alle Lichter an, Nachtfalter flatterten ausweglos im Innern einer Lampe, von allen Seiten hörte man Schreie und das laute Scheppern von Becken. Es war furchterregend.
«Spinelli!», rief Tata in den Lärm. «Eine Unverschämtheit!»
Tata trug einen Flanellschlafanzug, der sich besser für einen Skiort in den Alpen als für Afrika geeignet hätte – angeblich waren Klimaanlagen schädlich für seine Nieren. Bevor er das Zimmer verließ, setzte er außerdem einen Tropenhelm auf, um seine Glatze vor Zugluft zu schützen. Als er fuchsteufelswild in der dröhnenden Dunkelheit des Treppenhauses verschwand, drückte Sestra, die jetzt haltlos weinte, ihr Gesicht in Mamas Seite; ich stand in der Unterhose da, die nackten Füße auf dem kalten Boden, den Stift noch in der Hand. Die Möglichkeit, dass er nicht mehr zurückkommen würde, flackerte im Dunkeln auf. Mir kam es nicht in den Sinn, ihm nachzugehen. Mama versuchte nicht, ihn zurückzuhalten. Die Treppenbeleuchtung ging an, und wir hörten ein lautes Klingeln. Die Trommeln dröhnten ungerührt weiter, und ein neuerliches empörtes Bimbam passte sich ihrem Rhythmus an. Tata gab das Klingeln auf, hämmerte stattdessen an die Tür und rief in seinem gebrochenen Englisch:
«Spinelli, du bist sehr verrückt. Hör auf mit Lärm. Wir sind schlafen. Es ist vier Uhr am Morgen.»
Unsere Wohnung lag im fünften Stock; es mussten Dutzende von Menschen in dem Haus wohnen, aber offenbar hatten sie es überstürzt verlassen. Im selben Moment, als das Treppenlicht wieder ausging, hörte auch das Getrommel auf, die Show war zu Ende. Die Tür öffnete sich, und eine näselnde amerikanische Stimme sagte: «Tut mir leid, Mann. Bitte vielmals um Entschuldigung.»
Als ich wieder ins Bett ging, dämmerte es bereits. Auf den Bäumen draußen ersetzten Heerscharen von Vögeln die blutsaugenden Fledermäuse und zwitscherten im Überschwang sinnlosen Lebens. An Schlafen und Träumen war nicht mehr zu denken, und schreiben konnte ich jetzt auch nicht. Ich rauchte auf dem Balkon und wartete darauf, dass alles einen Sinn ergeben würde, bis ich einsah, dass dieses Warten vergeblich war. Drunten auf der Straße hockte ein spärlich bekleideter Mann neben einem Pappkarton, auf dem Zigaretten aufgereiht lagen. Sonst war niemand zu sehen. Anscheinend schützte er die Zigaretten vor einer unsichtbaren Gefahr.
Anfang der achtziger Jahre lebte Tata nicht bei uns zu Hause; er arbeitete als subalterner jugoslawischer Diplomat in Zaire, zuständig für Kommunikation (was immer das sein mochte). Unterdessen begegnete ich in Sarajevo dem Elend meiner Jugend und der bevorstehenden Nichtswürdigkeit des Erwachsenendaseins damit, dass ich mich in Büchern vergrub. Sestra war zwölf und ahnte nichts von dem in mir aufkeimenden Schmerz. Mama war midlifebedingt unglücklich und einsam, was ich aber damals, die Nase stets in einem Buch, nicht wahrnahm. Ich las zwanghaft und kam nur gelegentlich an die Oberfläche alltäglicher Realität, um kurz nach der anrüchigen Existenz anderer Menschen zu schnuppern. Ich las die ganze Nacht, den ganzen Tag, statt meine Hausaufgaben zu machen. In der Schule las ich heimlich unter der Tischplatte, ein Kapitalverbrechen, das oft von einer Clique von Schulhofschlägern bestraft wurde. Nur im imaginären Raum der Literatur fühlte ich mich wohl und sicher – kein abwesender Vater, keine depressive Mutter, keine Schulhofschläger, die mich Buchseiten ablecken ließen, bis meine Zunge von der Druckerschwärze ganz schwarz war.
Asra lernte ich kennen, als ich einmal ausgeliehene Bücher in die Schulbibliothek zurückbrachte, und mir gefiel auf Anhieb ihr bebrilltes Gesicht, das die innere Ruhe einer Leserin ausstrahlte. Ich begleitete sie nach Hause, ging jedes Mal langsamer, wenn ich etwas zu sagen hatte, und blieb ganz stehen, wenn sie etwas sagte. Sie interessierte sich nicht für den Fänger im Roggen; ich hatte Quo Vadis nicht gelesen und heuchelte Interesse am Bauernaufstand. Doch wir teilten die Leidenschaft, uns in ein Leben mit anderen zu versetzen – eine notwendige Voraussetzung für jede Liebe. Schon bald fanden wir Bücher, die wir beide mochten: Die Zeitmaschine, Große Erwartungen, Und dann gab’s keines mehr. An unserem ersten Tag sprachen wir hauptsächlich über Der Zwerg aus einem vergessenen Land. Wir liebten es, obwohl es ein Kinderbuch war, weil wir uns beide mit einem kleinen, in der großen Welt verirrten Wesen identifizieren konnten.
Von nun an verabredeten wir uns. Das heißt, wir lasen einander oft vor, auf einer Bank an der Miljacka, und küssten uns nur, wenn uns der Gesprächsstoff ausging; mit den Zärtlichkeiten hielten wir uns sehr zurück, als wäre andernfalls die kuriose, beherrschbare Intimität, die zwischen uns gewachsen war, aufgebraucht worden. Ich war vollkommen glücklich, wenn ich ihr eine Passage aus Franny und Zooey oder Der lange Abschied ins Haar flüstern konnte. Als Tata, auf Urlaub in Sarajevo, verkündete, dass wir den Sommer 83 alle zusammen in Afrika verbringen würden, fühlte ich mich deshalb seltsam erleichtert: Wenn Asra und ich getrennt waren, konnten wir der quälenden Versuchung widerstehen und der unvermeidlichen Befleckung der Seele durch den Körper entgehen. Ich versprach ihr, täglich Tagebuch zu schreiben, da Briefe aus Afrika erst lange nach meiner Rückkehr ankommen würden. Ich würde jeden Gedanken festhalten, gelobte ich, jedes Gefühl, jede Erfahrung, und sobald ich zurück war, würden wir uns gemeinsam alles vorstellen, als läsen wir beide dasselbe Buch.
Es gab vieles, was ich in jener ersten Nacht in Kinshasa hätte niederschreiben wollen: das flammende Abendrot im Westen, der undurchdringlich dunkle Osten, als wir bei Sonnenuntergang den Äquator überquerten, die Erinnerung an den Duft ihres Haars, eine Zeile aus Der Zwerg aus einem vergessenen Land, die wir beide so liebten: Ich muss den Heimweg finden, bevor es Herbst wird, bevor die Blätter den Pfad zudecken. Aber ich schrieb nichts und beruhigte mein Gewissen, indem ich alles auf das störende Getrommel schob. Was ich nicht schrieb, behielt ich im Hinterkopf, wie die Geburtstagsgeschenke, die ich erst aufmachen durfte, wenn alle Gäste gegangen waren.
Wie auch immer, am nächsten Morgen stand Sestra im Wohnzimmer und betrachtete einigermaßen fasziniert einen winzigen Mann in einem T-Shirt, auf dem ein in der Luft abgeschossener Engel dargestellt war. Mama saß ihm gegenüber am Couchtisch, lauschte aufmerksam seinem Gezwitscher, die Beine übereinandergeschlagen, der Saum ihres Rocks im Bogen über der nördlichen Hemisphäre ihres Knies.
«Svratio komšija Spinelli», sagte sie.«Nemam pojma šta prica.»
«Guten Morgen», sagte ich.
«Guten Tag, Kumpel», sagte Spinelli. «Der Tag ist schon fast vorbei.» Er zeigte seine Zähne, die von der Mitte zu den Wangen hin gleichmäßig an Größe abnahmen, wie Orgelpfeifen. Sestra lächelte simultan mit ihm; er hatte beide Hände auf den Oberschenkeln geparkt, sie lagen völlig reglos, ruhten sich aus vor ihrer nächsten Aufgabe, die darin bestand, die beiden Locken auseinanderzuschieben, die seine Stirn wie runde Klammern umrahmten. Sie kehrten jedoch augenblicklich in ihre Ausgangsposition zurück. Ihre Spitzen berührten symmetrisch seine Augenbrauen.
Dies war das erste Mal, dass ich Spinelli gegenüberstand, und von dem Moment an veränderte sich sein Gesicht ständig, wobei alle Veränderungen sich nur in den zwei Runzeln zwischen seinen Augen abspielten, parallel wie Gleichheitszeichen, sowie in dem sanften, bestrickenden Lächeln, das jeden seiner Sätze abschloss. Er sagte: «Tut mir leid wegen dem Lärm. Ein gelangweilter Hund macht die komischsten Sachen.»
Mit sechzehn verwendete ich viel Zeit und Mühe darauf, mich gelangweilt zu geben: Augenverdrehen, kurze, knappe Antworten auf inquisitorische elterliche Fragen, der einstudierte leere Blick, wenn die Eltern eine Begebenheit aus dem wirklichen Leben erzählten. Ich hatte mir einen eisernen Schild der Gleichgültigkeit geschmiedet, der es mir ermöglichte, mich abzusetzen, in meine Zelle zurückzukehren und zu lesen, ohne dass es irgendwer bemerkte. Aber in der ersten Woche in Afrika war die Langeweile real. Ich konnte nicht lesen; mein Blick lief immer wieder über dieselbe – die siebenundzwanzigste – Seite von Herz der Finsternis und gelangte nicht darüber hinaus. Ich versuchte, Asra zu schreiben, aber ich wusste nicht, was, wahrscheinlich deshalb, weil es so viel zu sagen gab.
Es gab wirklich nichts zu tun. Ich durfte nicht allein in den menschlichen Dschungel von Kinshasa hinaus. Eine Zeitlang sah ich fern, Mobutus Hetzreden und Werbespots, in denen Dosen mit Kokosöl am blauen Himmel erschwinglichen Glücks schwebten. Ein- oder zweimal verspürte ich sogar mitten am Tag den unerklärlichen Wunsch, mit meiner Familie zusammenzusein. Aber Tata war bei der Arbeit, Sestra schützte ihre aufkeimende Souveränität, indem sie ihren Walkman laut aufdrehte, und Mama war weit weg, interniert in der Küche, wo sie wahrscheinlich weinte. Der Deckenventilator drehte sich träge und unaufhörlich und erinnerte mich daran, dass die Zeit hier ebenso nervtötend langsam verging wie zu Hause.
Tata war groß darin, Versprechungen zu machen, von ungeahnten Möglichkeiten zu fabulieren. Daheim in Sarajevo hatte er auf die riesige, leere Leinwand unseres sozialistischen Provinzlertums ein Kinshasa projiziert, das ein Hort neokolonialer Vergnügungen war: exklusive Clubs mit Swimmingpools und Tennisplätzen, diplomatische Empfänge mit dem internationalen Jetset und mit echten Spionen, kosmopolitische Kasinos und exotische Lounges, Safaris in der Wildnis und Philippe, einen einheimischen Koch, den er einem Belgier abgejagt hatte, indem er seinen Lohn auf einen etwas weniger lächerlichen Betrag erhöhte. In dieser ersten, ereignislosen Woche erwiesen sich alle diese Versprechen als hohl – nicht einmal Philippe erschien zur Arbeit. Wenn Tata von der Botschaft nach Hause kam, gab es ein Nullachtfünfzehn-Abendessen, das Mama aus dem improvisierte, was sie im Kühlschrank gefunden hatte: schrumplige Paprikaschoten und eingefallene Papayas, Erdnusspaste und Fleisch, bei dem es sich auch um Ziegenfleisch handeln konnte.
In der Absicht, die Wolken der Langeweile, die über uns hingen, zu vertreiben, rief Tata schließlich den jugoslawischen Botschafter an und lud uns in dessen Residenz in Gombe ein, wo alle bedeutenden Diplomaten wohnten. Die Villen dort waren groß, die Rasenflächen ausgedehnt, imposante Blumen blühten zwischen makellos getrimmten Büschen, der ehrwürdige Kongo strömte majestätisch dahin. Seine Exzellenz und seine exzellente Gattin waren höflich und bar jeder Vitalität und jedes erzählerischen Talents. Wir saßen in ihrem Empfangszimmer, und die Erwachsenen tauschten Banalitäten aus («Kinshasa ist seltsam»; «Kinshasa ist wirklich klein»), so wie sie die Zuckerdose herumreichten. Exotische Trophäen waren geschickt auf den Raum verteilt: ein Stück geklöppelte Spitze aus Antwerpen an der Wand, ein antiker mesopotamischer Stein auf dem Couchtisch, im Bücherregal ein Bild von Ihren Exzellenzen auf einem verschneiten Berg. Ein Diener mit einer riesigen roten Schärpe brachte Getränke – Sestra und ich bekamen jeder ein Glas Limonade mit einem langen Silberlöffel. Ich wagte nicht, mich zu bewegen, und als Sestra sich unversehens und ohne Grund wie ein glücklicher Hund auf dem knöcheltiefen Afghan wälzte, fürchtete ich, unsere Eltern würden sich von uns lossagen.
Kaum waren wir wieder zu Hause, ging ich zu Spinelli hinauf. Er kam in Shorts an die Tür – die Beine spindeldürr – und trug immer noch das Hemd mit dem erschossenen Engel. Er schien gar nicht überrascht, mich zu sehen, und fragte auch nicht, was mich zu ihm führe. «Komm rein», sagte er. Er rauchte und hatte einen Drink in der Hand, und hinter ihm dröhnte Musik. Ich zündete mir eine Zigarette an; ich hatte den ganzen Tag nicht geraucht und litt unter dem Nikotinentzug. Der Rauch sank wie federleichte Seide in meine Lunge hinab und stieg durch die Nase wieder empor; das war so schön, dass mir der Atem stockte und ich schwindlig wurde. Spinelli spielte im Rhythmus der lauten Musik Air Drums, eine halb heruntergebrannte Zigarette mitten im Mund. «‹Black Dog›», sagte er. «Mein Gott.» In der hinteren Ecke, direkt unter dem Fenster, stand ein Schlagzeug; die goldenen Becken zitterten im Luftzug der Klimaanlage.
Während er imaginäre Drumsolos und Überleitungen spielte, machte er ungefragt Geständnisse: Er war in einem rauen Viertel Chicagos aufgewachsen und bei der ersten Gelegenheit abgehauen, lebte schon ewig und drei Tage in Afrika, arbeitete für die US-Regierung und durfte mir nicht sagen, was genau er machte, sonst hätte er mich anschließend umbringen müssen. Immer, wenn er einen Satz anfing, setzte er sich hin, und wenn er ihn beendete, stand er wieder auf; der nächste wurde dann vom Dröhnen unsichtbarer Trommeln untermalt. Er war ununterbrochen in Bewegung; der Raum ordnete sich um ihn herum, er verströmte so viel von sich selbst, dass ich mir vorkam, als sei ich nicht vorhanden. Erst nachdem ich erschöpft seine Wohnung verlassen hatte, konnte ich überhaupt wieder denken. Und so dachte ich, dass er ein echter Amerikaner war, ein Lügner und Angeber, und dass das Zusammensein mit ihm viel anregender war als die Fesseln des Familienlebens oder die exzellenten Diplomaten in Gombe. Irgendwann im Lauf seines strömenden, rastlosen Monologs taufte er mich aus keinem ersichtlichen Grund Tollpatsch.
Zwei Tage später ging ich zu ihm hinauf, und dann noch einmal am folgenden Tag. Mama und Tata war das anscheinend nur recht, denn wenn ich meine Langeweile mitnahm, blieben uns allen lange Perioden beklommenen Schweigens erspart. Außerdem dachten sie bestimmt, dass es gut für mich sei, mich mit der realen Welt und ihren Bewohnern abzugeben, ohne tatsächlich außer Haus zu gehen; und ich konnte dabei mein Englisch verbessern. Was mich betraf, so rauchte ich bei Spinelli, soviel ich wollte, die Musik war viel lauter, als es meine Eltern jemals geduldet hätten, und er schenkte mir Whiskey nach, bevor mein Glas halb leer war. Er brachte mir sogar ein bisschen Trommeln bei – es machte mir irren Spaß, die Becken zusammenzuschlagen. Aber am meisten genoss ich seine Geschichten: Er erzählte sie halb liegend auf der Couch, blies Zigarettenrauch in den schnell rotierenden Deckenventilator, trank seinen J&B und unterbrach sich, um ein Solo in einer Lead-Zeppelin-Nummer anzuhören. Mag ja sein, dass Lügen einen Beigeschmack von Tod haben, ein Aroma von Sterblichkeit, aber Spinellis Lügen machten Spaß.
An der Highschool hatte er einen Zigarettenhandel betrieben und regelmäßig Sex mit seiner Geographielehrerin gehabt. Er war per Anhalter quer durch Amerika gefahren: In Oklahoma hatte er mit Indianern getrunken und Pilze von ihnen bekommen, die ihn dorthin versetzten, wo ihre Geister lebten – die Geister hatten große Ärsche mit zwei Löchern, die beide gleich nach Scheiße rochen. In Idaho hatte er in einer Höhle gelebt, mit einem Typ, der den ganzen Tag den Himmel beobachtete und auf den Angriff eines Hubschraubergeschwaders wartete. Er hatte Vieh aus Mexiko nach Texas und Autos aus Texas nach Mexiko geschmuggelt. Danach die Army: Er hatte sich vor gefährlichen Einsätzen gedrückt, indem er seinen Schwanz mit Zwiebel einrieb, um eine Infektion vorzutäuschen, hatte in Deutschland herumgehurt und in einer Disco einen montenegrinischen Zuhälter erstochen. Dann Afrika: Er hatte sich nach Angola geschlichen, um Savimbis Freiheitskämpfer zu unterstützen, hatte mit den Israelis ugandische Spezialeinheiten trainiert und in Durban Prostituierte auf einen Agenten angesetzt. Er erzählte seine Geschichten kreuz und quer, bewegte sich ohne Rücksicht auf die Chronologie durch sein Leben.
Hinterher lag ich in meinem Bett und versuchte, den Bewusstseinsstrom in meinem Kopf so weit zu ordnen, dass ich alles für Asra aufschreiben konnte. Doch vergebens. Denn jetzt sah ich die Löcher im Gewebe seiner Erzählungen, die Ungereimtheiten und Widersprüche, den schieren Blödsinn. Die Geschichten waren untadelig, während er sie erzählte, wären aber in schriftlicher Form offenkundige Lügen gewesen. Sobald ich mich aus seiner Nähe entfernte, war er nur noch ein Quatschkopf; er musste in seinen eigenen Geschichten körperlich anwesend sein, damit sie plausibel wurden. Deshalb suchte ich seine Gegenwart. Ich ging immer wieder zu ihm.
Als ich eines Abends hinaufkam, hatte Spinelli sich fein gemacht und war ausgehfertig; er trug ein offenes schwarzes Hemd und roch stark nach Dusche und Eau de Cologne, unter seinem Adamsapfel baumelte eine goldene Kette. Er zündete sich in der Tür eine Zigarette an, inhalierte und sagte: «Gehn wir!», und ich folgte ihm, ohne eine Frage zu stellen. Es kam mir gar nicht in den Sinn, meinen Eltern zu sagen, wohin ich ging. Sie sahen nie nach mir, wenn ich oben war, und angesichts der Langeweile, die ich erduldet hatte, stand mir ein bisschen Abenteuer auf jeden Fall zu. Wie sich herausstellte, gingen wir in ein Kasino gleich um die Ecke.
«Der Typ, dem das Kasino gehört, ist Kroate», erläuterte Spinelli. «Er war in der Fremdenlegion, hat in Katanga gekämpft, dann in Biafra. Ich möchte lieber nicht wissen, was der alles getan hat. Wir haben manchmal geschäftlich miteinander zu tun, und seine Tochter hat mich ziemlich gern.»
Seine Lippen bewegten sich im Gehen, aber seine Stimme war körperlos. Ich zitterte förmlich vor Neugier, wusste aber nicht, was ich ihn fragen sollte: Die Wirklichkeit, von der er redete, war so real, dass sie mir unangreifbar erschien. Wir bogen um die Ecke und hatten die prächtige Neonreklame PLAYBOY CASINO vor uns; das S und das O flackerten allerdings. Weiße Autos und Militärjeeps waren auf dem gekiesten Parkplatz abgestellt. Auf der Treppe standen ein paar Nutten mit lächerlich hohen Absätzen; sie gingen weder hinauf noch hinunter, als fürchteten sie zu stürzen, sobald sie sich bewegten. Aber sie bewegten sich doch, als wir an ihnen vorbeigingen; eine von ihnen packte mich am Unterarm – ich spürte, wie sich ihre langen Nägel in meine verschwitzte Haut gruben – und drehte mich zu sich herum. Sie trug eine helmartige violette Perücke, und ihr winziger BH presste ihre Brüste so hoch, dass ich die Hälfte ihrer linken Brustwarze sah. Ich stand starr vor Schreck da, bis Spinelli mich aus ihrem Griff befreite. «Du fickst wohl nicht viel, Tollpatsch, was?»
Drei Männer saßen am Roulettetisch, alle eindeutig betrunken – zwischen den Umdrehungen des Rades fiel ihnen das Kinn auf die Brust. Der schwere Dunst maskuliner Verwegenheit hing über dem Tisch, dessen grüner Filz durch die Häufchen bunter Jetons unterteilt war. Einer der Männer gewann, fuhr aus seinem Tran hoch und schob die Jetons mit beiden Armen, als umarmte er ein Kind, zu sich heran. «Pass auf, wie der Croupier sie bestiehlt», sagte Spinelli vergnügt. «Die verlieren alles, bevor sie ihren ersten Drink bekommen, und dann verlieren sie noch mehr.» Ich beobachtete den Croupier, aber mir fiel nichts auf: Wenn die Spieler gewannen, schob er ihnen die Jetons hin; wenn sie verloren, harkte er den Haufen zu sich heran. Es wirkte alles einfach und ehrlich, aber ich glaubte Spinelli, denn jede Gemeinheit faszinierte mich. Ich begann, eine Beschreibung des Casinos für Asra zu entwerfen. Der Vorraum zur Hölle: der Rauchkegel, der zu der Lampe über dem Blackjacktisch aufstieg, das hysterische Blinken der beiden Spielautomaten in der Ecke, der Mann, der im Outfit eines Plantagenbesitzers – heller Leinenanzug und Strohhut – an der Bar stand. Seine rechte Hand hing vom Tresen herab wie der Kopf eines schlafenden Hundes, vor den Knöcheln zog ein Band Zigarettenrauch vorüber.
«Komm, ich stell dich Jacques vor», sagte Spinelli. «Das ist der Boss.»
Jacques nahm die Zigarette zwischen die Lippen, schüttelte Spinelli die Hand und musterte mich dann wortlos von Kopf bis Fuß.
«Das ist Tollpatsch, Bogdans Sohn», bemerkte Spinelli. Jacques’ Gesicht war vollkommen rechteckig, die Nase vollkommen dreieckig; sein Hals glich einem Ofenrohr aus Fleisch. Er strahlte die kumpelhafte Rücksichtslosigkeit eines Mannes aus, dessen Leben um seinen Profit und sein Überleben herum organisiert ist; aus seiner Sicht gehörte ich nicht der Welt schlichter Tatsachen an. Er drückte seine Zigarette aus und sagte in einem von groben kroatischen Konsonanten entstellten Englisch zu Spinelli: «Was ich soll machen mit Bananen? Sind am Verfaulen.»
Spinelli schaute mich an, schüttelte ungläubig den Kopf: «Tu sie in einen Obstsalat.»
Jacques grinste zurück: «Ich erzähl dir einen Witz. Mutter hat sehr hässliches Kind, schrecklich, sie steigt in Zug, sitzt in Coupé. Leute kommen in ihr Coupé, sie sehen Kind, ist sehr hässlich, können nix anschauen, gehen wieder, gehen weg, widerliches Kind. Keiner sitzt mit ihnen. Dann kommt Mann, lächelt zu Mutter, lächelt zu Kind, setzt hin, liest Zeitung. Mutter denkt, guter Mann, mag mein Kind, ist wirklich guter Mann. Dann Mann nimmt Banane und fragt Mutter:‹Dein Affe will Banane?›»
Spinelli lachte nicht, nicht einmal, als Jacques die Pointe wiederholte: «Dein Affe will Banane?» Stattdessen fragte er Jacques: «Ist Natalie da?»
Ich folgte Spinelli durch einen Perlenvorhang in einen Raum mit einem Blackjacktisch, an dem vier Männer saßen; alle trugen Uniformen, eine davon khakigelb, die anderen drei olivgrün. Natalie war die Kartengeberin. Mit langen, geschmeidigen Fingern verteilte sie die Karten, ihr Blässe leuchtete in dem dunklen Raum, ihre Arme waren mager, ganz ohne Muskeln, an den Unterarmen hatte sie blaue Flecken, am Oberarm Kratzer. An der Schulter hatte sie eine Impfnarbe, wie der Abdruck einer kleinen Münze. Spinelli setzte sich an den Tisch, nickte ihr zu und klopfte mit einer Zigarettenschachtel auf seine Handfläche. Ihre Wangen hoben sich, Fragezeichen rahmten ihr Lächeln ein. Als sie die Karten verteilt hatte, hob sie sachte die Hand, als wollte sie einen Schleier lüften, und kratzte sich mit dem kleinen Finger an der Stirn; ihr Haar, straff zu einem Pferdeschwanz gebunden, schimmerte an ihren Schläfen. Sie blinzelte langsam, ruhig; es schien, als hätte es sie Mühe gekostet, ihre langen Wimpern auseinanderzuziehen. Ich stand verzaubert im Dunkeln und rauchte, mein Herz schlug schnell, aber ruhig. Natalie war nicht von dieser Welt, ein verirrter Engel.
Von da an waren wir eine Zeit lang zu dritt. Wir machten Ausflüge: Spinelli fuhr seinen Landrover, der nach Hunden und Seilen roch, trommelte aufs Lenkrad, schlug aufs Armaturenbrett statt auf ein Becken und nannte Natalie sein Äffchen. Natalie saß rauchend auf dem Beifahrersitz und schaute hinaus, ich auf dem Rücksitz, wo der Luftzug durchs offene Fenster mir die berauschende Mischung aus dem Zigarettenrauch und ihrem Geruch direkt ins Gesicht blies. Wir drei: Spinelli, Äffchen, Tollpatsch, wie Figuren in einem Abenteuerroman.
Am 27. Juli – ich weiß es noch so genau, weil ich an diesem Tag wieder einmal zu schreiben versuchte – fuhren wir in die Cité, um nach Philippe zu sehen, der immer noch nicht zur Arbeit erschienen war. Wahrscheinlich war das die zwischen Spinelli und Tata ausgehandelte Buße für dessen Trommelsünden. Spinelli und Natalie holten mich im Morgengrauen ab; das Licht war noch diffus von den Rückständen der schwülen Nacht. Wir fuhren in die Slums, den ameisenartigen Menschenkolonnen entgegen: Männer in zerrissenen Shorts und zerfetzten Hemden, in Tücher gehüllte Frauen mit Körben auf dem Kopf, Kinder mit aufgetriebenen Bäuchen, die neben ihnen hertrotteten; ausgemergelte, langzüngige Hunde folgten ihnen in hoffnungsvollem Abstand. Noch nie im Leben hatte ich etwas so Unwirkliches gesehen. Wir bogen in eine unbefestigte Straße ein, die in einen zerfurchten Weg von der Breite eines Autos überging. Der Landrover wirbelte galaktische Staubwolken auf, selbst wenn wir ganz langsam fuhren. Aus rostigem Blech und Pappe zusammengeschusterte Hütten säumten den Rand eines Grabens, in den sie jeden Moment abstürzen konnten. Ich begriff, was Conrad mit bewohnter Unwirtlichkeit gemeint hatte. Eine Frau mit einem auf den Rücken gebundenen Kind tauchte Wäsche in teebraunes Wasser und schlug mit einem Tennisschläger auf den nassen Packen ein.
ENDE DER LESEPROBE





























