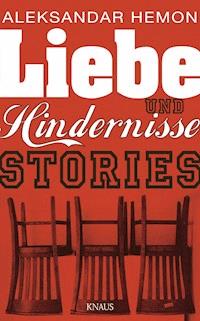11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein virtuos erzählter Roadtrip zu den eigenen Wurzeln 1908 wird in Chicago der junge osteuropäische Einwanderer Lazarus Averbuch, ein vermeintlicher Anarchist, vom Polizeipräsidenten aus nächster Nähe erschossen. Hundert Jahre später will der bosnisch-amerikanische Schriftsteller Brik die Wahrheit über diesen angeblichen Anarchisten ans Licht bringen. Mit seinem Freund Rora macht er sich auf den Weg in die Heimat von Lazarus - ihre Reise wird zu einer Suche nach den eigenen Wurzeln. Eine lakonisch und höchst unterhaltsam erzählte Geschichte über politische Hysterie, Heimatlosigkeit und geplatzte Träume. Und die Geschichte einer Männerfreundschaft, die ihresgleichen sucht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Das Lazarus-Projekt
Aleksandar Hemon wurde 1964 in Sarajevo geboren. 1992 hielt er sich im Rahmen eines Kulturaustauschs in den USA auf, als er von der Belagerung seiner Heimatstadt erfuhr. Er beschloss, im Exil zu bleiben. Seit 1995 schreibt er auf Englisch und veröffentlicht regelmäßig unter anderem in «The New Yorker», «Granta» und «The Paris Review». Sein Erzählband «Die Sache mit Bruno» erschien 2000, 2002 folgte der Roman «Nowhere Man», der für den «National Book Critics Circle Award» nominiert war. Die MacArthur Foundation zeichnete Hemon 2004 mit dem «Genius Grant» aus. Spätestens seit seinem international gefeierten Roman «Lazarus», der in Deutschland auf der Shortlist des Internationalen Buchpreises 2009 stand, gehört er zu den meist beachteten Stimmen der amerikanischen Gegenwartsliteratur. 2013 erschien «Das Buch meiner Leben». Hemon lebt mit seiner Familie in Chicago.
Ein virtuos erzählter Roadtrip zu den eigenen Wurzeln
1908 wird in Chicago der junge osteuropäische Einwanderer Lazarus Averbuch, ein vermeintlicher Anarchist, vom Polizeipräsidenten aus nächster Nähe erschossen. Hundert Jahre später will der bosnisch-amerikanische Schriftsteller Brik die Wahrheit über diesen angeblichen Anarchisten ans Licht bringen. Mit seinem Freund Rora macht er sich auf den Weg in die Heimat von Lazarus - ihre Reise wird zu einer Suche nach den eigenen Wurzeln. Eine lakonisch und höchst unterhaltsam erzählte Geschichte über politische Hysterie, Heimatlosigkeit und geplatzte Träume. Und die Geschichte einer Männerfreundschaft, die ihresgleichen sucht.
Aleksandar Hemon
Das Lazarus-Projekt
Roman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Neuausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Aufl age Februar 2024© der deutschsprachigen Ausgabe 2009 by Albrecht Knaus Verlag,München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH© Taschenbuchausgabe Dezember 2011,btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2024Die amerikanische Originalausgabe erschien 2008unter dem Titel Th e Lazarus Project bei Riverhead Books, New York.Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text undData Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © 2008 KeenanAutorenfoto: © Velibor BozovicE-Book powered by pepyrus
ISBN 978-3-8437-3114-0
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
Motto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Danksagung
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Motto
Widmung
Für meine Schwester, Kristina
Motto
Da er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen und sein Angesicht verhüllt mit dem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen: Löset ihn auf und lasset ihn gehen!
1
Zeit und Ort sind die einzigen Dinge, deren ich mir sicher bin: 2. März 1908, Chicago. Alles andere liegt im Dunst der Geschichte und des Schmerzes, und jetzt stürze ich mich kopfüber hinein.
Früh am Morgen klingelt ein dürrer junger Mann an der Haustür von 31 Lincoln Place, dem Wohnsitz von George Shippy, dem allseits geachteten und gefürchteten Polizeipräsidenten von Chicago. Das Hausmädchen, deren Name als Theresa verzeichnet ist, öffnet die Tür (die sicher bedrohlich knarrt), mustert den jungen Mann, von den schmutzigen Schuhen bis zum dunklen Gesicht, und grinst, wie um zu sagen, er sollte tunlichst einen guten Grund dafür haben, dass er hier steht. Der junge Mann verlangt, Chief Shippy persönlich zu sprechen. Mit ihrem strengen deutschen Akzent teilt ihm Theresa mit, dass es noch viel zu früh sei und Chief Shippy vor neun Uhr niemanden empfange. Er dankt ihr lächelnd und verspricht, um neun wiederzukommen. Seinen Akzent vermag sie nicht einzuordnen; sie wird Shippy warnen, dass der Ausländer, der ihn sprechen will, einen höchst fragwürdigen Eindruck mache.
Der junge Mann steigt die Treppe hinab und öffnet das Tor (das ebenfalls bedrohlich knarrt). Er schiebt die Hände in die Taschen, doch dann zieht er seine Hose hoch – sie ist ihm noch immer zu groß. Er schaut nach rechts, er schaut nach links, als müsse er sich entscheiden. Der Lincoln Place ist eine andere Welt; die Häuser hier sind wahre Schlösser, die Fenster hoch und breit; auf den Straßen sind keine Bettler; es ist überhaupt niemand auf der Straße. Die eisverkrusteten Bäume funkeln im trüben Morgenlicht; ein unter der Eislast gebrochener Ast berührt das Pflaster und lässt seine gefrorenen Zweige klirren. In dem Haus auf der anderen Straßenseite späht jemand hinter einem Vorhang hervor, das Gesicht aschgrau vor dem dunklen Raum dahinter. Es ist eine junge Frau: Er lächelt ihr zu, und sie zieht hastig den Vorhang zu. All die Leben, die er leben könnte, all die Menschen, die er nie kennen, die er nie sein wird, sie sind überall. Das ist die Welt, mehr nicht.
Seit einiger Zeit peinigt der Spätwinter genussvoll die Stadt. Der reine Schnee des Januars und die spartanische Kälte des Februars sind vorbei, und jetzt steigen scheinheilig die Temperaturen, um dann böswillig wieder zu fallen: das Gift jäher Eisstürme, die erschöpften Körper, die verzweifelt auf den Frühling warten, die vielen nach Ofenrauch stinkenden Kleider. Die Füße und Hände des jungen Mannes sind eiskalt, er bewegt die Finger in den Hosentaschen, und bei jedem zweiten Schritt stellt er sich auf die Fußspitzen, als tanze er, um den Kreislauf in Gang zu halten. Er ist seit sieben Monaten in Chicago und hat die meiste Zeit gefroren – die spätsommerliche Hitze ist nur noch eine Erinnerung an einen anderen Albtraum. An einem launisch warmen Tag im Oktober war er mit Olga an dem flechtenfarbenen See, der jetzt dick zugefroren ist, und sie schauten wie gebannt auf die rhythmische Ruhe der herankommenden Wellen und dachten an all das Gute, das eines Tages geschehen könnte. Der junge Mann setzt sich in Richtung Webster Street in Bewegung und macht einen Bogen um den herabhängenden Ast.
Die Bäume hier werden mit unserem Blut gegossen, würde Isador sagen, die Straßen mit unseren Knochen gepflastert; sie verspeisen unsere Kinder zum Frühstück und werfen die Reste in den Abfall. Die Webster Street ist erwacht: In bestickte Lammfellmäntel gehüllte Frauen steigen vor ihren Häusern in Automobile und neigen vorsichtig die Köpfe, um ihre riesigen Hüte zu schützen. Männer in makellosen Galoschen schwingen sich nach den Frauen hinein, ihre Manschettenknöpfe glitzern. Isador behauptet, er suche gern die überirdischen Orte auf, an denen Kapitalisten wohnen, um dort die heitere Ruhe des Wohlstands zu genießen, die von Bäumen gesäumte Stille. Doch um zornig zu sein, kehrt er in die Ghettos zurück; dort ist man immer dem Lärm und der Unordnung nahe, immer in Gestank getaucht, dort ist die Milch sauer und der Honig bitter, sagt er.
Ein riesiges Automobil, keuchend wie ein gereizter Stier, überfährt beinahe den jungen Mann. Die Pferdekutschen sehen aus wie Schiffe, die Pferde sind stämmig, gepflegt und folgsam. Die elektrischen Straßenlaternen brennen noch und spiegeln sich in den Schaufensterscheiben. In einer der Auslagen führt eine kopflose Schneiderpuppe stolz ein zartes weißes Kleid mit schlaff herabhängenden Ärmeln vor. Er bleibt davor stehen, die Puppe steht reglos wie ein Denkmal. Ein Mann mit Eichhörnchengesicht und Kraushaar, der auf einer erkalteten Zigarre herumkaut, stellt sich neben ihn, fast berühren sich ihre Schultern. Der Geruch seines Körpers: feucht, verschwitzt, nach muffigen Kleidern. Der junge Mann stampft mit beiden Füßen auf, damit die Blasen, die er von Isadors Schuhen bekommen hat, nicht so schmerzen. Er denkt daran, wie seine Schwestern zu Hause vor Freude kichernd ihre neuen Kleider anprobierten. An die Abendspaziergänge in Kischinjow; er war stolz und eifersüchtig, weil gut aussehende junge Burschen seinen Schwestern auf der Promenade zulächelten. Es gab ein Leben vor diesem hier. Zuhause ist dort, wo jemand merkt, dass du nicht mehr da bist.
Dem Sirenenduft von warmem Brot folgend, betritt er ein Lebensmittelgeschäft an der Kreuzung Clark und Webster – Ludwig’s Supplies nennt sich der Laden. Sein Magen knurrt so laut, dass Mr. Ludwig von der Zeitung auf der Theke aufschaut und ihn stirnrunzelnd ansieht, während er sich an die Hutkrempe tippt. Die Welt ist immer größer als deine Wünsche; auch viel ist nie genug. Seit Kischinjow ist der junge Mann in keinem so reich bestückten Laden mehr gewesen: Würste, die wie gekrümmte Finger an hohen Regalen hängen; Fässer mit Kartoffeln, die streng nach Lehm riechen; Glaskrüge mit eingelegten Eiern, aufgereiht wie Präparate in einem Labor; Keksschachteln, auf die das Leben ganzer Familien aufgedruckt ist: glückliche Kinder, lächelnde Frauen, gesetzte Männer; gestapelte Sardinenbüchsen; eine Rolle Pergamentpapier, wie eine dicke Thora; eine kleine Waage in selbstbewusstem Gleichgewicht; eine an einem Regal lehnende Leiter, das obere Ende hoch oben im dämmrigen Ladenhimmel. In Mr. Mandelbaums Laden waren die Bonbons auch hoch oben im Regal, damit die Kinder sie nicht erreichten. Warum beginnt der jüdische Tag bei Sonnenuntergang?
Das sehnsüchtige Pfeifen eines Teekessels im Hinterzimmer verkündet den Auftritt einer fleischigen Frau mit einem Haarkranz. Sie trägt einen knorrigen Laib Brot, hält ihn sorgsam im Arm wie ein kleines Kind. Rosenbergs verrückte Tochter, von den Pogromtschiks vergewaltigt, lief hinterher tagelang mit einem Kissen in den Armen herum; sie versuchte immer wieder, es zu stillen, und die Jungen blieben ihr auf den Fersen, in der Hoffnung, eine jüdische Titte zu sehen. «Guten Morgen», sagt die Frau zögernd und wechselt einen Blick mit ihrem Mann – sie sind sich einig, dass man den Kunden nicht aus den Augen lassen darf. Der junge Mann lächelt und gibt vor, sich für etwas im Regal zu interessieren. «Kann ich Ihnen helfen?», fragt Mr. Ludwig. Der junge Mann sagt nichts; die beiden sollen nicht merken, dass er Ausländer ist.
«Guten Morgen, Mrs. Ludwig, Mr. Ludwig», sagt ein Mann, der in den Laden kommt. «Wie geht’s?» Das Glöckchen klingelt noch weiter, während der Mann mit heiserer, müder Stimme spricht. Er ist alt und hat trotzdem keinen Schnurrbart; ein Monokel baumelt über seinem Bauch. Er lüftet den Hut vor Mrs. und Mr. Ludwig und ignoriert den jungen Mann, der ihm zunickt. Mr. Ludwig fragt: «Wie geht es Ihnen, Mr. Noth? Was macht die Grippe?»
«Meiner Grippe geht’s recht gut, danke. Ich wollte, ich könnte dasselbe von mir sagen.» Mr. Noths Gehstock ist krumm. Sein Schlips ist aus Seide, aber fleckig; der junge Mann kann seinen Atem riechen – irgendetwas verfault in seinem Innern. Ich werde nie sein wie er, denkt der junge Mann. Er entfernt sich von dem Geplauder und geht zu der Tafel neben der Ladentür, um die daran aufgespießten Zettel zu lesen.
«Ich könnte ein bisschen Kampfer gebrauchen», sagt Mr. Noth. «Und einen neuen, jungen Körper.»
«Körper sind aus», sagt Mr. Ludwig. «Aber Kampfer haben wir da.»
«Keine Sorge», kichert Mrs. Ludwig. «Dieser Körper wird Ihnen noch lange gute Dienste leisten.»
«Ich danke Ihnen, Mrs. Ludwig», sagt Mr. Noth. «Aber bitte sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie frische Körper hereinbekommen.»
Nächsten Sonntag im Bijou, liest der junge Mann, Joe Santley in der Titelrolle von Billy the Kid. Der Illinois Congress of Mothers veranstaltet ein Symposium über den «Moralischen Einfluss des Lesens»; im Yale Club hält Dr. Hofmannstal einen Vortrag über «Formen der Degeneration: Körper und Moral».
Das Glas mit dem Kampfer und den Hut in der linken Hand, müht sich Mr. Noth, mit der rechten die Tür zu öffnen, wobei der Stock auf seinem Unterarm auf und ab rutscht. Mrs. Ludwig eilt herbei, um ihm zu helfen, noch immer mit dem Brot auf dem Arm, aber der junge Mann ist vor ihr an der Tür und öffnet sie für Mr. Noth, und das Glöckchen klingelt fröhlich. «Oh, danke sehr», sagt Mr. Noth und versucht, den Hut zu ziehen, stößt dabei aber dem jungen Mann den Stock in den Unterleib. «Verzeihen Sie», sagt Mr. Noth und geht hinaus.
«Was darf’s denn sein, der Herr?», fragt hinter der Theke Mr. Ludwig, noch kälter, denn der junge Mann bewegt sich viel zu locker und unbefangen in seinem Laden. Der junge Mann tritt wieder an die Theke und zeigt auf das kleine Regal mit Pastillengläsern. Mr. Ludwig sagt: «Wir haben alle Geschmacksrichtungen: Erdbeer, Himbeer, Menthol, Geißblatt, Mandel. Welche wären Ihnen denn genehm?» Der junge Mann tippt mit dem Finger an das Glas mit runden weißen Pastillen, die billigste Sorte, und hält Mr. Ludwig ein Zehncentstück hin. Sie sollen sehen, dass er Geld für Annehmlichkeiten übrig hat. Ich bin genau wie jeder andere, sagt Isador immer, weil es auf der ganzen Welt keinen wie mich gibt.
Mr. Ludwig funkelt ihn an; wer weiß, womöglich hat der Ausländer eine Waffe in der Tasche. Aber er wiegt eine Menge Pastillen auf der kleinen Waage ab, nimmt ein paar weg und schüttet den Rest in eine Wachspapiertüte. «Hier, bitte», sagt er. «Lassen Sie sich’s schmecken.» Der junge Mann steckt sich sofort eine der Pastillen in den Mund, und sein Magen jault erwartungsvoll auf. Mr. Ludwig hört das Jaulen und schaut seine Frau an. Traue nie einem hungrigen Mann, sagt ihr sein Blick, schon gar nicht einem hungrigen Mann, der seinen Hut aufbehält und Süßigkeiten kauft. Die Pastille ist apfelsauer, Speichel läuft im Mund des jungen Mannes zusammen. Er ist versucht, sie auszuspucken, aber die Pastillen geben ihm das Recht, im Laden zu verweilen, also lutscht er stirnrunzelnd weiter, schlendert zu der Tafel hinüber und schaut sie sich noch einmal an. Im International Theater bringt Richard Curle seine neue musikalische Posse Mary’s Lamb. Dr. George Howe und Partner versprechen sichere Heilung bei Krampfadern, Blutvergiftung, Wasserblasen und Nervenschwäche. Wer sind all diese Menschen? Dr. Howes Konterfei ist auf dem Flugblatt abgebildet – ein griesgrämiger Mann ist er, mit einem gewaltigen schwarzen Schnauzbart im weißen Gesicht. Olga hat ständig geschwollene Venen; nach der Arbeit setzt sie sich hin und legt die Beine auf einen anderen Stuhl. Sie sticht ihm gern seine Blasen auf. Mutter weichte ihre Krampfaderbeine gern in einer Wanne mit heißem Wasser ein, vergaß aber immer das Handtuch. Jedes Mal musste er es ihr bringen und ihr die Füße waschen und abtrocknen. Sie war kitzlig an den Fußsohlen; sie quietschte wie ein Schulmädchen.
Die Pastille ist jetzt fast ganz geschmolzen, und sie ist bitter geworden. Er verabschiedet sich von Mr. und Mrs. Ludwig, worauf sie nicht reagieren, und verlässt den Laden. Die Pferde klappern mit den Hufen und stoßen schnaubend Dampfwolken aus. Er nickt drei Frauen zu, die ihre Schritte beschleunigen, als sie an ihm vorbeigehen, und ihn ignorieren; sie haben sich untergehakt und wärmen sich die Hände in ihren Muffs. Ein stiernackiger Mann, der auf einem Zigarrenstummel herumkaut, kauft eine Zeitung bei einem Jungen, der anschließend ruft: «Berühmter Revolverheld bei Schießerei getötet!» Der junge Mann versucht, dem Zeitungsjungen über die Schulter zu schauen und die Schlagzeilen zu lesen, aber der Junge – ohne Hut, mit einer Narbe quer über dem Gesicht – trollt sich und ruft: «Pat Garrett, der Sheriff, der Billy the Kid erschoss, stirbt bei Schießerei.» Der Magen des jungen Mannes knurrt erneut, und er nimmt noch eine Pastille. Er ist froh, dass er noch ein paar davon hat, er freut sich an ihrem Besitz. Billy. Ein hübscher Name, ein Name für einen unruhigen, aber glücklichen Hund. Pat klingt gewichtig, ernst, wie ein verrosteter Hammer. Er hat noch nie jemanden kennengelernt, der Billy oder Pat hieß.
Kurz danach nähert er sich abermals der Tür von Chief Shippy. Eine weitere Pastille löst sich langsam unter seiner Zunge auf, die Bitterkeit verätzt seinen Hals, lässt seine Mandeln schrumpfen. Er wartet, bis die Pastille ganz zerfallen ist, und drückt dann auf die Klingel; hinter dem Vorhang bewegt sich ein Schatten. Er erinnert sich an einen Abend in seiner Kindheit, als er mit seinen Freunden Verstecken spielte – die anderen hatten sich versteckt, er musste suchen; dann gingen sie alle nach Hause, ohne ihm Bescheid zu sagen; noch bis spät in die Nacht suchte er nach ihnen und rief in die von ihren Schatten erfüllte Dunkelheit: «Da bist du. Ich seh dich», bis Olga ihn fand und ihn heimbrachte. Ein dolchförmiger Eiszapfen bricht von einem hohen Gesims ab, fällt herunter und zerschellt am Boden. Er klingelt noch einmal; Chief Shippy öffnet die Tür; der junge Mann tritt in den dämmrigen Flur.
Punkt neun Uhr öffnet Chief Shippy die Tür und sieht einen jungen Mann mit ausländischen Gesichtszügen, der einen schwarzen Mantel und einen schwarzen Schlapphut trägt und alles in allem wie ein Arbeiter wirkt. Mit dem kurzen, umfassenden Blick auf seinen Besucher, wird William P. Miller hinterher in der Tribune schreiben, erfasste Chief Shippy einen brutalen, geraden Mund mit Wulstlippen sowie zwei graue Augen, die kalt und zugleich fanatischwirkten. Irgendetwas an diesem schlanken, dunkelhäutigen jungen Mann – offenkundig ein Sizilianer oder ein Jude – war dazu angetan, das Herz eines jeden rechtschaffenen Mannes vor Misstrauen erschauern zu lassen. Doch Chief Shippy, den keine Arglist zu erschüttern vermag, bat den Fremden in sein behagliches Wohnzimmer.
Sie bleiben an der Tür stehen, der junge Mann ist unsicher, ob er sich noch weiter vorwagen soll. Nach einem langen Moment bedrohlichen Zögerns – Chief Shippy zieht das Kinn an, ein verwirrter Sperling tschilpt draußen vor dem Fenster, einen Stock höher schlurfen Schritte – drückt er Shippy abrupt ein Kuvert in die Hand.
«Er überreichte mir ein Kuvert, auf dem mein Name und meine Adresse standen», wird Shippy Mr. Miller berichten. «Ich nahm mir nicht die Zeit, das Kuvert näher zu untersuchen. Blitzartig kam mir der Gedanke, dass der Mann nichts Gutes im Schilde führte. Er sah mir aus wie ein Anarchist. Ich packte seine Arme, drehte sie ihm auf den Rücken und rief nach meiner Frau: ‹Mutter! Mutter!›»
Mutter Shippy kommt hereingestürmt, mit all der Urgewalt, die in dem Wort Mutter steckt. Sie ist untersetzt und kräftig und hat einen großen Kopf; in ihrer Hast stolpert sie fast über die eigenen Füße. Ihr Mann hält die Arme eines Sizilianers oder eines Juden fest, und sie legt die Hand auf ihre Brust und stöhnt laut auf. «Durchsuch seine Taschen», kommandiert Chief Shippy. Mutter klopft mit zitternden Händen die Taschen des jungen Mannes ab; er riecht so säuerlich, dass es ihr schier den Magen umdreht. Der junge Mann wehrt sich, will sich losreißen, und dabei grunzt er wie ein muskulöses Tier. «Ich glaube, er hat eine Pistole», schreit Mutter. Chief Shippy lässt die Arme des Fremden los und zieht rasch seinen Revolver. Mutter will sich in Sicherheit bringen und watschelt auf einen Gobelin zu, der – wie William P. Miller anmerkt – den heiligen Georg darstellt, der einen sich windenden Drachen tötet.
Shippys Chauffeur Foley, der gerade gekommen ist, um seinen Chef ins Büro zu fahren, läuft, alarmiert durch die Geräusche eines Handgemenges, die paar Stufen hinauf und zieht seinen Revolver, während Henry, Chief Shippys Sohn (auf Urlaub von der Culver Military Academy) im Pyjama aus seinem Zimmer die Treppe herabgerannt kommt, in der Hand einen blitzenden, stumpfen Säbel. Der junge Mann weicht ein, zwei Schritte von Chief Shippy zurück – Foley, die Pistole im Anschlag, öffnet die Tür, Henry stolpert die letzten Stufen herab –, verharrt einen Moment und stürzt sich dann auf den Chief. Ohne zu überlegen, schießt Chief Shippy auf den jungen Mann; Blut spritzt in hohem Bogen, und Foley sieht nur rot, doch da er gut ausgebildet ist und Chief Shippys Abneigung gegen Zugluft kennt, wirft er hinter sich die Tür ins Schloss. Chief Shippy, durch Foleys Auftauchen erschreckt, schießt auch auf ihn, dann nimmt er wahr, dass jemand von hinten heranstürmt, wirbelt gekonnt herum wie ein Revolverheld und schießt auf Henry. Der nichtswürdige Ausländer schießt auf Foley und zerschmettert ihm das Handgelenk, und dann auf Henry, dessen Lunge von dem Geschoss durchbohrt wird. Shippy und Foley geben daraufhin weitere Schüsse ab, von denen sieben den jungen Mann treffen, dessen Blut und Gehirn an die Wände und auf den Boden spritzen. Während der ganzen Auseinandersetzung, schreibt William P. Miller, hatte der Anarchist keine Silbe von sich gegeben. Er kämpfte hartnäckig weiter, mit diesem verkniffenen grausamen Mund und einer Entschlossenheit in den Augen, die schrecklich anzusehen war. Er starb ohne einen Fluch, ein Flehen, ein Gebet auf den Lippen.
Chief Shippy steht wie erstarrt, hält die Luft an und atmet erleichtert aus, während der junge Mann stirbt und der Pulverrauch langsam durch den Raum zieht wie ein Schwarm Fische.
2
Ich bin ein halbwegs loyaler Bürger zweier Länder. In Amerika – diesem düsteren Land – verschwende ich meine Wählerstimme, zahle widerwillig Steuern, teile mein Leben mit einer einheimischen Frau und muss an mich halten, um dem idiotischen Präsidenten nicht einen qualvollen Tod zu wünschen. Aber ich habe auch einen bosnischen Reisepass, den ich nur selten benutze; ich fahre zu herzzerreißenden Urlaubsaufenthalten und Beerdigungen nach Bosnien, und am oder um den 1. März feiere ich zusammen mit anderen Chicagoer Bosniern stolz und pflichtschuldig unseren Unabhängigkeitstag mit einem angemessen feierlichen Dinner.
Genau genommen fällt der Unabhängigkeitstag auf den 29. Februar – eine typisch bosnische Komplikation. Vermutlich wäre es zu kurios und zu unsouverän, ihn nur alle vier Jahre zu feiern, und so findet diese chaotische Veranstaltung alljährlich in irgendeinem vorstädtischen Hotel statt. Die Bosnier fallen früh und in Scharen ein; beim Parken ihrer Autos streiten sie sich schon mal handgreiflich um einen Behindertenparkplatz: Krückenschwingend versuchen zwei Männer zu klären, welcher von beiden schwerer beschädigt ist – der, dem eine Landmine ein Bein abgerissen hat, oder der mit der Rückgratverletzung, die er prügelnden Wärtern in einem serbischen Lager verdankt. Während sie aus keinem ersichtlichen Grund im Vestibül warten, bevor sie sich in den Speisesaal begeben – der unweigerlich einen hochstapelnden Namen wie Westchester, Windsor oder Lake Tahoe trägt –, rauchen meine Doppelmitbürger, obwohl zahlreiche Schilder darauf hinweisen, dass Rauchen verboten ist. Sobald die Tür aufgeht, stürmen sie die weiß gedeckten, mit zu viel Gläsern und Besteck beladenen Tische, getrieben von der ewigen Angst der Armen, dass auch im Überfluss nie genug für alle da ist. Sie legen sich ihre Servietten auf den Schoß oder hängen sie sich vor die Brust; sie erklären mühsam dem Personal, dass sie ihren Salat lieber zum Hauptgericht essen möchten statt davor; sie machen abfällige Bemerkungen über das Essen, die dann in verächtlichen Äußerungen über die Fettleibigkeit der Amerikaner gipfeln. Und schon bald verflüchtigt sich für diesen Abend restlos das bisschen amerikanische Lebensart, das sie sich im Lauf der letzten zehn Jahre oder so andressiert haben; alle, mich eingeschlossen, sind wieder durch und durch Bosnier, und jeder weiß eine bezeichnende Geschichte über den kulturellen Unterschied zwischen uns und denen zu erzählen. Über diese Dinge habe ich manchmal geschrieben.
Die Amerikaner, da sind wir uns einig, gehen, nachdem sie sich die Haare gewaschen haben, mit noch nassen Haaren aus dem Haus – sogar im Winter! Wir versichern uns gegenseitig, dass das keine vernünftige bosnische Mutter ihrem Kind erlauben würde, da doch jeder weiß, dass man sich, wenn man mit nassen Haaren aus dem Haus geht, für gewöhnlich eine tödliche Gehirnentzündung zuzieht. An diesem Punkt bestätige ich meist, dass meine amerikanische Frau, obwohl sie Neurochirurgin ist – noch dazu Gehirnspezialistin! –, das auch macht. Alle am Tisch schütteln den Kopf, aus Besorgnis nicht nur über Gesundheit und Wohlergehen meiner Frau, sondern auch über die zweifelhaften Aussichten unserer interkulturellen Ehe. Irgendjemand erwähnt dann meistens noch das rätselhafte Fehlen von Zugluft in den Vereinigten Staaten: Die Amerikaner lassen alle ihre Fenster offen, auch wenn es zieht wie Hechtsuppe, obwohl doch jeder weiß, dass starke Zugluft eine Gehirnentzündung auslösen kann. Bei uns zu Hause betrachten wir frei strömende Luft mit Argwohn.
Beim Dessert wird unweigerlich über den Krieg gesprochen, zunächst im Hinblick auf Schlachten oder Massaker, von denen manche (wie ich zum Beispiel) nichts verstehen, weil sie die Gräuel nicht miterlebt haben. Schließlich kommt das Gespräch auf lustige Arten, dem Tod von der Schippe zu springen. Alles brüllt vor Lachen, und unsere Gäste, die kein Bosnisch sprechen, ahnen nicht, dass es in der amüsanten Geschichte etwa um die vielen Gerichte auf der Grundlage von Brennnesseln (Brennnesselpastete, Brennnesselpudding, Brennnesselsteak) oder um einen gewissen Salko geht, der den Überfall einer Tschetnik-Mörderbande überlebte, indem er sich tot stellte, und der jetzt dort drüben tanzt – und jemand zeigt auf ihn: der magere, sehnige Überlebende, der sein Hemd mit dem Schweiß glücklicher Auferstehung tränkt.
Im offiziellen Teil des Abends werden kulturelle Vielfalt, ethnische Toleranz und Allah gepriesen, und es gibt immer eine Reihe gravitätischer Ansprachen, gefolgt von einem Programm, in dem die gehirnentzündungsfreie Kunst und Kultur der bosnisch-herzegowinischen Menschen gefeiert werden. Ein Chor unterschiedlich großer und breiter Kinder (der mich immer an die Skyline von Chicago erinnert) plagt sich mit einem bosnischen Volkslied ab. Gehör und Akzent der Kinder sind durch ihre Teenagerzeit in Amerika unwiderruflich verändert. Sie tanzen auch, die Kids, unter dem wohlwollenden Blick eines schnurrbärtigen Tanzlehrers. Die Mädchen tragen Kopftücher, seidene Pluderhosen und kurze Westen, die ihre sprießenden Brüste betonen; die Jungen tragen Fese und Filzhosen. Keiner der Anwesenden hat jemals im richtigen Leben solche Kleider getragen; die Kostümphantasien sollen an eine ehrwürdige, von Unheil und Armut freie Vergangenheit erinnern. Ich beteilige mich an diesem Selbstbetrug; es macht mir sogar Spaß, dabei mitzuhelfen, denn wenigstens einmal im Jahr bin ich ein bosnischer Patriot. Wie alle anderen genieße ich die unverdiente Ehre, zu dieser Nation und nicht zu einer anderen zu gehören. Ich entscheide gern, wer sich uns anschließen darf, wer ausgeschlossen wird und wer uns als Gast willkommen ist. Die Tanzvorführung soll auch potenzielle amerikanische Wohltäter beeindrucken, die viel eher geneigt sind, karitatives Geld für die Unterstützung der Association of Bosnian-Americans lockerzumachen, wenn sie überzeugt sind, dass unsere Kultur ganz anders ist als ihre eigene, sie somit ihre Toleranz beweisen und dazu beitragen können, unsere unverständlichen Bräuche, da wir nun schon einmal hier sind und nie mehr weggehen werden, zu bewahren wie eine Fliege im Bernstein.
So saß ich am 3. März 2004 neben Bill Schuettler, dem Mann, der im unregelmäßigen Rhythmus des Tanzes mit einem Dessertlöffel an seine leere Bierflasche klopfte. Die Patrioten vom Organisationskomitee meinten, ich solle Bill und seine Frau mit meinem schriftstellerischen Erfolg und meinem Charme beeindrucken, denn die Schuettlers saßen im Vorstand der Glory Foundation und hatten deshalb Verfügungsgewalt über glorreiche Gelder jeder Art. Bill hatte meine Kolumnen nicht gelesen – offenbar war seine einzige Lektüre die Bibel –, aber er hatte mein Foto in der Chicago Tribune gesehen (zwei Mal!) und war deshalb von meiner Wichtigkeit überzeugt. Er war Banker im komfortablen Ruhestand und trug einen marineblauen Anzug, der ihm eine Aura von Admiralität verlieh. Er hatte funkelnde Manschettenknöpfe, die sich auf die Ringe an den arthritischen Klauen seiner Frau reimten. Ich mochte seine Frau – sie hieß Susie. Als Bill sich von seinem Stuhl hochhievte und zur Toilette watschelte, erzählte mir Susie, dass sie mehrere meiner Kolumnen gelesen habe und dass sie ihr gefallen hätten – es sei unglaublich, meinte sie, wie anders sich Dinge, die man gut kennt, aus dem Blickwinkel eines Ausländers darstellen. Deswegen lese sie so gern; sie wolle immer dazulernen; sie habe viele Bücher gelesen. Lesen sei ihr sogar lieber als Sex, sagte sie und zwinkerte mir komplizenhaft zu. Als Bill zurückkam und sich steif zwischen uns setzte, unterhielt ich mich weiter mit ihr, wie durch das Gitter eines Beichtstuhls.
Sie waren beide in den Siebzigern, aber Bill wirkte schon voll fürs Sterben gerüstet mit seinen künstlichen Hüftgelenken, den unauslöschlichen Altersflecken im Gesicht und dem Drang, sich durch Mildtätigkeit eine komfortable Eigentumswohnung im Jenseits zu sichern. Susie dagegen war noch nicht bereit für die Ewigkeit von Florida; sie besaß die gefräßige Neugier einer Collegestudentin in den unteren Semestern. Sie überschüttete mich (und mein Ego) mit Fragen und ließ nicht locker.
Ja, ich schreibe diese Kolumnen auf Englisch.
Ja, ich denke auf Englisch, aber manchmal auch auf Bosnisch; oft denke ich überhaupt nicht. (Sie warf lachend den Kopf zurück.)
Nein, meine Frau ist keine Bosnierin, sie ist Amerikanerin, sie heißt Mary.
Ja, ich konnte schon Englisch, bevor ich hierherkam. Ich habe einen akademischen Grad in englischer Sprache und Literatur von der Universität Sarajevo. Aber ich lerne immer noch.
Ich habe Englisch als Fremdsprache unterrichtet, und der Reader bat meine Chefin, jemanden zu empfehlen, der etwas über die Erfahrungen neu Eingewanderter erzählen könne. Sie empfahl mich, und seither schreibe ich die Kolumne.
Nein, es heißt nicht In der Heimat der Tapferen, es heißt Im Land der Freien.
Ich unterrichte nicht mehr Englisch als Fremdsprache. Ich schreibe nur noch die Kolumne für den Reader. Die Bezahlung ist nicht so toll, aber viele Leute lesen meine Sachen.
Ich habe den Plan, über einen jüdischen Immigranten zu schreiben, der vor hundert Jahren von der Chicagoer Polizei erschossen wurde. Ich bin bei meinen Recherchen für die Kolumne zufällig auf den Fall gestoßen.
Ich bewerbe mich um Stipendien, damit ich an meinem Buch arbeiten kann.
Nein, ich bin kein Jude. Mary auch nicht.
Ich bin auch weder Muslim noch Serbe oder Kroate.
Ich bin kompliziert.
Mary ist Neurochirurgin am Northwestern Hospital, sie hat heute Abend eine Operation.
Würden Sie gern tanzen, Mrs. Schuettler?
Danke.
Bosnisch ist keine ethnische Gruppe, sondern eine Staatsangehörigkeit.
Das ist eine lange Geschichte. Meine Urgroßeltern kamen nach Bosnien, nachdem das Kaiserreich Österreich-Ungarn es sich einverleibt hatte.
Vor einem Jahrhundert ungefähr. Das Reich ist längst zerfallen.
Ja, diese geschichtlichen Zusammenhänge sind ziemlich kompliziert. Deshalb würde ich gern dieses Buch schreiben.
Nein, ich wusste nicht, dass die Glory Foundation Bewerbungen um individuelle Stipendien entgegennimmt. Ich werde mich sehr gern bewerben.
Und ich würde Sie gern Susie nennen.
Möchten Sie tanzen, Susie?
Mit kesser Sohle beteiligten wir uns an dem ziemlich stupiden, aber einfachen Tanz, bei dem die Leute die Hände hochhalten, einen Kreis bilden und sich dann seitwärts bewegen, zwei Schritte nach rechts, einen Schritt nach links. Sie konnte es gleich, während ich, durch die unerwartete Aussicht auf ein Stipendium abgelenkt, nicht aufpasste und einen Schritt nach rechts und zwei nach links machte und ihr mehrmals auf die Zehen trat. Meine ältliche Freundin ertrug meine antirhythmischen Attacken mit stoischem Gleichmut, bis ich ihr beinahe den Fuß brach. Sie scherte aus dem Kreis aus, ihr Fuß rutschte aus dem Schuh, sie verzog vor Schmerz das Gesicht und hüpfte auf einem Bein herum. Der Strumpf bauschte sich an ihrer großen Zehe; sie hatte eine schmale Ferse und einen geschwollenen Knöchel. Ich bekam ihre flatternden Hände nicht zu fassen und ließ mich auf die Knie nieder, um mich ihrem verletzten Fuß gebührend zu widmen, was sie mir aber unmöglich machte, indem sie den Fuß ständig schnell bewegte. Für alle, die uns zuschauten, sah es so aus, als ob wir hingebungsvoll tanzten – sie einen einbeinigen Bauchtanz, ich in exaltierter Bewunderung ihrer Bewegungen –, und die Bosnier klatschten Beifall und kreischten vor Vergnügen. Ein Blitz flammte auf.
Als ich aufschaute, blendete mich ein zweiter Blitz, und ich sah den Fotografen nicht. Die Tanzenden umkreisten uns auf dem von Schweiß glitschigen Boden. Susie und ich waren die Glanznummer des Abends; ein junger Bosnier mit kompromisslos aufgeknöpftem Hemd ließ sich auf die Knie nieder, beugte sich zurück und schüttelte vor Susie seine behaarte Brust. Sie vergaß ihren Schmerz offenbar schlagartig, entledigte sich auch noch des anderen Schuhs und gab sich barfuß dem orgiastischen Brusthaargeschüttel hin. Ich kroch aus dem Kreis hinaus, niedergedrückt von dem Gefühl, mich wie der letzte Idiot benommen zu haben.
Später waren alle Bosnier im Organisationskomitee hocherfreut und lobten mich dafür, dass ich Susie zu einem unvergesslichen Erlebnis verholfen hatte, denn nun, da sie und Bill die ekstatischen Freuden der bosnischen Kultur kennengelernt hätten, stehe ein dicker Scheck ins Haus. Ich sagte ihnen nichts von der Aussicht auf ein individuelles Stipendium, die wie ein nagelneues Herz in meiner Brust schlug. Ich ließ mich nämlich von meiner Frau aushalten. In meiner Heimat hat Geld das Gesicht eines Mannes, aber bei uns brachte meine Frau das richtige Geld nach Hause, und Neurochirurgen, müssen Sie wissen, verdienen sehr viel Geld. Ich leistete nur einen symbolischen Beitrag zum Budget des Ehepaars Field-Brik: die paar lausigen Kröten für den Englischunterricht, bis ich dort rausflog, plus ein Scherflein pro Kolumne. Ein schönes Stipendium erschien vor meinem inneren Auge, ein phantastisches Stipendium, das es mir ermöglichen würde, unserer Ehe die Kosten und Mühen meiner Recherchen und meines Geschreibsels zu ersparen. Während die Menge der Tanzenden sich zu einem neuen Tanz verfestigte, schmiedete ich Pläne für ein entspanntes Mittagessen mit Susie – Bill würde sicher mit seiner Kirche beschäftigt sein oder wofür er sonst seine letzten Jahre verschwendete; ich würde mich von meiner charmantesten Seite zeigen, amüsante Geschichten von mir geben, ihr mein Projekt, meine Ideen, mein Schriftstellerherz zu Füßen legen; sie würde mir aufmerksam zuhören und einwilligen. Im richtigen Moment würde ich ihr vielleicht das Foto von unserem Beziehungstanz zeigen; sie würde lachen und den Kopf zurückwerfen, ich würde mitlachen und vielleicht ihre Hand zwischen den Weingläsern berühren; sie würde sich wieder jung fühlen und hinterher dafür sorgen, dass mein Stipendienantrag positiv beschieden wird. Und dann würde ich Mary beweisen, dass ich kein Tunichtgut, Faulenzer oder arbeitsscheuer Osteuropäer bin, sondern ein Mensch mit Begabung und Potenzial.
Um ehrlich zu sein: Ich bin kein willensstarker Typ, und ich bin auch keiner, der im Handumdrehen Entscheidungen fällt – Mary kann ein Lied davon singen. Doch am bosnischen Unabhängigkeitstag ging ich sofort daran, meinen Plan in die Tat umzusetzen. Als Erstes musste ich mir das Foto von Susie und mir beschaffen, und mit nicht allzu gebremster Entschlossenheit hielt ich in dem Gewühl Ausschau nach dem Fotografen. Über die weinroten Fese und wippenden Brüste, über die gelockerten Schlipse und Sitten, über die hüpfenden Kinder und kläglichen Reste cholesterinfroher Kuchen hinweg suchte ich nach dem Licht. Ich drängte mich durch die Menge, stieß mit den Ellbogen alte Damen und Teenager beiseite und fand schließlich den Fotografen vor einer Familie mit erwartungsvoll eingefrorenem Grinsen auf jedem Gesicht. Nach dem Blitz entgrinste sich das Tableau und zerstreute sich, und ich stand vor Rora.
Rora. Mich laust der Affe. Rora.
Das passiert mir andauernd: Ich treffe aus heiterem Himmel Leute, die ich in meinem früheren Leben, in Sarajevo, gekannt habe. Wir jaulen vor Begeisterung; wir küssen uns oder hauen uns gegenseitig auf den Rücken; wir tauschen grundlegende Infos aus und klatschen über gemeinsame Bekannte; wir versprechen uns in die Hand, dass wir uns bald mal zusammensetzen werden oder in Verbindung bleiben. Hinterher breche ich immer schier zusammen vor Traurigkeit, denn mir wird augenblicklich klar, dass sich alles, was uns jemals verband, in nichts aufgelöst hat; wir machen nur Gesten, absolvieren das Ritual des Wiedererkennens und tun so, als wären wir nur durch die Umstände getrennt worden. Der alte Film von der gemeinsamen Vergangenheit löst sich auf, wenn er dem Licht eines neuen Lebens ausgesetzt wird. Auch über diese Dinge habe ich schon geschrieben.
Als ich in dem Fotografen Rora erkannte, jaulte ich tatsächlich auf vor Überraschung, und ich küsste ihn auf die Wange oder klopfte ihm auf den Rücken. Aber er trat zur Seite, ignorierte meine Vertraulichkeiten und murmelte lediglich Šta ima?, als wären wir auf der Straße aneinander vorbeigegangen. Ich muss zugeben, ich war baff: Ich stellte mich vor. Ich bin Brik, sagte ich. Wir sind aufs selbe Gymnasium gegangen. Er nickte, fand es offensichtlich albern, dass ich glaubte, er würde sich vielleicht nicht an mich erinnern. Trotzdem, er dachte gar nicht daran, die Vergangenheit zu umarmen und sie mir auf den Rücken zu hauen; er hielt seine Canon mit dem Blitzgerät nach unten, wie eine Waffe, die gerade nicht gebraucht wird. Es war keine Digitalkamera, wie mir in meiner Verlegenheit auffiel.
Das ist keine Digitalkamera, sagte ich.
Was du nicht sagst. Natürlich ist das keine Digitalkamera.
Die Musik hörte auf; die Tänzer kehrten zu ihren Tischen zurück. Ich steckte in dieser peinlichen Situation, ich konnte nicht einfach weggehen, konnte der bosnischen Unabhängigkeit nicht den Rücken kehren, dem ganzen Kulturgetue, der durch Fremde verkörperten Vergangenheit, der durch Ausländer verkörperten Gegenwart, dem Geplauder mit Susie, dem Tanzen und Knien, dem Fluchtplan. Seltsam, wie man, wenn man einmal handelt, nicht mehr aufhören kann zu handeln.
Du hast also die Fotografie nie aufgegeben, sagte ich.
Ich hab im Krieg wieder damit angefangen, sagte er.
Was ich aus Erfahrung wusste: Wenn ich – der ich kurz davor weggegangen war und den ganzen Schlamassel verpasst hatte – einen Bosnier nach dem Krieg fragte, führte meine Frage zu einem langatmigen Monolog über die Schrecken des Krieges und meine Unfähigkeit zu verstehen, wie er wirklich war. Ich hatte mir selbst antrainiert, mich nicht in diese Situation zu begeben, doch diesmal fragte ich: Warst du während der ganzen Belagerung in Sarajevo?
Nein, sagte er. Nur, als es besonders schön war.
Ich bin im Frühjahr 1992 hierhergekommen, sagte ich ungefragt.
Da hast du Glück gehabt.
Ich wollte gerade widersprechen, als eine ganze Familie auf ihn zukam und ein Gruppenfoto verlangte: der stämmige, bebrillte Vater, die stämmige, kurzarmige Mutter, zwei stämmige Mädchen mit schimmernd gekämmtem Haar – sie stellten sich in einer Reihe auf, erstarrten und entblößten ihre stämmigen Zähne zur ewigen Erinnerung.
Rora.
Jeder, den ich aus Sarajevo kannte, war schon vor Jahrzehnten in mein Leben getreten; jeder, der nun wieder auftauchte, kam unweigerlich mit einem Sack voll trivialer Erinnerungen daher. Ich hatte Rora auf dem Gymnasium gut gekannt. In der Pause rauchten wir in der Toilette im zweiten Stock; die Kippen warfen wir in eine Lüftungsöffnung, die kein Gitter mehr hatte, und manchmal wetteten wir, wer hineintreffen oder danebenwerfen würde. Rora hatte für gewöhnlich dicht gestopfte Marlboros, die viel besser waren als das Dreckzeug, das wir rauchten – aus unerfindlichen Gründen waren diese Glimmstängel immer nach verschiedenen jugoslawischen Flüssen benannt, die im Frühjahr gern über die Ufer traten. Während in unseren Zigaretten – so ein weit verbreiteter Glaube – nur die Krümel waren, die bei Schichtende auf dem Fabrikboden zusammengekehrt wurden, mussten die Marlboros aus dem Ausland stammen. Sie schmeckten wie der schiere Überfluss, wie die Ernte im Milch-und-Honig-Land. Rora war immer bereit, seine Zigaretten mit uns zu teilen, aber nicht aus Großzügigkeit, sondern um uns von seinen neuesten Auslandsreisen erzählen und uns Bilder der fremden Länder zeigen zu können. Die meisten von uns fuhren in den Ferien immer noch mit ihren Eltern in langweilige Badeorte am Meer, und wir trauten uns nie, die Schule zu schwänzen, geschweige denn, allein ins Ausland zu fahren. Rora war uns ein Rätsel: Er verschwand einfach, ohne sich darum zu scheren, dass er die Schule versäumte, und nie bekam er einen Verweis oder eine andere Strafe. Es hieß, seine Eltern seien bei einem Autounfall ums Leben gekommen und er lebe bei seiner nicht viel älteren Schwester. Außerdem gab es noch alle möglichen anderen, viel weniger plausiblen Gerüchte: Sein Vater sei Spion beim militärischen Abwehrdienst gewesen, und seine alten Freunde kümmerten sich jetzt um Rora; er sei das uneheliche Kind eines Mitglieds des Zentralkomitees; er sei selbst ein Spion. Es fiel schwer, solche Geschichten ernst zu nehmen, doch wenn sie zu irgendwem passten, dann zu Rora. Die Kippenwette gewann immer er.
Er erzählte uns gern von der Zeit, als er im Cockpit einer Maschine nach London geflogen war: Als sie hoch über den Alpen waren, hatte der Pilot ihm eine Zeit lang den Steuerknüppel überlassen. In Schweden hatte er einen reservierten Platz im Bett einer älteren Frau, die ihn mit Geschenken überschüttete – er zog sein Hemd auf und ließ uns eine daumendicke Goldkette bewundern. Die Frau ließ ihn ihren Porsche fahren und hätte ihm den Wagen auch geschenkt, wenn er sie darum gebeten hätte; er zeigte uns ein Foto von dem Porsche. In Mailand hatte er beim Rommé so viel Geld gewonnen, dass er es auf der Stelle ausgeben musste, sonst hätten ihn die Leute, denen er es abgenommen hatte, gelyncht. Also lud er sie alle ins teuerste Restaurant der Welt ein, wo sie gebratene Affenaugen und Kebab von der Schwarzen Mamba aßen und zum Nachtisch der hinreißenden Kellnerin Honig von den Brüsten leckten. Zum Beweis zeigte er uns ein Foto vom Mailänder Dom. Obwohl wir seine Geschichten reichlich übertrieben fanden, glaubten wir ihm, weil es ihm anscheinend egal war, ob wir ihm glaubten oder nicht.
Das eine, woran ich mich aus dem Vorkriegs-Sarajevo erinnere und was mir seither fehlt, ist der stillschweigende Glaube daran, dass jeder das sein konnte, was er zu sein vorgab – jedes Leben, auch wenn es noch so phantastisch war, konnte von seinem rechtmäßigen, souveränen Besitzer beglaubigt werden, von innen heraus. Wenn einem jemand erzählte, er sei in einem Cockpit mitgeflogen, sei ein Teenager-Gigolo in Schweden gewesen oder habe Mamba-Kebabs gegessen, fiel es nicht schwer, ihm zu glauben; man konnte sich dafür entscheiden, seinen Geschichten zu glauben, weil sie so gut waren. Selbst wenn Rora log, selbst wenn ich nicht immer glaubte, dass sich die Dinge so abgespielt hatten, wie er sie erzählte, war er doch der Einzige, den man sich als Figur in diesen Geschichten denken konnte – er war der einzig mögliche Cockpit-Gigolo, der gern Mamba-Kebabs aß. Auch ich hatte, wie wir alle, einen Vorrat an unplausiblen Geschichten, in denen Menschen vorkamen, die ich gern wäre, und viele von meinen Geschichten waren Variationen über das jämmerliche Thema eines coolen, zynischen Schriftstellers. Außerdem entsprachen Roras Geschichten unseren gemeinsamen jugendlichen Träumen: Ich hatte ausführliche sexuelle Phantasien, in denen immer eine Schwedin vorkam. Rora lebte unsere Träume aus; wir wollten alle so sein wie er, weil er anders war als alle, die wir kannten.