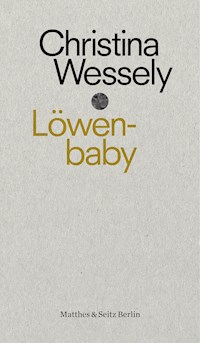Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein berührendes, essentielles Buch über das Frausein und die Brüchigkeit der Emanzipation Wenn Freundinnen sie nach ihrem Befinden fragen, verstummt sie. Seit der Geburt ihres Sohnes fühlt sie sich verloren, radikal fremdbestimmt und abgeschnitten von der Welt und ihrem alten Leben. Das winzige Kind ein Fremder, den zu lieben ihr kaum gelingen will. Warum scheint plötzlich all das, wovon sie – als Wissenschaftlerin, als Feministin, als Frau – überzeugt war, nicht mehr gültig zu sein? Christina Wessely erzählt die berührende Geschichte einer Mutterwerdung und verbindet dabei eindrucksvoll persönliche und essayistische Erkundung. Mit Intelligenz und Zärtlichkeit umreißt sie ihr Selbstverständnis als emanzipierte Frau – in Kollision mit gängigen Vorstellungen von Mutterschaft, Weiblichkeit und Liebe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Wenn Freundinnen sie nach ihrem Befinden fragen, verstummt sie. Seit der Geburt ihres Sohnes fühlt sie sich verloren, radikal fremdbestimmt und abgeschnitten von der Welt und ihrem alten Leben. Das winzige Kind ein Fremder, den zu lieben ihr kaum gelingen will. Warum scheint plötzlich all das, wovon sie — als Wissenschaftlerin, als Feministin, als Frau — überzeugt war, nicht mehr gültig zu sein? Christina Wessely erzählt die berührende Geschichte einer Mutterwerdung und verbindet dabei eindrucksvoll persönliche und essayistische Erkundung. Mit Intelligenz und Zärtlichkeit umreißt sie ihr Selbstverständnis als emanzipierte Frau — in Kollision mit gängigen Vorstellungen von Mutterschaft, Weiblichkeit und Liebe.
Christina Wessely
Liebesmühe
Hanser
für A.
Übersicht
Cover
Über das Buch
Titel
Über Christina Wessely
Impressum
Inhalt
Prolog: Schreiben
Zauber des Anfangs
Der Welt abhandenkommen
Diagnose
Leiden an der Gesellschaft
Mutter Natur
Die Freundin
Die Erfindung der Mutterliebe
Lichtungen
Epilog: Lesen
Literaturnachweise
Prolog: Schreiben
Ganz still sitzt sie da, um ihn nicht zu wecken. Die Beine dürfen nicht übereinandergeschlagen werden, schon der Versuch, sich ein Kissen unter den Ellenbogen, unter den schon schmerzenden Arm zu schieben, könnte seinen Schlaf stören. Sollte er aufwachen, müsste sie die letzte halbe Stunde wiederholen, das Wiegen, das Singen, das sanfte Schaukeln, immer in der Hoffnung, sich dann an der richtigen Stelle niederzulassen, um ihm und ihr selbst ein wenig Ruhe zu verschaffen. Die Wohnung ist ihr zum Meer geworden mit freundlichen und mit kargen Inseln darin. Nie weiß sie, auf welchem Teil des Archipels sie landen wird. Auf dem Sofa, auf dem sie schon vorab in ängstlicher Voraussicht das Buch deponiert hat, das aufzunehmen ihr, kleinste Bewegungen vollführend, gelingen könnte, um ganz ruhig zu lesen, die Seiten mit dem Mund umblätternd, denn die Hände müssen eng am Körper ihres Sohnes bleiben. Oder zumindest auf dem Sessel müsste sie anlanden, das Telefon in Reichweite ebenso wie die Decke, die sie, wenn es gelingt, um ihre kalten Füße wickeln könnte. Manchmal kommt es vor, dass das wenige Wochen alte Kind ungewöhnlich schnell einschläft, wenn sie die wiegenden, besungenen Bahnen, die sie zieht, eigentlich nur für kurze Momente auf einem kleinen Schemel unterbrechen wollte. Sie hat gelesen, dass Neugeborene eigentlich nicht einschlafen, sondern vom Schlaf übermannt werden; diese Tatsache gefällt ihr sehr, aber sie führt eben auch dazu, dass sie immer wieder an den falschen Plätzen strandet, an jenen, die nur als Zwischenstationen geeignet sind, nicht aber für den langen Aufenthalt. Dann sitzt sie da, oft starr und frierend, fernab von allem, was die Zeit verkürzen könnte.
Falsch: Die Zeit kann gar nicht verkürzt werden, denn sie ist ihr abhandengekommen. Zwar bemerkt sie, dass die Sonne aufgeht, gegen Mittag ihren höchsten Stand erreicht und schon am späten Nachmittag wieder untergeht, um vielen dunklen Stunden Platz zu machen, sie registriert den noch unregelmäßigen Rhythmus des Kindes aus Schlafen, Trinken und Wachen, aber dieser Wechsel gehört nicht mehr der Zeit der Geschichte an, die, gleichmäßig fließend, Ereignisse miteinander verbindet. Es ist die Zeit des Mythos, in deren endlosen Kreislauf sie mit seiner Geburt eingetreten ist. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind seit jenem Ereignis ununterscheidbar geworden. Was noch vor wenigen Wochen Geschichte war, stellt sich nun dar als Zyklus, ohne Anfang und ohne Ende. Kaum ist sie in der Lage, darüber nachzudenken, wie es gelingen könnte, den Kreislauf zu durchbrechen, kaum möglich ist es ihr, sich vorzustellen, wie diese Tage, die sie durchlebt, einer dem anderen gleich, in der Rückschau zu beurteilen sein werden: wie es gewesen sein wird. Selbst die grammatikalischen Formen, derer diese Gedanken bedürfen, sind für sie zu allegorischen Figuren wie aus dem antiken Epos geworden: Sie fesseln sie mit festen Zeitschnüren, verwehren Ausblicke in mögliche Welten mittels spiegelnder Oberflächen. Immer nur kann sie sich jetzt hier sitzen sehen, das Kind auf dem Arm. Der Konjunktiv als dunkler Gott der Möglichkeitsform, das Futur II als Satyr der abgeschlossenen Vergangenheit. Sein meckerndes Lachen klingt, wenn er sich ihr, uneinholbar, entzieht, frivol und höhnisch.
Das Kind war nicht mit der unmöglichen Aufgabe auf die Welt gekommen, die Leere im Leben seiner Mutter füllen zu müssen. Sie liebte ihre Freunde, kluge, warmherzige und lustvolle Menschen. Es gab die einen, mit denen man sich am frühen Samstagnachmittag auf einen Kaffee in einer der vielen türkischen Bäckereien traf, wo man von Kaffee mühelos auf Rotkäppchensekt umsteigen konnte, und mit denen man sich nach der langen Nacht in einem der Clubs am Wasser wieder in der Ausgangsbäckerei einfand, um sich bei Mettbrötchen und einem kleinen Bier auf Stunden vor dem Fernseher auf der Couch vorzubereiten, bevor man dann richtig ins Bett ging oder auch nicht. Endlose Tage, die nach Belieben gestaltet werden konnten. Mit anderen verabredete sie sich in verrauchten Kneipen, manchmal spielten sie Karten, meist aber blieb das abgegriffene Kartenspiel ungeöffnet vor ihnen auf dem Tisch liegen, und es wurde geredet und gelacht bis weit in die Nacht hinein.
Sie liebte den Mann, mit dem sie zusammen war — er war nicht der Bodenständigste, und er machte keine lebenslangen Versprechungen, aber das spielte noch keine Rolle, sie fand ihn schön und sehr lustig. Mit ihm konnte man zu zweit eine glamouröse Tanznacht in der Küche inszenieren, einfach so, spontan nach dem Abendessen, und er war ein fantastischer Liebhaber. Und sie liebte ihren Beruf, das Unterrichten ebenso wie die langen, staubigen Tage in Archiven und Bibliotheken und die wissenschaftlichen Konferenzen, auf denen sich viel zu lange Vorträge mit umständlichen Mitgliederversammlungen abwechselten und es jedes Mal ein herrliches Vergnügen war, gelegentlich eine Sektion gemeinsam mit Kolleginnen bei billigem Supermarktsekt im Park nebenan zu schwänzen. Sie liebte die Wochenenden auf dem Land, im Museum, in der Sauna, im Theater, im Restaurant, beim Joggen, Schlafen, Lesen, Tanzen. Und die Abende unter der Woche, wenn sie eigentlich müde war von der Arbeit, die dann aber doch so oft erst mitten in der Nacht endeten, doch noch ein Drink, noch eine Zigarette, aber vor neun musste sie fast nie aufstehen, also war das halb so schlimm. Wenn sie sich allerdings vorgestellt hatte, dass ihr Leben in fünf, zehn, zwanzig Jahren immer noch so aussehen könnte, hatte sie der kalte Schrecken überfallen. Diese Art, zu leben, alterte nicht gut, das war ihr bewusst gewesen, und bald würde sie verzweifelt sein. Alle anderen wären weitergegangen, hätten sich weiterentwickelt, nur sie hätte den Absprung verpasst — die Ängste einer Frau um die vierzig waren derartige kulturelle Gemeinplätze, dass es fast langweilig war, sie zu teilen. Das galt auch für ihre große Sehnsucht danach, für jemanden zu sorgen, die Sehnsucht nach Festigkeit, Unverhandelbarkeit und lebenslanger Dauer.
Sie hatte sich keine Illusionen über das Leben mit Kind gemacht, wusste, dass nicht alles Zirkus und Kasperltheater werden würde (obwohl sie sich in ihrer Vorstellung immer dort mit ihrem Sohn sah), aber dass sie von einem Moment auf den anderen in die Hölle der ewigen Wiederkehr geworfen sein würde, dass die Historizität ihres eigenen Daseins zugunsten eines solchen Naturzustandes, der keine Geschichte kennt, verschwinden würde, schockierte sie.
Vor dem Fenster der Erdgeschosswohnung fällt der Schnee. Sie sitzt auf dem Sofasesselschemel und stilltsingtwiegt. Wie immer. Das Display des Telefons — zum Glück in Reichweite — leuchtet bleich in die Nachmittagsdunkelheit. Sie hat die Nachrichten gelesen, die Modeblogs, hat einige Rezensionen zu literarischen Neuerscheinungen überflogen, die Wettervorhersage für die kommenden Tage zur Kenntnis genommen, die Fotos des Kindes angeschaut. Fast immer schläft es auf den Bildern, winzig, in bunte Tücher gepuckt. Das Kind, das sie nicht kennt. Sie weiß nicht, wer es ist. Kaum ein einfacher Satz könnte mehr Schrecken bergen. Ihr Kind hatte sie freudig erwartet, in die Arme gelegt hat man ihr einen fremden Menschen. Er hat die Füße und Zehen seines Vaters, das ist das einzige vage Erkennungszeichen dafür, dass er etwas mit den Menschen, die seine Eltern sein sollen, zu tun hat. Das scheint ihr zu wenig zu sein, und doch: Mit ihm ist sie von nun an verbunden. Mit einem Mal versteht sie das Wort Unentrinnbarkeit. Niemals hat ihr etwas mehr Angst eingejagt.
Sie möchte verstehen, was passiert ist, was gerade in diesem zur Unendlichkeit gedehnten Moment in ihrem Leben geschieht, aber da es zu verschwommen ist, um jemandem davon zu erzählen, erzählt sie es sich selbst. Noch kein Schreiben ist dieses Erzählen, sondern ein Sprechen, das ihr Mobiltelefon — erst vor Kurzem hat sie die Funktion Notizen entdeckt und dort das kleine Mikrofonsymbol neben dem Leerzeichen — in Schrift verwandelt.
»Ich spreche schreibe damit ich sehe dass etwas passiert damit etwas passiert«, lautet der erste Eintrag vom 10. September 2019 (sie hat noch nicht gelernt, dass sie die Kommas ansagen muss, das Sprachverarbeitungsprogramm setzt sie nicht von selbst), »wenn der Text geschrieben ist wird etwas anders sein.«
Der Satz ist gleichermaßen als Beschreibung der Tatsachen zu verstehen wie als Ausdruck des magischen Denkens, dem sie damit anhängt. Jeder Buchstabe, der auf dem Display erscheint, ist Zeuge vom Vergehen von Zeit. Wenn es auch nur Sekundenbruchteile sind, die es braucht, um durch ihr Sprechen ein Zeichen zu produzieren, formieren sich diese Zeichen zusammengenommen doch zu Minuten und Stunden. Jeder fertige Satz steht für zehn Sekunden, oder zwanzig, jeder Paragraph zeugt bereits von mehreren Minuten, die für sein Entstehen aufgewandt werden mussten. War ihr der Zusammenhang von Schrift und Zeit in ihrem bisherigen Leben als Autorin von Büchern, Aufsätzen, Vorlesungen, Gutachten und Forschungsanträgen meist als etwas Bedrohliches erschienen (die Deadline ständig zu nahe, fast immer meinte sie, für zu wenige Sätze zu viel Zeit aufgewandt zu haben), lernte sie ihn nun schätzen. Der Text ist die sichtbare, schwarz leuchtende Spur des Zeitstroms, dessen Fließen so evident wird. Jede Zeile bestätigt die Möglichkeit der Auflösung des mythischen Zustandes, lässt den Sieg des Logos über den Mythos denkbar werden und nährt so die Hoffnung auf die Rückgewinnung von Geschichtlichkeit. Das Schreiben gerät zu einer existenziellen Tätigkeit. Solange sie schreibt, ist sie und wird sie sein.
So sitzt sie da, in ihr Telefon flüsternd, und manchmal, wenn ihr Sohn seinen Schnuller ausgespuckt hat und sie weiß, dass er nun tief schläft und nicht mehr durch die kleinste Irritation wach wird, gibt sie das Sprechen auf und fängt an zu tippen, um dem Schreiben, wie sie es kennt, näherzukommen.
Sie verfasst ihre Notizen zunächst in der ersten Person, sie schreibt Ich; aber es funktioniert nicht richtig, sie kann das Erlebte und Gedachte nicht gut in Worte fassen. Wie soll das auch gehen, wenn das Ich so brüchig, so verzweifelt und unklar geworden ist? Dass sie sich nur noch als Umkehrbild derjenigen verstehen kann, die sie einmal war, scheint ihr logisch. Aber sosehr sie auch nach den Qualitäten des Positivs sucht, um das Negativ besser umreißen zu können, es gelingt nicht. Die Beschreibung ihres verlorenen Selbst gerät zur verzweifelten Aneinanderreihung der dümmsten und uninteressantesten Plattitüden und lässt sie zur Verkörperung eines nicht besonders erfolgreichen Profils auf einer Online-Partnerbörse werden, oder — das trifft den verzweifelten Versuch, sich selbst anhand stichwortartig formulierter Eigenschaften und Vorlieben zu beschreiben, vielleicht noch besser — zur Person hinter dem Eintrag in einem der Freundschaftsbücher, die in der Volksschule reihum gingen: Lesen, Schwimmen, Radfahren. Sie erkennt sich nicht mehr, weiß nicht, wer sie war, wer sie geworden ist und wie Vergangenheit und Gegenwart sich zu einer kaum vorstellbaren Zukunft verhalten könnten.
Der Wechsel in die dritte Person ist wie eine Erlösung, lässt er sie vor sich selbst doch immerhin als die Fremde dastehen, als die sie sich empfindet. Mit einem Mal ist das Schreiben wieder eine lange eingeübte, von ihr gut beherrschte Handlung — eine vertraute Praxis, die sie als Historikerin schon viele Jahre ausübt, um Fremdes zu beschreiben: Menschen, Phänomene und Dinge, die ihr zeitlich entzogen sind, von deren Wegen und Eigenschaften nur Reste vorliegen. Sie hat den Eindruck, als wäre diese neue Textproduktion in den ersten Wochen ihrer Mutterschaft ihrer altbekannten Arbeit recht ähnlich — Sinn zu machen aus dem Unverständlichen und Entlegenen —, und diese Einsicht beruhigt sie ungemein. Nun kann sie jenem Unvertrauten mit der vertrauten Geste des Schreibens kontern. Sie weiß, dass jeder Gegenstand, sei er noch so fremd, durch seine Beschreibung näher rückt. Was im Forschungsprozess als Gefahr gehandelt wird, was die souveräne Distanz der Historikerin ständig zu bedrohen scheint, sehnt sie nun geradezu herbei: die Intimität zwischen der Forschenden und ihrem Objekt, zwischen der Schreibenden und ihrem Gegenstand. Das Schreiben ist eine mächtige Geste der Aneignung, in der Lage, das Fremde in Vertrautes zu verwandeln. Und darum geht es jetzt, mehr als um alles andere: um das Bannen der Angst vor diesem neuen Leben, um die Erzeugung von Nähe.
Zauber des Anfangs
Schon seit Mai herrscht Badewetter, die Wochen vor der Entbindung hat sie beinahe ausschließlich an Seen, Flüssen und in Schwimmbädern verbracht, im Schatten von Kastanien, in kühlen Zimmern ruhend, an manchen späten Abenden, wenn die Temperaturen erträglich geworden waren, auf den großen freien Plätzen ihrer Heimatstadt. Das Kind sollte in Wien auf die Welt kommen, wo sie in den letzten Zügen der Schwangerschaft noch mit riesigem Bauch in der Alten Donau schwimmen, in den Neustifter Heurigen sitzen und im Prater spazieren konnte und wo für die Zeit danach ihre Eltern da sein würden und die meisten der alten Freunde, die versprochen hatten, vorbeizukommen, wenn das Baby auf der Welt sei, für einen kurzen Plausch und mit Marillenknödeln und Gulaschsuppe im Gepäck.
Jetzt, Anfang August, brennt die Sommersonne immer noch jeden Tag vom Himmel, aber das Wetter spielt keine Rolle mehr. Nur nachts, wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist und die Fenster ihres Zimmers im Krankenhaus gekippt sind, bauschen sich manchmal die Polyestervorhänge und geben eine Ahnung davon, dass es ein Draußen gibt, in dem die tropischen Nächte noch nicht vorüber sind. Drei Tage ist sie erst hier, aber es kommt ihr vor, als wäre sie längst aus diesem Sommer herausgetreten, aus ihm und aus der Welt, über die er sich legt. Vor zweiundsiebzig Stunden ist ihr Sohn geboren worden. Keine halbe Stunde hat sie seitdem für sich und den Kleinen gehabt. Keine halbe Stunde Ruhe, keine halbe Stunde, um zu sich zu kommen, das Kind zu betrachten und gemeinsam mit ihm zu beobachten, wie sich alles anfühlt. Schon nach wenigen Stunden waren ihre Brüste hart wie Stein geworden, ständig musste sie bereits im Kühlschrank des Schwesternzimmers vorbereitete, mit Topfen gefüllte Kompressen auflegen. Nach spätestens zehn Minuten waren sie warm, das Wasser rann an den Seiten ihres Körpers hinab, durchnässte das Bett, das daraufhin — »nur ganz kurz aufstehen bitte« — neu gemacht werden musste, gebückt vor Schmerzen, die von dem langen Schnitt oberhalb ihrer Scham in den ganzen Körper ausstrahlten, wartete sie daneben. Kaum lag sie wieder, das Neugeborene auf dem Bauch, kam eine Hebamme zur Tür herein. »You are a factory«, sagte sie am Morgen von Tag drei strahlend und aufmunternd, als wären es gute Nachrichten, sich binnen kürzester Zeit in eine Milchfabrik verwandelt zu haben. Das Kind, das direkt nach seiner Geburt gierig getrunken hatte, müsse sich allerdings an die nun viel größeren Brustwarzen erst gewöhnen, sagte eine andere, die erschien, kaum hatte ihre Kollegin das Zimmer verlassen. Stillhütchen — Wörter und Dinge, die sie nicht kannte und nicht kennenlernen wollte, umstellten sie, schon in der Schwangerschaft hatte sie der ganz selbstverständliche Umgang, das unverschämte Sprechen über Körperteile, die ganz fröhlich und im Gestus feministischer Verschwörung aus der Sphäre des Erotischen gerückt wurden, irritiert (die Aufforderung zu »vertrauensvollen Damm-Massagen«, die vom Vater des ungeborenen Kindes durchgeführt werden sollten, wie einschlägige Publikationen nahelegten, hielt sie zunächst für einen Witz) — könnten helfen, und daraufhin klebte ihr die robuste Frau umstandslos mit der eigenen Spucke befeuchtete Silikonkappen auf die Brustwarzen. Das hauchdünne Material wollte nicht haften, die Milch tropfte aus den Hohlräumen des Hütchens auf den Bauch, bevor das Kind davon trinken konnte. Eine Säuglingsschwester kam mit einer Handvoll Spritzen, in die sie Fencheltee füllte, den sie ihr in schmalen Rinnsalen über die Brüste rinnen ließ, damit das Kind schon anfangen konnte zu saugen, bevor die Muttermilch zu fließen begann. Minuten später betrat die Physiotherapeutin mit einem stacheligen Ball in Neongrün als Geschenk das Zimmer und zeigte ihr in einem Heftchen Rückbildungsübungen. Frauen mit aschblonden Bobs lagen oder knieten in mit türkisfarbenen Tüchern abgehängten Zimmern und zeigten vom österreichischen Gesundheitsministerium zertifizierte Trainingseinheiten. Bevor sie die Physiotherapeutin fragen konnte, wann damit begonnen werden sollte (musste?) und ob die Beratung kostenfrei sei — die Dame machte den Eindruck einer Tupperware-Verkäuferin, ohne dass deutlich wurde, worin ihr Angebot eigentlich bestand —, unterbrach sie eine Fotografin, die »stilvolle Bilder« von dem Neugeborenen anfertigen wollte. Jetzt sei es sehr günstig, sagte sie nach einem schnellen Blick auf das Baby, denn wenn die Kleinen schliefen, entstünden besonders süße Fotografien. Die Physiotherapeutin eilig herauskomplimentierend, schob sie resolut Tisch und Stühle beiseite, platzierte einen riesigen Pouf, den sie mit Seidentüchern umspannte (warum mussten eigentlich überall da, wo Babys waren, auch Tücher in Meeresfarben sein?), in der Zimmermitte und beschallte den Raum mit »White Noise« aus mitgebrachten Boxen — das garantiere einen entspannten Gesichtsausdruck des Kindes. Der Pfleger, der kurz darauf gemeinsam mit einer Reinigungskraft den Raum betrat, hatte die Schere dabei, mit einem winzigen blauen Band verziert, mit der der Vater ihres Kindes die Nabelschnur durchschnitten hatte. Mit einem großen Lächeln reichte er sie ihr. Verständnislos sah sie ihn an. Ob man damit auch Papier schneiden könne, fragte sie. Er lachte auf, als hätte sie einen Witz gemacht (das hatte sie nicht getan). Ein Souvenir, das immer an diesen Tag erinnern würde, man könne es zum Beispiel mit den anderen Memorabilia aus dem Krankenhaus (dem ersten Schnuller, dem winzigen Band, das sie dem Säugling um sein Fußgelenk gebunden hatten, um ihn eindeutig identifizieren zu können) in eine Box legen …
Sie legte keinen Wert auf die Schere, nahm sie aber dennoch entgegen, um nicht schon am zweiten Lebenstag ihres Sohnes als Rabenmutter gelten zu müssen.
Bereits achtundvierzig Stunden nach der Entbindung hatte sich unterhalb ihrer Nase eine Fieberblase gebildet, die von ihrer totalen Erschöpfung zeugte — einer Erschöpfung, die, wie sie erst viel später ahnen sollte, gar nicht so sehr von den Strapazen der Geburt herrührte, sondern eher von dem ununterbrochenen Strom kleiner und kleinster Verrichtungen, die offenbar am Neugeborenen vorgenommen werden mussten und für die Herausbildung des Mutterglücks notwendig zu sein schienen. Dabei machte es ihr, der Mutter, gar nicht den Eindruck, sonderlich viel zu brauchen. Von der nicht minder verdächtigen, pathetisch beschworenen Intuition der Mutter, die jetzt vielleicht tatsächlich geholfen hätte, war plötzlich keine Rede mehr.
»Wir müssen nach Hause«, sagte der Vater des Kindes, »dort wird alles besser.« Sie nickte. Ja, nach Hause.
Nun wartet sie also auf das letzte Gespräch mit dem Arzt und der Hebamme. Noch bevor der Mediziner — ein angenehmer und herzenswarmer Mann, den sie schätzt und dem sie vertraut — die Frage nach ihrem Befinden gestellt hat, fängt sie an zu weinen. Mein Leben ist vorbei, sagt sie schluchzend, ich möchte das nicht. Ich kann schon jetzt nicht mehr, ich erkenne mich selbst nicht mehr, nichts ist von mir geblieben. Doch, sie sei noch da, versichert der Arzt, es sei lediglich ein neuer Aspekt hinzugekommen. Sie sei mehr geworden, nicht weniger. Vielleicht könne sie es jetzt noch nicht sehen, das sei ganz normal; so wenige Tage nach der Entbindung stelle sich sehr häufig ein Stimmungstief ein. Er spricht von Baby Blues. Nach wenigen Tagen sei das meist vorbei, meist schon, wenn man daheim Zeit hätte, sich mehr auf das Baby einzulassen, als das in der Klinik möglich sei. Falls sich ihr Zustand nicht bessere, die Traurigkeit anhalte, könne sie sich an eine Spezialistin wenden. Worauf die Spezialistin spezialisiert ist, wird nicht ausgesprochen. So weit ist sie von einer Depression entfernt, dass niemand auch nur das Wort in den Mund nimmt.
Jetzt, am dritten Tag nach der Geburt des Kindes, vorübergehende Stimmungsschwankungen, bald alles bestens, so ein Kind ist ja die größte Freude im Leben überhaupt. Es werde also nicht nötig sein, aber oft gebe ja schon die Tatsache, eine Anlaufstelle zu haben, Sicherheit. Also greift er schnell zum Telefon, ruft die Spezialistin an, die in einem anderen Krankenhaus ordiniert, und fixiert einen Termin. Nächsten Montag, meine Kollegin weiß Bescheid. Sie können jederzeit absagen, Sie werden es ja wahrscheinlich gar nicht brauchen. Ein letztes Händeschütteln, das Allerbeste für Sie und Ihre kleine Familie.
Als der Arzt das Zimmer verlassen hat, fragt sie die Hebamme, was sie denn mit dem Baby machen solle, falls sie den Termin wahrnehmen müsse. Erst als die Hebamme sie verdutzt ansieht, merkt sie, dass die Frage sie verrückt wirken lassen muss. Dein Baby, antwortet die Frau nach einem kurzen Moment der Irritation strahlend, kommt ab jetzt überall hin mit, wo du hingehst.
Ihr wird schwarz vor Augen. Der Schrecken, den ihr dieser Satz einjagt, ist unermesslich.
*
Sie würde die Spezialistin gerne aufsuchen, denn die Traurigkeit ist längst nicht verflogen, hat sich ein paar Tage später, gut eine Woche nach der Geburt des Kindes, im Gegenteil noch eher verfestigt. Sie würde gerne wissen, ob sie alleine ist mit ihrem Schmerz, mit diesen falschen Gefühlen. Ist das noch normal?, würde sie gerne fragen, oder handelt es sich schon um eine pathologische Traurigkeit? Das Gespräch würde ihr ein wenig Sicherheit geben, glaubt sie, aber sobald sie sich den Weg ins Krankenhaus der Spezialistin vorstellt, weiß sie, dass er ihr verstellt ist. Das Packen der Tasche, die Fahrt durch die halbe Stadt, das Baby würde ständig wach werden (erst beim Aufbruch, dann bei der Ankunft in der Klinik), der Rhythmus (es gibt noch keinen) würde (falls es in vier Tagen schon einen geben sollte) verloren gehen. Wahrscheinlich müsste sie genau zu Beginn des Termins stillen (sie hat Berechnungen angestellt, auch an die Schwankungsbreite hat sie gedacht), wo sollte sie das tun? Würde es ein Wartezimmer geben? Sitzgelegenheiten in den Gängen? Was, wenn es gar nicht klappte mit dem Stillen? Sollte sie vorsorglich ein Fläschchen Fencheltee mitnehmen und die Spritzen, um den Trick der Säuglingsschwester anwenden zu können? Sollte die Milchpumpe auch mitgenommen werden, für den Fall, dass das Kind nicht trinken wollte? Wo könnte sie abpumpen? Was, wenn sie genau während des Abpumpens aufgerufen würde? Und wie würde sie das Kind überhaupt am geschicktesten befördern, im Arm, im Kinderwagen oder in der Trage? Was, wenn sich die einmal getroffene Wahl als falsch herausstellen würde? Die Sprechstunde der Spezialistin sei meist sehr voll, hatte der Arzt sie gewarnt, mit ein bisschen Wartezeit müsse sie rechnen. Wie sollte sie dort ein, vielleicht zwei Stunden verbringen mit dem Baby? Wo könnte sie es wickeln? Wie lange würden die Stilleinlagen reichen?
So groß der Wunsch nach einem Gespräch über die ausbleibende Freude, über das unheimliche Gefühl, von nun an mit einem gänzlich Fremden zusammenleben zu müssen, auch ist — bei gleichzeitiger jubilierender Freude ihres gesamten Umfelds, der sie wie taub gegenübersteht — es scheint ihr schlicht nicht möglich, diese Expedition anzutreten. Zu groß und zu zahlreich sind die Unwägbarkeiten. Zu groß die Aufgabe, zu unsicher, was passieren würde (dabei hat sie, auch das macht ihr Angst, sicher nicht einmal an alle Eventualitäten gedacht: Entscheidendes könnte ihr entgangen sein, jede Menge Unvorhergesehenes passieren). Entscheidungen, die andere vielleicht nicht einmal als solche bezeichnet hätten, die für andere Frauen ein kaum reflektierter Teil der neuen mütterlichen Praxis wären, türmen sich zu unüberwindlichen Hindernissen auf. Ein Mann und drei Großelternpaare, die über insgesamt vier Autos und sehr viel Zeit verfügen, reichen nicht, um ihr den Eindruck einer schier unüberwindlichen Aufgabe zu nehmen. Sie würde es nicht schaffen. Sie bleibt zu Hause, ohne den Termin abzusagen.
*
An einem warmen klaren Vormittag schreibt sie an Freunde und Kolleginnen, um von der Geburt des Kindes zu berichten. Den Konventionen entsprechend, möchte sie vom Überglücklichsein erzählen, vom Überwältigtsein, sehnt sich nach dem Einsatz von Superlativen, die ihr nicht gelingen wollen. Die Müdigkeit, die körperliche Versehrtheit, die so schmerzhafte Differenz zwischen dem, was sein sollte, was erwartet wird, und dem, was jetzt ist, erlauben keine euphorischen Zeilen, und sie respektiert diesen kleinen Menschen auch zu sehr, um ihr gemeinsames Leben mit Lügen zu beginnen. Die auf ihre daher recht nüchtern geratene Geburtsanzeige folgenden Glückwünsche nimmt sie gleichermaßen beschämt wie ungläubig entgegen: die Gratulantinnen und Gratulanten wissen vom Zauber dieser besonderen Zeit zu berichten, der möglichst genossen werden soll, ebenso wie die vielen fröhlichen Stunden beim gegenseitigen Kennenlernen. Genießt die wundervolle, gar nicht unanstrengende, aber so intensive Zeit des Anfangs, wünscht ein anderer, eine Dritte verlängert die nächsten Wochen, Monate gleich auf Jahre und Jahrzehnte! Je zahlreicher die Reaktionen eingehen, umso deutlicher wird, dass Genuss die Haltung ist, die einzunehmen offenbar allen gelungen war, die bereits Kinder haben, dass das Genießen die erste und hauptsächliche Tätigkeit ist, in der man sich zu üben hat, gegen allen Kraftaufwand, über alle Strapazen hinweg, die als minimale Hindernisse geschildert werden, als kaum ins Gewicht fallende Einschränkungen eines absoluten Glücks. Dass der Zauber des Anfangs sich ihr als Horror des Endes (ihres alten Lebens) darstellt, ahnt keiner der Freunde.
Ihr schwindelt vor lauter fröhlichen Ausrufezeichen. Sie versteht nicht einmal im Ansatz, wie Menschen, die ihr nahestehen, solche Zeilen schreiben können — Zeilen, die absolut nichts mit ihrem derzeitigen Leben zu tun haben. Ihre Lektüre entlarvt die Grundlage ihrer gesamten sozialen Existenz als falsch und verlogen. Denn nichts anderes als Lügen können diese Glückwünsche sein, ist es doch objektiv schrecklich: die Nächte, in denen sie alle drei Stunden geweckt wird, um das Baby zu stillen (und wenn es einmal länger schläft, muss sie ins Wohnzimmer trotten, mit harten, schmerzenden Brüsten die sterilisierte Milchpumpe zusammenbauen und in Gebrauch nehmen; meist wacht der Kleine bald danach auf und möchte trinken, dann produzieren ihre Brüste noch mehr Milch, die Intervalle werden immer kürzer, immer häufiger ist sie auf den Durst des Kindes angewiesen, der ihr gleichzeitig den Schlaf