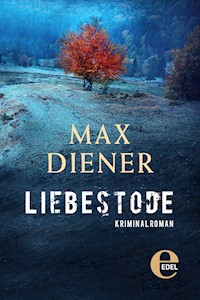
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Eine Marathonläuferin liegt tot in ihrer Wohnung. Bei der Obduktion der Leiche kommt man zu dem Ergebnis, dass die Frau an Herzversagen gestorben ist. Doch die Todesumstände veranlassen Hauptkommissar Castro, weiter zu ermitteln – und er entdeckt eine Reihe plötzlicher Herztode bei trainierten Läuferinnen. Alle Frauen waren zwischen dreißig und vierzig Jahre alt, in ihren Berufen erfolgreich, alleinstehend. Und sie litten, wie sich nach ihrem Tod herausstellte, unter einem Herzproblem. Aber es gibt noch eine weitere Gemeinsamkeit: einen geheimnisvollen Liebhaber – sowie Hinterbliebene, die auf Rache sinnen… Hier finden Sie den Link zum Buchtrailer: youtube.com/watch?v=kUHQ8x3UZ_4
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Copyright dieser Ausgabe © 2014 by Edel eBooks, einem Verlag der Edel Germany GmbH, Hamburg.
Copyright © 2014 by Max Diener
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Jouve
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
eISBN 978-3-95530-448-5
Inhaltsverzeichnis
I
Flacher Nebel über dem Wasser. Der Sonnenball aus geschmolzenem Glas, das kurz gemähte Gras links und rechts des Wegs feucht vom Tau. Die wenigen Läufer, denen er am See begegnet, in Trainingsanzügen versteckt. Einer wie der andere geschlechtslos, blicklos, jeder wie festgeklebt an den Rändern nächtlicher Träume.
Bereits nach wenigen Schritten bricht dem Läufer der Schweiß aus. Er weiß, was in diesem Moment mit seinem Körper geschieht: Das LDL-Cholesterin im Blut verringert sich, die Mitochondrien in den Muskelgewebezellen nehmen zu, die Sauerstoffversorgung nähert sich mit jedem gelaufenen Meter ihrem Optimum. Am Ende werden die Endorphine zusammen mit den bestens durchbluteten Organen und Muskeln eine perfekte Sympathikolyse bewirkt haben. Medizinische Laien würden es eine Harmonisierung des vegetativen Nervensystems nennen. Oder kurz: Laufen macht gute Laune. Mit diesem Satz hat er einmal – erfolglos – seinen schwergewichtigen Chef von den gesundheitlichen Segnungen regelmäßigen Joggens überzeugen wollen.
Wäre da nur nicht der verdammte Schweiß. Der Läufer hasst die olfaktorische Beleidigung, er hasst die feuchte Nässe, die Hemd und Hose schon nach einigen Hundert Metern am Körper kleben lässt. Wäre es möglich, würde er aus seiner Haut schlüpfen, würde die stinkende Hülle aus Epidermis und Corium hinaus in die Weite werfen und zusehen, wie sie zwischen den Wasserpflanzen versinkt, die große Teile des Sees bedecken.
Wie immer beschleunigt der Läufer unter der Autobahnbrücke. Genau an dieser Stelle hat sich vor einigen Wochen einer aufgehängt. Schwebte in der Frühe gut zwei Meter über dem asphaltierten Spazierweg. Das zum Himmel gewandte Gesicht entspannt, fast friedlich, die Zunge kaum zu sehen. Ein junger Mensch, vielleicht zwanzig, höchstens fünfundzwanzig Jahre alt. Gelbe Turnschuhe, gelbes Sweatshirt, goldene Ringe in beiden Ohren. Der Mann schien an alles gedacht zu haben, als er beschlossen hatte, sich das Genick zu brechen, statt qualvoll zu ersticken: an Beschaffenheit und Länge des Seils, an die Position des Knotens in seinem Nacken, an die Absprunghöhe. Ein Jogger mit Handy hatte damals die Rettung alarmiert. Der Läufer hatte sich davongemacht.
In der Nähe der Anlegestelle für die Ausflugsboote am Südufer des Sees kommt ihm eine Frau mit Hund entgegen. Es ist ein junger Foxterrier, das Tier sucht im Gras und Unterholz nach Maulwurfslöchern und Kaninchenverstecken. Der Hund kümmert sich nicht um ihn, wie es aussieht, scheint er an die flüchtigen Gestalten gewöhnt zu sein.
Der Läufer mag noch zwanzig Schritte entfernt sein, da schaut die Frau ihn an. Ein hübsches Gesicht, wie es die meisten joggenden Männer gern in den Tag mitnehmen: schräg stehende Augen, deutlich asiatisch, und eine längliche Narbe wie die Spur eines Messers auf der ungewöhnlich hohen Stirn. Die Spaziergängerin hat Ähnlichkeit mit einer alten Schulfreundin des Läufers. Anne hieß sie. Anne Kötter. Sie hatte Schauspielerin werden wollen, er hat nie erfahren, was daraus geworden ist. Kann sein, sie ist inzwischen eine brave Hausfrau mit vier Kindern und Gattin eines Oberstudienrats für Deutsch und Erdkunde, der wenig inspiriert die Theater-AG des örtlichen Gymnasiums leitet. Oder verwechselt er Anne Kötter mit Helen? Helen Riedmöller, die sich besonders gern und in der Regel erfolgreich an schüchterne Referendare herangemacht hatte? In der letzten Zeit fällt es ihm zunehmend schwer, sich zu erinnern, es erschöpft ihn wie das Laufen bei Gegenwind. An manchen Tagen breitet sich das Vergessen wie ein nasser, nach Verfall stinkender Mantel über seine Vergangenheit.
Jetzt lächelt die Frau. Wendet ihren Blick nicht ab, wie es viele Spaziergängerinnen und Läuferinnen tun, denen er um diese frühe Stunde am See begegnet. Du bist in Wirklichkeit gar nicht da, wollen sie mit ihrer Geste sagen. Wenn ich dich nicht ansehe, bist du nichts als der flüchtige Schatten eines Baums. Und wenn es dich nicht gibt, brauche ich mich auch nicht vor dir zu fürchten.
Aber die Frau mit dem Hund ist nicht so. Sie lächelt ihn an. Zaghaft zuerst. Unsicher. Mit einem fast unmerklichen Heben der Mundwinkel. Vielleicht soll das Lächeln ihre Angst vertreiben. Die Angst, die sie wie ein Hintergrundrauschen auf ihren Spaziergängen begleitet. Die Angst, die sie vor ein paar Jahren den Hund hat kaufen lassen. Die Angst vor dem, was sie sich nicht vorstellen will. Obwohl sie manchmal davon träumt. Das tun sie doch alle.
Mit jedem Schritt, den der Läufer näher kommt, wird das Lächeln breiter. Die Frau wirkt sicherer als in den Sekunden zuvor, befiehlt nicht einmal den Hund zu sich. „Guten Morgen“, ruft sie dem Läufer entgegen. Und: „Kalt heute, was?“
Er nickt und ist schon vorbei. Hinter einer lang gezogenen Linkskurve führt der Weg über eine kleine Brücke zurück zum Stauwehr. Der Läufer will nicht sprechen, schon gar nicht an diesem Morgen. Er will nicht stehen bleiben. Will nur laufen. Damit es endlich wieder still wird in ihm. Still wie der Tod.
Niemand sollte im Spätsommer sterben, nicht an einem Tag wie diesem: der Himmel über der Stadt blauer Samt, der Wind reine Seide, die Birnen- und Apfelbäume in den Vorgärten voll schwerer Früchte. Durch das offene Fenster dringt der Geruch frischer Erde herein, das Geräusch eines Baggers ist zu hören. Eine Frau, noch nicht alt, hat es geheißen, er ist mit ein paar Kollegen gleich hingefahren. Jetzt sitzt Castro im Schlafzimmer der Toten: den Kopf zur Seite geneigt, die Augen geschlossen, Kinn und Schläfe auf Daumen und Zeigefinger gestützt. Er denkt, sollte man meinen. Er grübelt über das nach, was er gerade zu sehen bekommen hat.
Castro denkt, das lässt sich nicht bestreiten. Oder besser: Er hat gerade damit angefangen – ungeordnet, sprunghaft, wie ein Motor, der nicht recht in Gang kommen will. Niemand in seiner Umgebung ahnt, dass er sich fürchtet, sobald es in ihm zu denken beginnt. Vor dem Unmöglichen, das möglich werden könnte. Vor den Antworten, für die er keine Fragen hat. Vor den Überraschungen, die keine wären, wären ihm nur beizeiten die richtigen Fragen eingefallen. Wenn Castro sich schließlich doch von seinen Gedanken treiben lässt, denkt er sogar die Satzzeichen mit. Dann fühlt er sich sicherer, irgendwie. Die eigentlichen Ermittlungen überlässt er gern den Kollegen von der Spurensicherung. Den Computerexperten. Den Gerichtsmedizinern. Den Madensuchern. Manchmal haben die Weißkittel die Fälle aufgeklärt, bevor er auch nur einen ersten vernünftigen Gedanken gefasst hat. Dann freut er sich. Dann geht es ihm gut.
Doch es gibt Tage – es sind übers Jahr gesehen nicht viele, aber es gibt sie –, da brennt es in Castros Kopf. Da muss er denken, vielleicht gerade weil er nicht will. Da hockt er in seinem Büro, die Augen geschlossen, das Kinn in die Hand gestützt, und brütet. Stundenlang. Auch wenn die anderen hereinkommen und sagen: Beweg deinen Arsch, Castro. Lass uns unsere Arbeit machen, wir kriegen das schon hin. Noch eine Woche, und du kannst den Fall zu den Akten legen. Routine, Castro, Routine ist alles, das weißt du doch mindestens so gut wie wir.
Man hat die Frau tot in ihrem Bett gefunden. Kostweg 3, zweiter Stock, erste Tür links. Von den bodentiefen Sprossenfenstern aus geht der Blick hinüber zu den Ausläufern des Stadtparks, zu den Jugendstil- und Gründerzeitvillen, zu der vom Rost gefärbten baumhohen Senna-Skulptur und den ehemals weißen Parkbänken. Es ist eine der besseren Gegenden der Stadt: edle Restaurants, Spezialitätengeschäfte, eine Buchhandlung für Kunst und Architektur, ein Laden mit ausgefallenen Wohnaccessoires. Obwohl das Stadtzentrum nur ein paar Steinwürfe entfernt liegt, herrscht in den Straßen rund um den Park eine angenehme Stille. Castros Frau hat davon geträumt, hierherzuziehen. Für eine Dreizimmerwohnung in einem der gepflegten Häuser ginge sie sogar putzen, hatte sie gesagt. Damals, als sie nach einer Bleibe für die nächsten Jahre gesucht hatten, als sie noch nichts von ihrer Krankheit wusste.
Bisher haben Castro und seine Kollegen keine Spuren einer gewaltsamen Auseinandersetzung entdeckt, auf den ersten Blick deutet nichts auf ein Verbrechen hin. Natürlicher Tod, hat der Doktor nach einer ersten oberflächlichen Untersuchung gesagt. Passiert nicht oft in dem Alter, kommt aber vor. Die Putzfrau hat sie alarmiert, eine korpulente Moldawierin mit unvollständigem Gebiss und unbeholfener Zunge. Der Krankenwagen hat die Frau ins benachbarte Hospital bringen müssen. Der Schock hat sie versteinern lassen. Obwohl sich Castro bei der Vernehmung Zeit gelassen hat, ist sie zu keiner vernünftigen Aussage fähig gewesen.
Das breite Futon-Bett mit den glänzenden bordeauxroten Satinbezügen, auf dem sie die Tote gefunden haben, ist zerwühlt; Laufshirt, Lauf-BH und weiße Frotteesocken liegen auf dem Stuhl neben einer schwarz-blau lackierten Kommode. Über allem hängt der schwache Geruch frischen Schweißes. Oder doch nicht? Löst der Anblick der Laufsachen fast automatisch eine Geruchshalluzination aus? Es gibt Theorien, dass genau das geschieht. Castro schüttelt den Kopf. Es ist wie immer: Er beschäftigt sich mit Nebensächlichkeiten, anstatt systematisch vorzugehen.
Eine Läuferin also. Die Haut an Armen und Beinen bis zu Schultern und Gesäß gebräunt, die Muskulatur im Ober- und Unterschenkelbereich wie nicht anders zu erwarten gut entwickelt, der sehnige Körper leicht untergewichtig. Kurze blonde Haare, ein wenig dünn vielleicht. Das im Tod wie geschrumpft wirkende Gesicht bis auf die sternförmigen Falten an Mund und Augenwinkeln glatt, die geöffneten Lippen schmal über ebenmäßigen weißen Zähnen. Kleine Brüste, am Bauch eine Blinddarmnarbe. Die Scham sorgfältig rasiert, ältere blaue Flecken an den Knien, eine frische Blutblase am rechten großen Zeh, Hornhäute unter den Fußsohlen. Die Augen noch halb geöffnet, Castro glaubt in ihnen eine Mischung aus Verwunderung und Wut lesen zu können. Unsinn, denkt er dann, während er sich aufrichtet, wir sehen in den Gesichtern von Toten nur, was wir sehen wollen. Das wird immer so sein, sogar bei einem Profi wie ihm.
„Die Dame gefällt dir,“ stellt der Doktor fest, während er nach seiner Arzttasche greift. „Stehst auf Knochige, was, Castro? Möchte fast wetten, die Tote hatte eine nicht diagnostizierte Herzmuskelentzündung. Verschleppte Grippe oder so. Werden wir schon rauskriegen. Wäre besser zu Hause geblieben, die Schöne, hätte nicht laufen sollen. Sport ist Mord, findest du nicht auch? Und nichts für ungut, mein Lieber.“
Alle gehen mit dem Arzt hinaus, die beiden Bestatter mit der Leiche zuerst. Castro bleibt in der von einem Moment zum anderen wie ausgeweidet wirkenden Wohnung zurück. In der zum Esszimmer hin offenen Küche riecht es immer noch nach frisch aufgebrühtem Kaffee, getoastetem Brot und gebratenem Ei. Merkwürdig, dass die Frau vor ihrem Tod alle Spuren des Frühstücks beseitigt hat. Oder hat jemand aufgeräumt und abgewaschen, den die Frau vom Laufen mitgebracht hat? Die moldawische Putzfrau jedenfalls hat nichts angerührt, zumindest das hat Castro ihr entlocken können, bevor man sie ins Krankenhaus gebracht hat. In Anbetracht des Schocks, ihre Arbeitgeberin tot im Bett gefunden zu haben, glaubt er der Frau.
Die Möbel im Raum lassen die ordnende Hand eines Innenarchitekten erkennen: die meisten Stücke in modernem italienischem Design, dazu einige ausgewählte Antiquitäten; ein zierlicher Sekretär aus Kirschholz, ein Empire-Tischchen, eine Jugendstillampe über einem gläsernen Esstisch. Eine schöne Wohnung, eine Wohnung wie aus einer Wohnzeitschrift. Aber kalt – wie die Frau, die sie jetzt in die Pathologie bringen.
Castro greift in die Tasche seines Jacketts und zieht den Personalausweis heraus, den sie in der schwarzen Lackhandtasche neben der Garderobe gefunden haben: Felicitas Weinbrenner, 37 Jahre alt, 165 cm, Augenfarbe blau. Auf dem Passbild ist sie ungeschminkt und trägt die blonden Haare lang. Castro mag solche Frauen, die ihre Weiblichkeit nicht vor sich hertragen, der Doktor hat mit seiner Vermutung richtiggelegen.
Irgendwann – er könnte nicht sagen, ob zehn Minuten oder zwei Stunden vergangen sind, seit ihn seine Kollegen verlassen haben, in solchen Momenten verlässt ihn das Zeitgefühl – geht er ein letztes Mal durch die Wohnung. Siebzig Quadratmeter vielleicht, eher weniger. Weiße Marmorböden, elektrische Rollos, Fußbodenheizung, hochwertige Armaturen in Bad und Küche, eine offenbar neue schwarz-weiße Markise über dem Balkon. Accessoires, die gut und teuer sind. Felicitas Weinbrenner hat, wie es aussieht, allein gewohnt. Wenn Menschen allein sind, sterben sie früher, hat Castro neulich gelesen. Vielleicht hat es ihm auch jemand erzählt.
II
„Woran ist die Weinbrenner gestorben?“, fragt Castro. Er hat in der Nacht unruhig geschlafen, ist schon in aller Frühe aufgewacht. Die Tote hat ihm nicht aus dem Kopf gehen wollen. Früher ist das ein untrügliches Zeichen gewesen, dass etwas nicht stimmte, dass der erste Augenschein bei einer Tatortbesichtigung getrogen hat. Heute weiß er die Zeichen nicht mehr so leicht zu deuten.
„Natürlicher Tod“, antwortet der Doktor. „Wie ich mir schon gedacht hatte.“
„Natürlicher Tod?“, fragt Castro und schiebt den Aschenbecher, den der Doktor aus der Klinik mitgebracht hat, von sich weg. Der Mann ist der Einzige, der sich über das Rauchverbot, das im Präsidium gilt, hinwegsetzt. „Gibt’s den überhaupt?“
„Keine philosophischen Exkurse, wenn ich bitten darf“, knurrt der Doktor und saugt an seiner nahezu abgebrannten Zigarette. „Sonst immer gern, das weißt du, aber nicht um diese Zeit.“
„Und weiter?“, fragt Castro.
„Myokarditis mit nachfolgender Koronarinsuffizienz“, antwortet der Doktor. „Oder für einen medizinischen Ignoranten wie dich: eine Herzmuskelentzündung, die eine Schwächung des Herzens zur Folge hatte. Vermutlich nach einer nicht vollständig auskurierten Grippe. Hat sich schlicht übernommen, die Kleine. Läufertod, haben wir nicht das erste Mal. Trifft aber selten Frauen. Eigentlich sogar höchst selten, ich kann mich nur an ganz wenige Fälle erinnern. Wir Männer sind diejenigen, die nicht auf sich aufpassen. Unser Stammhirn ist noch auf Steinzeitniveau. Der Säbelzahntiger ist hinter uns her, und wir rennen um unser Leben – zweiundvierzig Kilometer, wenn es sein muss. Scheiße, Castro, jetzt bin ich doch philosophisch geworden.“
Er drückt seine Zigarette aus. Seine kräftigen Finger mit den vom Nikotin gefärbten Nägeln zittern ein wenig. „Wie hieß die Tote noch mal?“
„Felicitas Weinbrenner“, sagt Castro.
„Willst du wissen, was sie gefrühstückt hat?“, fragt der Arzt, ein schlaksiger Kerl, kaum älter als Castro.
„Toast, Ei, Kaffee.“
„Kannst du hellsehen?“
Castro nickt. „Ist das alles?“
„Die Dame hatte vor ihrem Tod Geschlechtsverkehr“, antwortet der Arzt.
„Unmittelbar vorher?“
„Sieht so aus.“
„Kann es sein, dass sie dabei gestorben ist? Ich meine, während sie ...“
„Du meinst, während sie sich der Liebe hingegeben hat? Das werden wir wahrscheinlich nie wissen“, unterbricht der Doktor Castro. „Ein wunderbarer Tod übrigens, wenn du mich fragst. Man könnte glatt neidisch werden, findest du nicht auch? Ein letzter erstklassiger Orgasmus – und Exitus.“
„Habt ihr Samen in der Scheide gefunden?“
„Nein. Latex-Abrieb.“
„Von einem Kondom?“
„Wovon sonst?!“ Der Arzt steht auf. Träge, wie er sich durch den Raum bewegt, scheint er mindestens so müde zu sein wie Castro. In der Tür dreht er sich noch einmal um. „Felicitas Weinbrenner – komischer Name“, murmelt er.
„Findest du?“
„Klingt irgendwie bayerisch, oder? Wann brauchst du meinen Bericht?“
Castro zögert. „Hast du wirklich alles untersucht?“
„Na, hör mal!“
„Ich verstehe einiges nicht“, erklärt Castro. „Vielleicht musst du noch mal ran.“
Der Doktor gähnt. „Dein Wille geschehe. Gib mir Bescheid, wenn wir die Leiche freigeben können, ja?“
Kaum ist der Arzt gegangen, öffnet sich die Tür erneut. Es ist Overbeck, Castros Chef. Seit seinem siebzehnten Lebensjahr Mitglied einer großen christlichen Partei. Träumt von einem Landtagsmandat. Für den Anfang. Dazu ein hervorragender Karatekämpfer, 3. Dan. Ein schwieriger Mensch, aber beliebt bei seinen Leuten. Hält ihnen den Rücken frei, wann immer es nötig ist. Zu Castro hat er eine besondere Beziehung. Eine merkwürdige Mischung aus ehrlicher Bewunderung und verbissener Konkurrenz. Anders als Castro ist Overbeck ein überzeugter Teamplayer – ein Unterschied, den er bei jeder Gelegenheit zu betonen pflegt.
„Wie weit seid ihr?“, will Overbeck wissen.
„Sie haben die Frau obduziert. Felicitas Weinbrenner hatte eine Herzmuskelentzündung. Der Doktor geht von einem natürlichen Tod aus.“
„Was glaubst du, Castro?“, fragt Overbeck. „Du bist mal wieder nicht einverstanden, das sehe ich dir an.“
Vor dem Fenster streiten ein paar Spatzen. Aus dem Gebäude der Wilhelm-Busch-Grundschule schräg gegenüber tönt durchdringendes Pausengeschrei.
„Was glaubst du, Castro?“, wiederholt Overbeck seine Frage.
Soll Castro ihm erzählen, dass er misstrauisch geworden ist, weil der Fall zu eindeutig aussieht, zu glatt, zu perfekt? Dass er nicht verstehen kann, dass zwei Menschen das Frühstücksgeschirr spülen, bevor sie miteinander ins Bett gehen, um sich der Liebe hinzugeben, wie der Doktor es nennt? Dass er nicht begreift, wie jemand die Wohnung aufräumen kann, während seine Freundin tot oder sterbend auf dem Bett liegt? Dass es ihm nicht in den Kopf will, dass der Unbekannte nicht auf die Idee gekommen ist, einen Arzt zu rufen? Soll er Overbeck verraten, dass ihm die Tote einfach keine Ruhe lässt, weil ihre Wohnung nach Einsamkeit gerochen hat, obwohl sich dort gerade zwei Menschen geliebt hatten? Der Chef würde Castro nicht zum ersten Mal für verrückt erklären. Overbeck ist ein erklärter Freund von Routine, von Elektronenmikroskopen und EDV.
„Ich bin mir nicht sicher“, antwortet Castro.
„Auch eine Antwort“, sagt Overbeck. „Gibt es irgendwelche Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden?“
„Bis jetzt nicht.“
„Gar keine?“
Castro schüttelt den Kopf. Er könnte es sich bequem machen: Abschlussbericht, Unterschrift, fertig. Aber da ist noch was in seinem Kopf. Es ist, als stießen die Gedanken wie in einem Kugelspiel zusammen, als schickten diese Zusammenstöße Impulse aus, die ihm einfach keine Ruhe lassen.
„Dann schließ den Fall ab.“ Overbecks Bassstimme reißt Castro aus seinen Gedanken. „Was ist mit Angehörigen? Eltern? Verwandten? Freunden?“
„Ich kümmere mich darum.“
Friederike Weinbrenner wohnt in einem Mehrfamilienhaus am südlichen Stadtrand. Vom Parkplatz hinter dem Gebäude springt der Blick zu den bewaldeten Hügeln gegenüber. Das neu eingedeckte Dach der alten Raubritterburg explodiert in der Septembersonne, das unregelmäßige Stampfen einer Schrottpresse dröhnt aus dem Flusstal herauf. Der böige Wind kommt aus Südwest. Die Geräusche der nahen Autobahn sind nicht zu hören.
„Ja?“, ertönt eine weibliche Stimme aus dem Lautsprecher neben der Tür.
„Mein Name ist Castro. Hauptkommissar Castro. Wir haben telefoniert.“
Friederike Weinbrenner – er ist fast erschrocken über die Ähnlichkeit der Frau mit ihrer toten Schwester. Die gleiche zierliche Figur, der bis auf unwesentliche Nuancen gleiche Haarschnitt, die gleichen ebenmäßigen Zähne unter schmalen Lippen.
„Bevor Sie fragen: Wir sind Zwillinge“, sagt sie, nachdem sie ihn hereingelassen hat. „Eineiig.“
„Was ist mit Fee?“, fragt sie, nachdem sie sich gesetzt haben. Um ihn herum helle gemütliche Kiefermöbel, bunte Kissen, Kunstzeitschriften und Bücher auf dem Boden, afrikanische Masken an den Wänden. Kein Fernseher, nicht einmal eine Stereoanlage. Zumindest was ihren Geschmack anging, scheinen sich die Schwestern in unterschiedliche Richtungen entwickelt zu haben.
„Sie wollten mich wegen Felicitas sprechen“, sagt Friederike Weinbrenner, weil Castro schweigt. „Wegen meiner Zwillingsschwester.“
„Ja“, sagt er und stockt. Das Stocken gehört dazu. Immer. Zumindest bei ihm.
„Hat Fee etwas angestellt?“, fragt Friederike und lächelt.
„Ihre Schwester ist tot.“
So kann man das nicht sagen, denkt er, während er Friederike Weinbrenner beobachtet. Buchstabe für Buchstabe, Wort für Wort falsch. Es gibt überhaupt keine Worte für das. Nirgendwo auf der Welt.
Der Körper der Frau strafft sich, das Lächeln fällt ihr wie ein toter Vogel aus dem Gesicht. Friederike Weinbrenner schiebt das Kinn nach vorn. Atmet ein paarmal tief ein und aus. Will sich vor ihm nicht gehen lassen. Castro kennt das, er hat es schon oft erlebt. Die Frau wird weinen, wenn er weg ist. Oder am nächsten Tag. Oder bei der Beerdigung.
„Das Herz?“, fragt sie. Ihre ungewöhnlich tiefe Stimme klingt deutlich höher als zuvor.
„Sie wussten davon?“
„Meine Schwester hat Tabletten genommen. Sie hatte eine Herzmuskelentzündung, glaube ich.“
„Und sie ist trotzdem gejoggt?“
Friederike Weinbrenner zuckt mit den Schultern. „Wo haben Sie sie gefunden? Am See?“
„Nein, in ihrer Wohnung. Wissen Sie, wer sie behandelt hat?“, fragt Castro. „Ich meine, kennen Sie den Namen des Arztes?“
„Nein.“
„Sie und Ihre Schwester haben sich wohl nicht oft gesehen.“
„Nein.“
„Ist das nicht ungewöhnlich bei eineiigen Zwillingen?“
Sie zuckt erneut mit den Schultern. Gesprächig ist die Frau nicht. Er versteht das. Manchen verschlägt es für Tage die Sprache.
„Gibt es außer Ihnen noch weitere Angehörige?“
„Nein.“
„Wo hat Ihre Schwester gearbeitet?“
„Bei einer Bank. Sie war dort für das Wertpapiergeschäft verantwortlich.“
„Sie hat wohl gut verdient.“
„Sehr gut, soviel ich weiß.“ Die Frau steht abrupt auf und reicht ihm die Hand. Sie fühlt sich warm und trocken an, erstaunlich angesichts dessen, was Friederike Weinbrenner gerade erfahren hat. „Bitte gehen Sie jetzt“, sagt sie.
„Könnten Sie sich vorstellen, dass es kein natürlicher Tod gewesen ist?“, fragt Castro.
Sie zögert. „Nein“, sagt sie, „das kann ich nicht. Sollte ich?“
„Hatte sie einen Freund?“, fragt er weiter. „Vielleicht sogar einen Lebensgefährten?“
„Ja, zumindest in den letzten Monaten. Sie hat ihn bei einem Telefonat mal erwähnt. Aber sie hat ihn vor mir geheim gehalten. Was wird jetzt weiter?“
Castro tritt auf den Flur hinaus. Aus der Wohnung gegenüber ist Kindergeschrei zu hören.
„Der Leichnam Ihrer Schwester befindet sich zurzeit noch in der Pathologie. Für Angehörige ist der Gedanke nicht schön, aber wir müssen wissen, woran sie gestorben ist. Das ist Vorschrift. Ich gehe davon aus, dass man die Tote morgen oder übermorgen freigeben wird“, sagt er. „Sie können dann über sie verfügen. Wir rufen Sie umgehend an.“
Verfügen, denkt er, schon wieder so ein schreckliches Wort.
Sie gibt ihm ein zweites Mal die Hand. Wahrscheinlich hat sie das erste Mal bereits vergessen. „Falls es Sie interessiert – ich war in den letzten Tagen auf Geschäftsreise“, sagt sie. „Vor gerade mal einer Stunde bin ich zurückgekommen. Ich kann Ihnen gern meine Bahntickets zeigen.“
III
Duschen. Den Schweiß abwaschen, der in jeder Pore zu sitzen scheint. Der Läufer schließt die Augen, lehnt den Kopf gegen die weiß gekachelte Wand und überlässt sich dem Stakkato der Tropfen. Sauber sein, denkt er und spürt, wie ihm Tränen in die Augen steigen, endlich einmal vollkommen sauber sein. Und es bleiben.
Nachdem er sich sorgfältig abgetrocknet und angezogen hat, macht er Frühstück. Er lässt sich Zeit dabei: ein kleines Müsli mit frischen Früchten, Toast, grüner Tee. Vitamine, Spurenelemente, Kohlehydrate, die antikarzinogenen Wirkstoffe des Tees – mehr braucht es nicht, um seine Körperfunktionen im Gleichgewicht zu halten. Das Dosha-Gleichgewicht, wie es die ayurvedische Medizin nennt. Der Läufer hat das früher für ausgemachten Unsinn gehalten, für esoterischen Quatsch, der jedem aufgeklärten Menschen die Haare zu Berge stehen lässt. Inzwischen hat er so gute Erfahrungen damit gemacht, dass er seine Vorbehalte aufgegeben hat.
Die Zeitung berichtet von einer Korruptionsaffäre im Bauministerium, von einem Unfall mit zwei Toten auf der Autobahn A 1, von der Rede eines deutschen Literaturnobelpreisträgers zum Krieg in Afghanistan, vom Rücktritt der Kulturdezernentin der Nachbarstadt. Auf der letzten Seite des Lokalteils entdeckt der Läufer schließlich, was er sucht:
Die Liebe hört nimmer auf.
Meine Schwester
Felicitas Weinbrenner
hat mich verlassen.
In tiefer Trauer:
Friederike Weinbrenner
Die Beerdigung findet statt am 12.9. um 14.00 Uhr von der Kapelle des Nordfriedhofs aus. Von Beileidsbekundungen am Grab bitte ich Abstand zu nehmen.
In der Bank, in der Felicitas Weinbrenner gearbeitet hat, führt man Castro ins Büro des Filialleiters. „Alwin Braun“, steht an der Tür. „Eine tragische Geschichte“, sagt der zur Begrüßung und versucht seiner Stimme und seinem Gesicht einen Ausdruck von Trauer zu





























