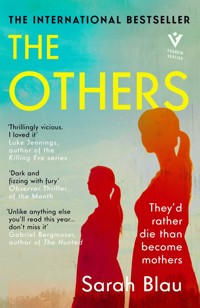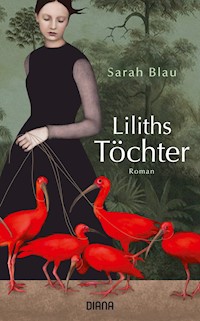
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diana Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Der Spannungsfall fesselt, ebenso die leidenschaftliche Debatte darüber, wie die Welt kinderlose Frauen sieht – und wie diese sich selbst.« New York Times
Ein makabrer Serienmörder versetzt Tel Aviv in Aufruhr. Die Opfer sind kinderlose Frauen, ihre Leichen grausam inszeniert: eine Babypuppe in die Hände geklebt, das Wort „Mutter“ in die Stirn geritzt. Bibelwissenschaftlerin Sheila Heller kennt die Toten. Diese Verbindung rückt sie ins Zentrum der Mordermittlungen, denn sie könnte die Nächste auf der Todesliste sein. Folgt man jedoch den Indizien, ist sie selbst die Hauptverdächtige …
Für Leser*innen von »Dann schlaf auch du«, »Meine Schwester, die Serienmörderin«, »Unorthodox« und »Regretting Motherhood«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Zum Roman
Ein makabrer Serienmörder versetzt Tel Aviv in Aufruhr. Die Opfer sind kinderlose Frauen, ihre Leichen grausam inszeniert: eine Babypuppe in die Hände geklebt, das Wort »Mutter« in die Stirn geritzt. Bibelwissenschaftlerin Sheila Heller kennt die Toten. Diese Verbindung rückt sie ins Zentrum der Mordermittlungen, denn sie könnte die Nächste auf der Todesliste sein. Folgt man jedoch den Indizien, ist sie selbst die Hauptverdächtige …
»Der Spannungsfall fesselt, ebenso die leidenschaftliche Debatte darüber, wie die Welt kinderlose Frauen sieht – und wie diese sich selbst.« New York Times
Zur Autorin
Sarah Blau lebt in Tel Aviv und ist eine prominente israelische Autorin und Dramatikern. Für ihren Beitrag zur Bereicherung der israelischen Kultur erhielt sie mehrfache Auszeichnungen. »Liliths Töchter« wurde in ihrer Heimat aus dem Stand zum Bestseller.
Sarah Blau
Liliths Töchter
Roman
Aus dem Hebräischen von Ulrike Harnisch
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2018 Sarah Blau
Die Originalausgabe erschien 2018
unter dem Titel by Kinneret, Israel.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2023 by Diana Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Antje Steinhäuser
Umschlaggestaltung: SERIFA nach einer Originalvorlage
von Kinneret, Israel
Umschlagmotiv: The Lady of the Ibis
© Daria Petrelli – Lizenzinhaber Chiara Roilo
Satz: Leingärtner, Nabburg
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-641-26391-1V001
www.diana-verlag.de
Zum liebevollen Andenken an Uri Orbach
Eins
Als dieser Anruf von der Polizei kam, war ich bereit.
Die samtene Stimme eines Mannes erkundigte sich, ob er vorbeikommen könne. Seine Männlichkeit brachte mich kurz aus der Fassung. In den unzähligen imaginären Probedurchläufen, die ich veranstaltet hatte, war es immer eine Frau gewesen, eine mit rauchiger, sachlicher Stimme. Stets klang sie ein wenig müde, hatte vielleicht eine lange Schicht hinter sich und garantiert Kinder. Schließlich haben alle Kinder.
Tief erschüttert war sie von dem entsetzlichen Mord, diesem rituellen, furchtbaren Mord, ein Unding, Gott behüte! Und dann fasste sie sich aber und besann sich auf den Grund ihres Anrufes.
»Alter?«, fragte sie, während sie tippte. »Verheiratet? Haben Sie Kinder?« Ich gab auf die letzten beiden Fragen das übliche »Nein« zur Antwort, doch zum ersten Mal spürte ich Erleichterung, die meinen Körper hinabrieselte.
Nein, keine Kinder.
Laut Polizeibericht war Dina um ein Uhr nachts ermordet worden.
In der Presse stand »mitten in der Nacht« nebst Schilderung sämtlicher Übelkeit erregender Einzelheiten, aber der Polizeibericht war wesentlich schlimmer, glaubt mir.
In den Zeitungen stand auch, dass die Ermordete in Genderforschung promoviert hatte. Die Mordtat weise »außergewöhnliche Merkmale« auf. Damit war offenbar gemeint, dass man sie in ihrem Wohnzimmer an einen Stuhl gefesselt hatte, ihr auf der Stirn das Wort »Mutter« einkerbte und die leblosen Hände eine Babypuppe festhielten.
Sie schrieben nicht, dass es eine Puppe war, wie man sie in britischen Fernsehsendungen sieht, wo Leute mit absonderlichen Eigenarten ihre Puppe wie ein echtes Baby behandeln. Diese Programme laufen meist in der Nacht, mitten in der Nacht. Und Leute wie ich schauen sie sich mit einer Mischung aus Neugierde und Entsetzen an. So eine wird nicht aus mir. Stimmt’s? Ich werde keine Puppe in ihrer Kinderwiege besänftigen und zu meinen Gästen sagen: »Still! Mein Kindchen kann so schwer einschlafen.«
Die Puppe am Tatort hatte ein rundes Gesicht mit zusammengekniffenen rosa Lippen und klare hellblaue Augen mit Wimpern, die beinahe echt aussahen.
Was sie hingegen schrieben, war, dass es eine missliche Angelegenheit gewesen war, der Ermordeten die Puppe aus den Händen zu nehmen. Wegen der Totenstarre, hatte man zunächst gedacht. Dann stellte sich heraus, dass ihr die Puppe an den Körper geklebt worden war. Eine sentimentale Journalistin fasste es in lyrische Worte. Sie sähe aus wie »eine Mutter, die sich an ihr kleines Kind klammert und sich weigert, es im Stich zu lassen«. Sosehr ich mich auch bemühte, fiel mir die Vorstellung, dass Dina sich an irgendetwas klammerte, schwer, erst recht nicht an ein Kind. Keine Frage, es musste an ihr festgeklebt werden.
Dina hätte es zufrieden gestimmt, dass die Liste ihrer Leistungen mehrere Zeilen einnahm. Beschrieben wurde die Promotion in jungen Jahren, die glänzenden Vorträge, die Hunderte Zuhörer anzogen, ihre brillanten Artikel. Sie hoben, selbstverständlich, jenen Artikel über die freiwillig kinderlosen Frauen der Bibel hervor, der sie als »eine der wichtigsten und umstrittensten feministischen Denkerinnen unserer Zeit« positionierte. Zudem habe sie weder heiraten noch Kinder haben wollen, wurde dort aufgeführt. Sie sei die Hauptvertreterin dieser »kontroversen Auffassung« geworden und habe sich in dem Kontext öffentlich geäußert.
Unerwähnt ließen sie, dass bei den jämmerlichen Versuchen, die Babypuppe von ihren Händen zu lösen, eher einige Hautfetzen abgerissen worden wären, sodass man nicht umhinkam, sie der Erde samt der anschmiegsamen Puppe zu übergeben.
Da drängte sich mir der Gedanke auf: Da hast du’s, Dina, nun bist du schließlich und endlich Mutter.
Zwei
Mein mir ausgehendes Haar sammelt sich in den Zimmerecken.
Die komplette Wohnung ist voller Kisten und Haarknäuel, die mir beim Laufen in die Quere kommen. Zum einen gibt es den normalen Haarausfall, der, so schreiben behutsam die Frauenmagazine, »ab einem gewissen Alter ganz natürlich« ist. Zum anderen gibt es den Haarausfall, der daher rührt, dass ich mir Haare herausreiße, daran drehe und ziehe. Wenigstens reiße ich sie nicht heraus, um es anschließend zu verschlucken. Hin und wieder liest man Reportagen über riesige Haarballen, die per Notoperation aus dem Magen irgendeiner jungen neurotischen Frau entfernt werden. Auf dem Foto sieht es stets aus wie ein Monsterbaby mit Fell.
Mir geht die letzte Bemerkung durch den Kopf, die mir Maor, bevor er damals ging, an den Kopf warf: »Deine Haare liegen in der ganzen Wohnung herum. Unternimm was. Das ist widerlich!« Bumm-krach! Die zufallende Tür wehte einen kleinen Haarballen direkt in mein Gesicht.
Zum ersten Mal im Leben hatte ich erwogen, ihn hinunterzuwürgen.
Ich kehre die Wohnung mit einem nagelneuen Silikonbesen. Gestern habe ich das gute Stück angeschafft und bin damit die ganze Straße entlanggelaufen. Die Leute sahen mich schräg an, als wollten sie mich darauf reiten sehen. Sie hätten dankbar sein sollen, dass es ein glänzender und steriler Silikonbesen ist und nicht der ellenlange Strohbesen, den ich damals zu Purim bekam. Es kann aber auch sein, dass gar keiner zu mir schielte und ich mir die prüfenden Blicke nur einbildete. Womöglich ist es nur dieses verdammte Schuldgefühl, das als düsterer Begleiter neben mir herschlurft.
Die Wohnung ist eingestaubt, ich muss husten, und mir tränen die Augen. Im Spiegelbild habe ich ein gerötetes Gesicht und sehe wild aus. Gar nicht gut. Auf den angekündigten Besucher sollte ich entspannt und unterkühlt wirken. Der Ermittler mochte sich jung angehört haben, aber keineswegs dumm.
Vor allem muss ich mir diese Bemerkungen verkneifen, mit denen ich herausplatze, wenn ich unter Druck gerate. Manchmal kommt es mir so vor, als plage mich zeitweilig das Tourette-Syndrom. Wieso habe ich mich sonst mit ihm angelegt?
»Ob ich seit dem Mord Angst verspüre?«, hatte der Ermittler sich behutsam erkundigt, denn die ganze Geschichte um kinderlose Frauen war neu aufgeflammt. Statt ihm kleinlaut zuzustimmen, konterte ich: »Was mir am meisten Angst einjagt, ist, dass man sie am Ende zur Mutter machte.«
Nein, das Schweigen, das am anderen Ende der Leitung entstand, kündete von nichts Gutem.
Ein ungehaltenes Klopfen an der Tür, und da tritt er auch schon ein, stolpert beinahe über eine der Kisten, die ich nicht rechtzeitig weggeräumt habe, lächelt betreten und streckt mir die Hand entgegen.
Er ist jung. Polizeiwidrig jung. Sein Lächeln bringt auf der linken Seite ein Grübchen hervor, genau wie Maors Grübchen, und es versinkt in zarten Bartstoppeln. Auch die hellen Augen sind wie die von Maor, sie scannen dich und gelangen zu einer Vielzahl individueller Schlussfolgerungen, die sie nicht mit dir teilen wollen.
O ja, die Ähnlichkeit mit Maor war in der Tat vorhanden. Insbesondere dieser Grünton der Augen, die unendlich langen Wimpern, das schiefe Lächeln, das Bewusstsein, Einfluss auf dich auszuüben.
Diesmal handelt es sich um tatsächliche Ähnlichkeit, nicht wie in der Phase nach der Trennung. Damals wirkte jeder Mensch (einschließlich des alten Besenverkäufers) wie ein Duplikat des Geliebten. Fang bloß nicht damit an, Sheila, sei klug.
»Sehr angenehm, Micha«, sagt er, die Hand noch in der Luft. An der weichen Stelle des Handgelenks nehme ich das Tattoo in filigraner Raschi-Schrift wahr. Entziffern kann ich den Satz nicht, doch es genügt mir als Hinweis. Garantiert war er bei der religiösen Jugendbewegung der King, bildlich sehe ich es vor mir. Auch die Kippa, die auf seinem Kopf fehlt, die übertriebene Selbstsicherheit, die die spät erblühte Männlichkeit überspielt.
»Ah, Sie ziehen um?« Er nimmt auf dem freien Teil der Couch Platz, lässt den Blick schweifen, nimmt das Inventar der offenen Kisten unter die Lupe.
»Ich bin gerade umgezogen, und wir können uns duzen«, antworte ich, während unser beider Blicke auf der kleinen Babypuppe landen, die aus der Kiste hinter der Tür lugt. Du dummes Ding!
»Alles klar. Spielst du immer noch mit Puppen?« Von dem unbeschwerten Ton lasse ich mich nicht beirren. Er verschlingt die Puppe mit den Augen, sie hat ein Auge geschlossen, und das andere schaut mit erstarrtem hellblauen Blick geradeaus, als hätte ihr jemand einen Faustschlag verpasst.
»Ein Geschenk vom Ex«, erwidere ich, »es war witzig gemeint.«
»Und was soll es ausdrücken? Den Wunsch nach einem gemeinsamen Kind?«
Du träumst wohl von einem Kind, Mister Sherlock.
»Nicht exakt.« Ich ziehe die Worte in die Länge. »Er hat eher darüber gewitzelt, dass er selbst noch ein kleines Kind ist.«
»Na ja, in den Augen der meisten Frauen sind alle Männer noch kleine Kinder.«
Da zeigt es sich wieder, das Lächeln des früheren Kings. Prompt verfalle ich in die Rolle der Bewundernden, der Lerneifrigen, denn manche Muster sind tief in uns angelegt, und wie in einem ewigen Rollenspiel passen wir uns sofort an. Deine Rolle bleibt die gleiche, egal, wer du bist, egal, wie alt du bist, denn es ist eine Rolle, die dir vor Ewigkeiten auf den Leib geschneidert wurde.
»Er war wirklich noch ein Kind«, erkläre ich, »erst sechsundzwanzig.«
»Ah, fast so alt wie ich.«
Er bereut diese Information sogleich, sein Gehirn beginnt nun in rasendem Tempo Berechnungen über mein Alter anzustellen, denn haben Dina und ich zusammen an der Uni studiert, bedeutet das, dass ich … dass ich mindestens … Sein Gehirn rechnet, und seine Augen scannen mich, und dieser Mund bringt einen höflichen Halbsatz hervor, den er zu leise von sich gibt … Dieser wandernde Blick fiel mir von der ersten Sekunde an auf, und ich weiß sehr wohl, was ihm durch den Kopf geht. Wäre er nicht im Dienst, würde er mich auf den neuesten Stand bringen, er habe etwas mit einer »älteren Frau« gehabt, denn sie haben alle irgendwann etwas mit einer »älteren Frau« gehabt, vor allem solche süße Ex-Religiöse, und immer war es »nicht so gut ausgegangen, aber wir sind Freunde geblieben«. Pah! Aber aussprechen wird er es nicht. Stimmt’s? Er ist hier, weil er von der – früheren – guten Freundin der Ermordeten Einzelheiten erfahren will. Ist es nicht so? Und er scheint mir einer, der darauf achtet, was er von sich gibt.
»Ich hatte auch eine Beziehung mit einer älteren Frau.«
Wow! Du bist wirklich erstaunlich, du kleiner Junge, auch wenn es nicht sicher ist, dass du etwas mit einer »älteren Frau« hattest. Hätte es sie wirklich gegeben, hätte sie dir nämlich anerzogen, dass sie keinesfalls so bezeichnet werden will. Sie hätte dich rundgemacht, so attraktiv du auch sein magst, wäre ihr zu Ohren gekommen, dass du dich auf diese Weise über sie äußerst. Du hättest vorgeben müssen, dass ihr beide gleichen Alters gewesen seid. Und wäre dir aus Versehen irgendetwas anderes herausgerutscht, hättest du es sofort lachend abtun müssen, nein, das habe ich doch nicht ernst gemeint.
»Das heißt, nicht wirklich älter«, korrigiert er sich rasch, »nur älter als ich. Sie war etwa in deinem Alter, dreißig plus?«
Okay, auf den Kopf gefallen ist er nicht.
»Ich bin einundvierzig.« Im nächsten Monat werde ich zweiundvierzig, und das weißt du, jedes Jahr hat seine eigene Bedeutung, auch das weißt du.
»Meine Freundin war in deinem Alter.«
Hmmm … er rudert nicht zurück, ziemlich interessant. Will er mich manipulieren? Will er mich weich stimmen, damit ich Informationen herausrücke? Da sind immer noch der interessierte Blick und die wunderschöne Haartolle, sie zu berühren muss ein schönes Gefühl sein. Über den Mord war bisher kein Wort gefallen. Das Grübchen tanzt, wenn er redet, und sein Lächeln macht mich schwach. Gleich sehe ich Sterne. Mein Blick schweift zu seinem Tattoo an dem wohlgeformten Handgelenk, und ich frage: »Hat es wehgetan?«
Und er antwortet: »Ziemlich heftig.«
»Magst du was trinken?« Ab mit dir in die Küche, bevor du einen schwerwiegenden Fehler begehst, los, vorwärts, zieh Leine.
»Gerne einen Kaffee«, sagt er, als mir einfällt, dass ich hier nichts habe, außer Leitungswasser, an dessen metallischen Geschmack ich mich nicht gewöhnen kann. Ich reiche ihm das Wasser in einem klebrigen Glas, das er länger betrachtet.
»Keine Sorge, hier ist alles koscher.« Ich kann es mir nicht verkneifen.
»Das ist kein Thema.« Er wirft mir einen fragenden Blick zu. »Schon seit einigen Jahren ist das kein Thema mehr.«
»Ich habe einen hochentwickelten Radar für Ex-Religiöse«, erkläre ich. Diese Reaktion beruhigt sie meist.
»Du bist die Erste, die mich so schnell durchschaut«, gibt er zu.
»Wirklich?«, frage ich nach, obwohl es mich nicht überrascht. »Das ist so klar, als würdest du die Kippa immer noch tragen.«
Er streckt die Hand aus, aber nicht nach seinem Schädel, um zu prüfen, ob dort eine Kippa gewachsen ist, sondern zu der Kiste hinter der Tür, aus der er die kleine Babypuppe zieht. Kommt es mir nur so vor, oder hat sich das eine Auge leicht geöffnet?
»Weißt du, diese Puppe ähnelt enorm der Puppe, die Dina Kaminer an die Hände geklebt wurde.« Er sieht mir nicht ins Gesicht.
»Ich habe ihr nichts angeklebt, wenn du darauf hinauswillst.«
Schlecht. Grottenschlecht, denn nun betrachtet er mich mit diesem forschenden Blick. Vor dem hatte ich mich schon gefürchtet, als er die Wohnung betrat.
Du dummes Ding.
»Falls es dir nicht aufgefallen ist: Ich habe dich nicht gefragt, ob du ihr etwas angeklebt hast«, sagt er. »Ich habe nicht einmal gefragt, wo du vor zwei Wochen am Mittwochabend um zehn Uhr warst.« Seine Stimme ist sehr leise.
»Am Mittwoch um zehn Uhr abends?« Um zehn Uhr abends!
»Eine Nachbarin hat genau um diese Zeit die Wohnung verlassen und gehört, wie Dina ihre Wohnungstür geöffnet und zu jemandem gesagt hat: ›Schön, dass du da bist.‹ Sie war sich allerdings nicht sicher, ob es an einen Mann oder eine Frau gerichtet war. Eher an eine Frau, meinte sie, aber …«
»Aber das passt nicht zum Profil, das die Polizei vom Mörder erstellt hat, der kinderlose Feministinnen hasst«, sage ich.
»Guter Instinkt.« Er bemüht sich, an dem Wasser zu nippen, tut so, als würde es ihm schmecken. »Also was hältst du davon, wenn ich jetzt nachhake, wo du am Mittwochabend um zehn Uhr warst? Kann ich dir diese Frage stellen?«
Wieder lächelt er auf diese Art. Ihm ist bewusst, dass er Einfluss auf mich ausübt. Mit naiver hochmütiger Miene lehnt er sich auf der Couch zurück, da ertönt hinter ihm ein ohrenbetäubendes Quietschen, mit einem Satz springt er auf und verschüttet das Wasser auf seiner Hose.
Diese verfluchte Puppe! Ihr Gesicht, das nun eingedrückt wirkt, grinst mich verächtlich an.
Bevor er gehen wird, erfährt er, dass ich den Mittwochabend zu Hause verbracht und ferngesehen habe. »Keine Spur eines Alibis, doch es ist ja bekannt, dass die größten Verbrecher immer das beste Alibi haben.« Er wird zustimmend nicken, sich knapp erkundigen, wie der Kontakt zwischen mir und Dina während des Studiums war, und von mir hören: »In den letzten Jahren hatten wir gar keinen Kontakt, du weißt ja, wie das ist, das Leben hat uns an verschiedene Orte gespült.« Es wird derart überzeugend klingen, dass ich es beinahe selbst glaube. Dann wird er noch einige Male mit Grübchen lächeln, ich werde mit eiserner Selbstdisziplin versuchen, nicht auf den nassen Fleck auf seiner Hose zu schielen, darauf folgen einige Blicke, von denen du nie im Leben geglaubt hättest, dass ein angehender Polizist dieses Typs sie dir zuwirft, und das war’s, da seid ihr auch schon an der Tür.
Er bleibt in meiner Nähe stehen, beugt sich beinahe zu mir. Ich spüre dieses Magnetfeld, das bei zwei Leuten entsteht, zwischen denen jegliche Verbindung ins Unglück führt, und bekomme eine Gänsehaut.
»Und was jetzt?«, frage ich.
»Nun kommt die nächste Phase. Solltest du dich an etwas erinnern, das hilfreich sein könnte, dann ruf mich an.« Er ist hautnah.
»Ah, das ist die Phase, in der du mir sagst, dass ich die Stadt nicht verlassen darf?« Sein Blick lädt dazu ein, schlaue Sprüche zu klopfen.
»Diese Krimiserien habe ich auch gesehen«, sagt er. »Du hast die Stadt ja schon verlassen. Stimmt’s?«
Er lächelt noch einmal, seine Nasenflügel weiten sich. Er fährt sich erneut über die dichte und weich aussehende Haartolle, dann macht er auf dem Absatz kehrt und geht. Die Tür, die hinter ihm zuschlägt, weht mir einen Haarballen direkt in den Mund, ich spucke ihn aus und vernehme das vertraute Kichern: »Du dummes kleines Mädchen.« Es ist Dinas Stimme.
Drei
Natürlich hatte er mit seiner Wahrnehmung ins Schwarze getroffen, der junge Herr, der Polizeiarbeit leistet. Ich hatte Tel Aviv rechtzeitig verlassen.
Zu viele Frauen meines Schlags waren dort durch die Straßen geschlendert. Wir sind alle attraktiv, wir sind alle Designerstücke, wir sind alle scharfsinnig, flattern Schmetterlingen gleich und stechen zu wie eine Nadel bei der Fruchtbarkeitsuntersuchung, und wir sind allesamt tickende Zeitbomben, tick-tock, tick-tock, auf ein Baby keinen Bock.
In der vergangenen Woche fand in einer Bar ein Vortrag statt: »Gewollte Familienlosigkeit: Frauen ohne Kinder.« Mittendrin wurde eine Babypuppe in den brechend vollen Raum geschleudert. Die Puppe war von der billigen, hässlichen Sorte, ohne Wimpern. Sie war nackt, und in roter Tinte stand auf ihrer Stirn: »Liebste Mama.« Nachdem die Hysterie sich gelegt hatte, fotografierte jede anwesende Frau die kleine Puppe von allen Seiten und stellte sie auf ihre Facebook-Seite und versah das Ganze mit traurigen Status-Updates zur Hilflosigkeit der Polizei.
Zwei Tage später wurden die Kriminellen gefasst, zwei Jugendliche, die derart aufgewühlt waren von dem rituellen Mord, der ansteigenden Hysterie und insbesondere, so gaben sie zu, »von der Chance, dass wir in Israel nun endlich einen ernst zu nehmenden kreativen Mörder haben«. Daher hatten sie beschlossen, ihm bei dem Unternehmen zur Hand zu gehen. Auf dem Pressefoto sahen sie aus wie zwei Mumins, sanft und schwammig, die sich bestens verstanden. Wer von den beiden hatte die Puppe geworfen? Ich wette, es war der, der durch Hässlichkeit auffiel.
*
Dina war gegenwärtig, die ganze Zeit über Dina, korrekter wäre Dr. Dina Kaminer. Sie war gegenwärtig in den Artikeln zu ihrem Profil, die vor Lob strotzten, in den Hinweisen auf ihr Privatleben (unter dem Deckmantel von investigativem Journalismus), in den Nachrufen der Kolleginnen und den bekannten Fotos in den Zeitungen. Hauptsächlich veröffentlichten sie immer wieder ein Foto, auf dem sie beim Lächeln ertappt worden war, ihr Teint war gerötet, sie wirkte ausgelassen, das Lächeln wirkte ein wenig dümmlich, gab den Blick auf einen Spalt zwischen den Zähnen frei und war für sie nicht charakteristisch.
Wäre sie am Leben, daran hatte ich keinen Zweifel, hätte sie sich den Redakteur am Telefon vorgeknöpft und verlangt, es durch ein geeignetes Foto auszutauschen, und sie hätte das Gewünschte durchgesetzt. Mit ihrer ausgesuchten Überzeugungskraft und der Verknüpfung von Streitlust und Charisma blieben ihr nur äußerst wenige Dinge vorenthalten. Aber geholfen hat’s ihr auch nicht. Stimmt’s?
Auch dieser eine Artikel wurde wieder hervorgekramt. Ein Journalist hatte ihn vollständig, Wort für Wort, gebracht, ich machte davon einen Screenshot und richtete ihn als Bildschirmschoner ein.
Keiner, der daraus zitierte, hatte ihn gelesen, fiel mir auf, sie wiederholten lediglich die albernen Einschätzungen, die eine Zeitung von der nächsten übernahm. »Verhielt es sich so, dass die biblischen Frauenfiguren sich dafür entschieden, keine Kinder zu bekommen? Verhielt es sich so, dass Frau Dr. Dina Kaminer Frauen dazu ermutigte, keine Kinder zu gebären? Verhält es sich so, dass volljährige Frauen ohne Kinder sich von nun an auf unseren Straßen fürchten müssen? Verhält es sich so, dass unsere Frauen in Gefahr sind? Verhält es sich so? V e r h ä l t e s s i c h s o ?« Eine einzige Litanei, stets lausig formuliert, und sie ließ erkennen, wie man sich an der Sache weidete.
Tick-tock, tick-tock, auf ein Baby keinen Bock.
Ein Radiosprecher versuchte seine Zuhörer mit einer Umfrage zu begeistern: »Wen würdet ihr zur Mutter machen?« Er wurde natürlich umgehend suspendiert, doch nicht bevor er einige interessante Optionen aufwarf, darunter war eine bekannte Schauspielerin, die öffentlich erklärt hatte, sie sei an Kindern nicht interessiert, eine Regisseurin, die sich dagegen aussprach, Kinder zu bekommen, und eine junge Sängerin am Anfang ihrer Karriere, die bereits in ihrem ersten Interview publik machte, sie habe nicht die geringste Absicht, Mutter zu werden.
Schon beim Lesen dieser Interviews war mir eins klar: Binnen drei Jahren werden uns die drei von den Titelseiten der Magazinblätter anlächeln und in den Armen ein frisch gebadetes Baby halten. Die Story wird gekrönt von der immer gleichlautenden Überschrift: »Mutter zu sein, hat mich verändert.«
Denn heute weiß ich: Bist du an Kindern nicht interessiert, machst du das nicht öffentlich, schon gar nicht auf diese Weise. Es geht um etwas Privates und Vertracktes, das einige Zeit in Anspruch nimmt, bis es aus den Tiefen des Bewusstseins auftaucht, und selbst dann lässt es dir keine Ruhe, ringt mit dir bis zur letzten Eizelle, wer weiß das besser als du.
Kleine Hexe, wie siehst du denn aus?
Unterm kurzen Rock guckt der Schlüpper raus!
Flink stehe ich auf, gehe rasch zum Fenster, werfe einen Blick hinaus, kann es nicht glauben, dass diese Lieder immer noch gesungen werden. Mehrere Kinder haben ein kleines Mädchen umzingelt, das einen Minirock trägt. X-mal singen sie diese penetrante Leier. Das Mädchen in der Mitte wirkt verwirrt, weiß nicht, ob sie heulen oder lachen soll. Ich würde ihr diesen einen Rat geben: Heule drauflos.
Hörbar knalle ich das Fenster zu, Putz rieselt von der bröckelnden Wand. Dieses Fenster grenzt an Ramat Gan, die andere Seite bietet einen komplett anderen Anblick.
Diese Wohnung, in die ich zurückgekehrt bin, befindet sich auf einem eigenartigen Punkt der Landkarte: Bnei Brak an der Grenze zu Ramat Gan, genau an der Linie. Für die Mehrheit ist es ein Codename, den jene Einwohner von Bnei Brak benutzen, die ihre Herkunft gern verschleiern wollen. Darum sagen sie: »Ich wohne in Bnei Brak, an der Grenze zu Ramat Gan«, auch wenn sie in der Mitte der Rabbi Akiva Street wohnen.
Aber meine Wohnung befindet sich tatsächlich zwischen beiden Bezirken. Fragt mich einer: »Woher kommst du?«, gebe ich die Antwort, die mir gerade dienlich ist. Efraim, der Direktor des Bibel-Museums, in dessen Augen meine dürftige Religiosität ein reizvoller Faktor ist, bekäme die Antwort: »Bnei Brak.« Ein zufälliger Taxifahrer hingegen, der mir seine Gedanken zu Religion und Staat auftischen will, erhielte die gleichgültige Antwort »Ramat Gan.« Jedem das Passende. Wie gut, dass eine junge Dame die Option hat, ihre Vergangenheit ein wenig zu verschleiern. Wer weiß das besser als ich.
Es gibt einen weiteren Vorteil, und der ist geheim.
Jedes Mal, wenn ich spüre, dass meine Jugend in meinem Körper versiegt – die trocken werdende Haut, die Regel, die sich um einen weiteren Tag verkürzt, das zarte-aber-spürbare Nachlassen der Gesichtsmuskeln, die Härchen an der Kinnpartie –, kurzum: plagen mich Zweifel an meiner weiblichen Anziehungskraft, zieht es mich in die Straßen Bnei Braks. Huh, bei all den schrägen Blicken und dem Zungeschnalzen und den abfälligen Grimassen wirst du dich immer begehrt fühlen. Jeder Ansatz von einem Dekolleté oder ein Rock, der sich einige Millimeter übers Knie hebt, verschafft dir das Gefühl, die verführerischste Lilith der Welt zu sein. Es ist ein Elixier, das dir Jugend einflößt, o Wunder wirkt.
Maor hasste die Tatsache, dass ich aus Bnei Brak stammte; die Stadt kam ihm minderwertig und verwahrlost vor. Als er hörte, dass ich zurückziehen wollte, verzog er angewidert die Miene, konnte partout nicht nachvollziehen, wie ich meine Wohnung in Tel Aviv aufgeben konnte. Auch als ich erklärte, dass ich die Möglichkeit hatte, in der Wohnung einer Verwandten fast umsonst zu wohnen, zuckte er die Schultern: »Dich dort zu besuchen, wird mich deprimieren«, sagte er.
Offenbar deprimierte es ihn wirklich. Tatsache ist, dass wir uns noch vor dem geplanten Umzug trennten.
Ich betrachte die Babypuppe mit dem platt gedrückten Gesicht, die er mir damals gab, in der Zeit, als die Sonne strahlte und unsere Affäre begann, alles vielversprechend glitzerte. Es war eine Warnung vor der Zukunft, die ich in den Wind schlug. Lacht dein Freund über die vielen Jahre, die euch trennen, bist du es, die am Ende weint.
Es stimmt, dass ich ihn gleich zu Anfang wissen ließ, dass ich an Kindern nicht interessiert sei, zum einen war es die Wahrheit, und zum anderen wollte ich diese beängstigende Wolke vertreiben, die jede Frau Ende dreißig umgibt und zur Bedrohung macht.
Er erwiderte, er sei ebenfalls nicht interessiert – Und das war gelogen! Sie werden immer daran interessiert sein, insbesondere die geltungsbedürftigen. Er hielt lange Zeit an dieser Haltung fest, bis er einmal fragte: »Theoretisch, wenn du ein Kind wölltest, mit wem würdest du’s machen?« Ich, deren reine Absicht es war, ihm zu schmeicheln, gab prompt zur Antwort: »Nur mit dir, Maori.« Natürlich ging die Sache nach hinten los. Seine Augen verkehrten sich in dunkle Tümpel der Angst. Von da an war unsere Beziehung im freien Fall. Tick-tock.
Nun sitze ich im Schaukelstuhl einer Geisterwohnung, halte diese hässliche Babypuppe in den Händen und warte auf einen Anruf von Maors Doppelgänger, der nur Zerstörung bringen wird. Und von der Polizei ist.
Jeder Gegenstand in der Wohnung schreit dich an, auf der Hut zu sein, aber du hörst nicht hin. Die Wände verfolgen, wie du auf den Anruf wartest, mit hungrigem Ausdruck um das Telefon kreist und in den Räumen allmählich ein vertrautes Gefühl Einzug hält. Es nennt sich Erwartung, und es ist ekelhaft.
Lieber sollte ich mich freuen, dass ich ihn spielend leicht losgeworden bin. Dumm ist er nicht, dieser Micha. Dass er so ungezwungen drauf war, mich nicht mit schwerwiegenden Fragen malträtierte, sollte mich entzücken. Ich hätte hinter ihm die Tür schließen und tanzen sollen. Warum zum Teufel starre ich aufs Handy und schaue nach, ob der Akku funktioniert? Warum kann ich mich auf nichts konzentrieren, höre nur dieses ausgehungerte Summen im Kopf? Warum? Weil du ein kleines Mädchen ohne einen Funken Verstand bist. Darum.
Wenigstens Google erwartet mich mit offenen Armen, üppig bepackt mit allem Guten.
Erneut gebe ich »Dina Kaminer« ein und warte darauf, mit Ergebnissen überschwemmt zu werden. Nichts Neues, seit ich das letzte Mal (vor einer Stunde) online war. Keine neuen Verdächtigen, keine interessanten Theorien. Statt der angeblichen Sorge (mit einer Prise Schadenfreude) um das Wohlergehen der Singlefrauen dieser Stadt finde ich nun mehrere Artikel, die predigen. Frauen, die die Kinderfrage endlos hinausschieben, würden sich selbst Schaden zufügen, bla-bla-bla. Unterm Strich: nichts Nützliches an Informationen. Ich scrolle weiter runter, und vor mir entfaltet sich die dunkle Welt der Hasskommentatoren.
Unglaublich, wie sehr sie Dina hassen. Selbst in diesem Zustand. Als Ermordete. Entweihte. Ihres Titels und ihrer Ehre beraubt. Selbst jetzt hassen sie Dina. Hatten sie immer gehasst.
Da taucht ein neuer Artikel auf. Die Überschrift ist sentimental: »Dr. Dina Kaminer – die Mutter jener, die keine Mütter werden wollten.« Keine schlechte Überschrift, mit lyrischem Anklang, nicht eindeutig, was Dina davon gehalten hätte, für mich liegt darin Schönheit. Der Artikel stammt von einer Kollegin aus der Forschung, und die Kommentatoren legen offen, dass sie ebenfalls keine Kinder hat. Sie lassen ihren Zorn und ihre Verachtung an ihr aus. Die Bandbreite reicht von: »Wer so hässlich ist wie du, braucht keine Kinder in die Welt zu setzen«, das ist der Klassiker. Munter geht es weiter: »Wer will von dir schon Kinder, du ekelhafte egoistische fettarschige Trulla« – etwas banal, diese unspezifischen Beleidigungen. Und ein empfindsamer Vorschlag: »Finde endlich einen, der dich befruchtet und dir mit seinem Samen Verstand in deinen unfruchtbaren Schädel rammt.«
Nun, manche Dinge werden sich nicht ändern.
Keiner dieser stammelnden Kommentatoren kann mir beim Texten das Wasser reichen.
Zur aktuellen Stunde werde ich davon die Finger lassen, schlafende Hunde will ich nicht wecken. Am Ende stellt so ein ganz Schlauer bei der Polizei Zusammenhänge her, die mich in große Schwierigkeiten verstricken, aber in der Vergangenheit, o ja in der Vergangenheit habe ich in der Tat den ein oder anderen Kommentar verfasst.
Im Gegensatz zu diesen Neandertalern mit ihren kalkulierbaren inhaltlichen Welten hatte ich Dina gekannt und wusste genau, wo ich sie angreifen konnte, wo ihre wunden Stellen waren. Kleine Hexe.
In einem Interview äußerte sie sich über »die Gewalt der Hasskommentatoren, die durch ihre Anonymität ermöglicht wird«. Sie war mir auf die Schliche gekommen. Sie feuerte gleich mehrere dünne Pfeile ab, extra für mich angespitzte. Doch was kümmerte es mich? Zu der Zeit entzog sich mein Hass auf Dina bereits jeglicher Logik.
Versteht ihr? Ich empfand gegenüber allem Hass, was mit ihr im Zusammenhang stand. Die sich naiv gebende Angriffslust, das dunkle glänzende Haar, stets sorgfältig zusammengebunden, die schwarzen hervorstehenden Kuhaugen, die riesigen Brüste, die sie dreist vor sich herschob wie den Bug eines Kriegsschiffs, ihre Rechthaberei, hauptsächlich aber hasste ich ihre tiefe, schnurrende Stimme, eine samtene Stimme, in deren Unterton die Faust lauerte.
Exakt so hörte sie sich an jenem Mittwochabend an, als sie mir die Tür öffnete und sagte: »Schön, dass du da bist.«
Vier
Aber umgebracht hast du sie nicht? Stimmt’s?« Nur Eli kann einen solchen Satz hervorbringen und dabei sachlich klingen.
»Sag nicht, das würde nach einem schlechten Krimi klingen.« Wie immer liest er meine Gedanken.
Ich sitze ihm im Büro gegenüber, trinke, ohne mit der Wimper zu zucken, aus seiner Cola-Dose. Elis Büro ist der Hort der Sicherheit, Eli selbst ist der Hort der Sicherheit, der loyale Freund mit der Treue eines Hundes (de facto ähnelt er eher einem Hamster. Aber er ist ein hochgewachsener, ein gut aussehender Hamster, manche würden sagen, ein Hamster mit enormer Anziehungskraft, dennoch reden wir von einem Hamster). Würde es mir doch nur gelingen, mich in ihn zu verlieben – ich wäre die glücklichste Frau der Welt. Nein, das ist ungenau, ich wäre wahrscheinlich ein anderer Mensch, der Mensch, der imstande wäre, sich in Eli zu verlieben. Bedauerlicherweise bin ich’s nicht.
Eli ist angenehm, und er ist klug, seine bloße Gegenwart vermag mich zu beruhigen. Noch dazu ist er tolerant und liest seit Jahren mit verblüffender Präzision meine Gedanken, doch wie ihr schon ahnt, ist dies nicht der Cocktail an Eigenschaften, der einen Mann für mich anziehend macht. Tick-tock, tick-tock.
Eli half mir, in stundenlangen Gesprächen etwas zu ergründen. Junge Männer ziehen mich leider vor allem deswegen an, weil vor ihnen noch alles offen liegt, alles frisch ist und glänzt. Auch wenn sie von all diesen Möglichkeiten nichts verwirklichen werden – die immanente Kraft der bloßen Verheißung ist gigantisch.
Eli kann ich beispielsweise anschauen und genauestens voraussagen, wie sein Leben (oder unser gemeinsames) in zwanzig Jahren aussehen wird, einschließlich der Ebene der Steuererklärungen, die er selbstverständlich selbst anfertigen wird, denn zusätzlich zur Summe seiner Tugenden ist Eli auch der Buchhalter des Museums, in dem ich arbeite, aber selbst eine Affäre am Arbeitsplatz ist für dich nicht aufregend genug. Ist es nicht so?
Vor etwa drei Jahren erwachte ich nach einer Horrornacht, in der sich sämtliche Geister der Vergangenheit gezeigt hatten. Verängstigt und völlig erschlagen sah ich in den Spiegel und sah ein schwarzes Barthaar sprießen, durch mein Gehirn schoss der wohl überflüssigste Satz der hebräischen Sprache: »Warum es nicht versuchen?«
Warum solltest du es nicht versuchen, Sheila? Warum bist du so drauf? Er ist schon geraume Zeit ein hingebungsvoller Freund, und es kann sein, dass auch in dir, tief im Inneren, ein Körnchen verborgen ist, das sich zu ihm hingezogen fühlt. Verkündet er dir, dass er ein Date hat, spürst du jedes Mal, wie eine eiserne Faust sich um dein Herz schließt. Von da an kannst du es kaum erwarten, dass ihr Kontakt abflaut und dann vollends abstirbt. Stimmt’s?
Beim nächsten Treffen – so schwor ich mir – würde ich den Versuch unternehmen, Eli als Objekt meiner Begierde zu betrachten, es war mein voller Ernst. Irgendwie schaffte ich es, mir romantische Gedanken einzureden, sodass ich ein Wiedersehen kaum erwarten konnte. Eli hatte keinen blassen Schimmer, das Objekt meiner Zukunft zu sein, und kam mir – jammerschade war’s – in speckigen braunen Cord-Hauslatschen entgegen. Als ich auf ihn zutrat, muffelten diese Dinger, es war abstoßend. An Ort und Stelle schrieb ich jegliche Gedanken der Sorte »vielleicht versuchen wir’s« für alle Zeit ab.
Erst einige Tage später fiel mir ein, dass Eli diese Latschen häufig trug, nie hatte ich einen Gedanken an ihr Aroma verschwendet. Offenbar hatte ich meinem Unterbewusstsein befohlen, ihn in jedem Fall abstoßend zu finden, und er, gehorsam wie er war, vor allem hinsichtlich meiner Befehle zur Selbstzerstörung, hatte sich fix was aus der Mottenkiste geschnappt.
Eli nimmt einen Schluck aus der Dose, verliert kein Wort darüber, dass ich sie fast geleert habe und sie ihm gegen die Zähne knallt.
»Ich will das verstehen«, sagt er. »Hat dich jemand gesehen, als du in der Mordnacht zu Dina gegangen bist?«
»Wie kommst du darauf?«, entgegne ich. »Wäre das so, hätten sie mich auf der Stelle verhaftet, aber eine Frau hat offenbar gehört, wie sie mir die Tür geöffnet hat.«
»Um sieben Uhr abends? Dieser Ermittler hat zu dir gesagt, dass es zehn Uhr abends war.«
Nur mir fällt die leichte Veränderung in seiner Tonlage auf, als er »dieser Ermittler« sagt.
»Das stimmt, aber es kann sein, dass diese Schnüffeltante sich in der Uhrzeit geirrt hat.«
»Sheila, herumschnüffelnde Nachbarinnen irren sich nie. Das weißt du sehr gut.«
Natürlich hat er recht, jeder Krimileser weiß: Nichts ist genauer als eine Nachbarin auf der Lauer. Und keiner ist heimtückischer.
Dann erzähle ich ein wenig mehr von Michas Besuch, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, mir ist klar, dass der geschulte Eli bereits alles erfasst hat, bevor ich überhaupt dazu angesetzt hatte. Er stellt mir keine Frage, weiß, dass er bald mehr von mir erfahren wird, als ihm recht sein wird.
Nur ein Detail macht ihm Sorge: »Hat Dina angerufen und das Treffen initiiert?«, will er wissen. »Nach all den Jahren? Nach allem, was geschehen ist?«
»Ja.«
»Wie kam es, dass sie dich aus heiterem Himmel treffen wollte?«
Ich versinke im Stuhl, kann es nicht über mich bringen, ihm zu schildern, wie alles schiefging, dass dort unheilvolle Worte fielen. Allein der Gedanke daran tut mir weh. Sie hatte sich trotz der Jahre die Fähigkeit bewahrt, mich zu verletzen. Und du hast deine Fähigkeit vervollkommnet, sie zu verletzen. Hör also auf zu jammern, du bist ja am Leben.
»Na, wie geht’s? So viele Jahre!«
Fast zwei Jahrzehnte, meine Liebe, aber wer zählt schon mit. Ich mustere sie, bin geknickt, denn die Fotos in der Zeitung waren doch nicht retuschiert, und sie sieht mit ihrer schwarzen Haarmähne, der majestätischen Stirn und den großen dunklen Augen wirklich blendend aus. An der Uni hieß es damals, wir seien uns ähnlich, daran war auch ein Funken Wahrheit, aber das Leben, das in uns angelegt war, hatte unsere Ähnlichkeit schwinden lassen. Sie wirkt satt und überheblich, während ich permanenten Heißhunger ausstrahle. Ihr ist anzusehen, dass sie ein wenig zugelegt hat, aus der »Pummeligen« ist die »Korpulente« geworden. Ein kleiner Trost.
Wir sehen uns, erstarrt wie zwei Schützen, an. Mein Blick weicht als erster zur Seite aus, direkt an die Wand, die mit Hochglanz-Diplomen und Anerkennungen gespickt ist. Es gibt auch ein Bild, das ich ziemlich gut kenne, von einer Person, die ich ziemlich gut kenne, zu gut. Ich kann mich nicht beherrschen und lese langsam und sorgsam die Bildunterschrift: »Die Prophetin Mirjam.«
»Es ist nicht das gleiche Bild«, sagt sie pfeilgeschwind.
»Sicher nicht«, antworte ich. Was mit dem ursprünglichen Bild geschehen ist, wissen wir beide, und keine von uns erinnert sich gerne daran. Irgendwo in meinem Gedächtnis taucht eine Erinnerung an die junge Dina auf mit dem wilden Haar, den großen, weit aufgerissenen Augen, dem glühenden Gesicht; das kraftvolle Trommeln ihrer weißen Hände auf Mirjams Instrument hört sich wie ein gewaltiger zorniger Herzschlag an: ta-tam, ta-tam!
»Trommelst du noch?« Ich kann nicht glauben, dass mir diese Frage über die Lippen kommt und auch noch, bevor ich mich in einem ihrer schlohweißen Sessel niederlasse, offenbar hasse ich sie mehr, als ich vermutete.
»Ich habe damit aufgehört«, antwortet sie. Ihrem Ton nach zu urteilen, kann ich einordnen, wann genau das war. Ich sinke in einen der Sessel, die auf einem flauschigen, ebenfalls schlohweißen Teppich stehen. Und hier ist kein Kind, das daran etwas ändern wird.
»Kaffee?« Ihre Stimme schlägt um, wird wieder angenehm. Für Menschen, die Gäste bewirten, las ich einmal, ist es eine Erleichterung, wenn du ihre Angebote, dich zu tränken und zu füttern, erhörst. Es hat mit Mechanismen der Kontrolle und Besänftigung zu tun.
»Ja, sicher«, antworte ich und bereue es sogleich. Warum sollte ich dieses Miststück besänftigen?
»Ich habe nur Sojamilch.«
»Das ist okay«, gebe ich zur Antwort.
»Du weißt, dass es heißt, sie würden eine ordentliche Portion Hormone enthalten«, sagt sie, während sie uns beiden eingießt. Mein Blick fällt auf ihre mandelförmigen rosa Fingernägel. Ihre Hände an den Tassen wirken so zierlich, ich hatte vergessen, wie klein sie im Verhältnis zu ihrem Körper sind. Die Hände sind die einzigen Körperteile, an denen sie verletzlich wirkt. Alle Mitglieder der Familie Kaminer haben derart kleine Hände. Ich erinnere mich an jenes Mal, als ihr Bruder mir seine kleine Hand auf die Schulter legte, es war zu einer Purim-Party und dadurch gerechtfertigt, dass wir alle angetrunken waren. Es war eine leichte Berührung, auf eigenartige Weise wohltuend, und sie ließ Gänsehaut aufkommen. Es war das erste Mal, dass ein Mann mich berührte, das sagte ich ihm auch. Er ließ seine Hand dort ruhen, und so verharrten wir länger. Allerdings sah ich ihn nach der Party nicht wieder. Dina schien darüber zu wachen. Abertausende Gründe mochte es dafür geben, dass sie eine Affäre ihres Bruders mit mir verhindern wollte, doch mich interessierte der wahre Grund.
Wir nippen schweigend.
»Zumindest schmeckt sie inzwischen besser«, sagt sie. »Weißt du noch, wie widerlich die Sojamilch an der Uni war?«
Ich erinnerte mich, und zwar sehr gut, vor allem an Ronith und ihre Laktose-Allergie. Sie war immer gezwungen gewesen, für ihren Kaffee konservierte Sojamilch aus Kanistern zu nehmen. Einmal hatte ich aus Versehen einen Schluck von ihrem Kaffee getrunken, und diesen üblen Beigeschmack kann ich bis heute auf der Zunge spüren, wie der Bodensatz einer Dose Pilze.