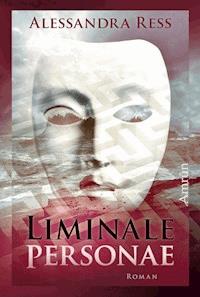
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amrun Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
"Wir wollen eure Freiheit nicht!" Jahrzehnte nach einer verheerenden Zombie-Epidemie. Die Zivilisation, wie wir sie kannten, ist zerstört, die wenigen Überlebenden haben sich in kleine Siedlungen zurückgezogen. Eine Gruppe junger Menschen stellt das vorherrschende Gesellschaftsmodell der "Stadt" in Frage und wird verbannt. Unter ihnen auch Nihile, die vor die Wahl gestellt wird, in welcher Umgebung sie leben möchte – Wildnis, eine scheinbare Demokratie oder eine monarchistische Regierung? Wie individuell kann man sein, wo wird der Individualismus zu Egoismus? Und wie ideal darf man denken, wenn man überleben möchte? Ein Coming of Age-Roman mit phantastischem Hintergrund.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 122
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LIMINALEPERSONAE
ALESSANDRA RESS
© 2016 Amrûn Verlag
Jürgen Eglseer, Traunstein
Lektorat und Korrektorat:
scriptmanufaktur.de
Claudia Junger und Carmen Weinand
Umschlaggestaltung: Mark Freier
Alle Rechte vorbehalten
ISBN – 978-3-95869-201-5
Besuchen Sie unsere Webseite:
http://amrun-verlag.de
Bibliografische Information der Deutschen
Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar
INHALT
1. Separation
2. Marginalisierung
3. Reintegration
1.SEPARATION
»Wir wollen eure Freiheit nicht!«
Wie ein Peitschenhieb knallte der Ruf durch die Reihen der Demonstranten, brachte ihre uneinheitlichen Schreie der Wut zum Schweigen. Alle Augen richteten sich auf einen dunkelhaarigen Mann, der auf den Sockel der Uhr im Zentrum des Großen Platzes geklettert war. Er musste sich mit der linken Hand an eine der Ziffern klammern, um nicht abzurutschen, schaffte es aber irgendwie, durch diese Haltung umso entschlossener zu wirken.
Unbeirrt von der Aufmerksamkeit seiner Mitstreiter sprach er weiter, den Blick zur Fassade des rechteckigen Klotzes gerichtet, in dem sich unsere schweigenden Feinde verbargen. »Wir wollen eure Freiheit nicht, weil sie eine Lüge ist. So wie alles, was ihr uns lehrt. Eure Demokratie ist Diktatur. Eure Freiheit ist ein Gefängnis mit vielen Zellen. Eure Geschichten über die Vergangenheit sind Märchen. Eure Sicherheit sind Fesseln. Und das Schlimmste ist: Ihr macht daraus nicht einmal ein Geheimnis. Ihr lehrt uns die Zeiten der wahren Freiheit und haltet uns zu Narren, während das Symbol unserer Unterdrückung mit eisernem Hohn auf uns herabschaut.« Mit seiner freien Hand deutete er nach rechts, wo in der Ferne die Zinnen der gewaltigen Mauer aufragten, die die Stadt auf drei Seiten von der Außenwelt abschirmte.
Der Geste folgte ein kollektiver Wutschrei aus den Reihen der Demonstranten, und zu meiner Überraschung merkte ich, wie auch ich einfiel.
Eigentlich hatte ich gar nicht herkommen wollen. Die unter einer Fassade nervöser Ruhe brodelnde Aufregung, die viele meiner Freunde erfasst hatte, nachdem die ersten Gerüchte der geplanten Demonstration an unsere Ohren gedrungen waren, hatte mich höchstens befremdet.
Was scherte es die Gesichtslosen schon, ob wir unsere Wut herausbrüllten? Sie hatten sich für keine der vorangegangenen Demonstrationen interessiert und sie würden sich auch um diese nicht kümmern. Es war der übliche Gang der Dinge in der Stadt, dass sich einige beschwerten und sich doch nichts änderte. Dafür hatten alle viel zu viel Angst vor dem Unbekannten, das die einzige Alternative zu unserem sicheren Gefängnis war.
Im Grunde war das normal für mich, denn das war die Welt, die ich gewohnt war, die einzige, die ich kannte. Und es war nie meine Art gewesen, meine Wut und Enttäuschung in die Öffentlichkeit zu tragen. Ich war nur mitgekommen, weil mich Mona, eine Bekannte aus der Nachbarschaft, im wahrsten Sinne des Wortes mitgezogen hatte.
Doch nun konnte ich nicht verhindern, ja, wollte ich nicht verhindern, dass der geballte Zorn der Masse, in Worte gefasst von dem jungen Wortführer an der Uhr, mich an diesem Ort erfasste. Im Gegenteil. Ich ließ mich von der Welle mitreißen, spürte sogar einen Hauch von Euphorie, eine Ahnung von Hoffnung, fast den Glauben daran, vielleicht doch etwas verändern zu können. Nicht auf ewig gezwungen zu sein, in dem Kreislauf aus Verpflichtungen und zerbrochenen Träumen festzuhängen.
Als der Mann hinter der fast fensterlosen grauen Fassade unserer Regierung zurief, sie solle sich uns, der Zukunft der Stadt, der sie angeblich diene, stellen, da empfand ich seine Worte nicht als Pathos, sondern als Ausdruck eines Gerechtigkeitsgeistes, den ich schon lange unter dem Schleier der Resignation begraben wähnte.
Aber natürlich geschah nichts. Falls sie überhaupt in dem Gebäude waren, so blieben die Gesichtslosen in ihrem Klotz, lachten wahrscheinlich in ihren Kammern über diesen Haufen Kinder, der seinen Frust hinausschrie und für ein paar Momente tatsächlich glaubte, etwas ändern zu können.
Es war letztlich genau dieses Schweigen, diese Demonstration von Gleichgültigkeit, die meinem Zorn eine Verzweiflung beimischte, die dafür sorgte, dass ich mich mit dem Bad in der Menge aus Gleichgesinnten nicht mehr zufrieden geben konnte.
Wie von Sinnen und mir selbst völlig fremd rannte ich auf das quadratische Gebäude zu, trommelte gegen das mir nächstgelegene Tor, als sei es nicht der Eingang zum Herz meines Gefängnisses, sondern sein Ausgang.
»Warum lehrt ihr uns Vielfalt, wenn es nur Einfalt ist, die ihr wollt?«, rief jemand, und es dauerte einige Momente, bis mir klar wurde, dass ich selbst dieser Jemand war.
Als ich mich nach gefühlten Stunden tränenüberströmt und entkräftet zu Boden sinken ließ, die Finger blutig von meinen Versuchen, namen- und gesichtslose Menschen aus ihrem namen- und gesichtslosen Klotz zu locken, bot sich mir ein verstörendes Bild.
Ich war nicht die Einzige, die ihrer Wut schließlich auf individuelle Weise Ausdruck verliehen hatte. Der Uhr fehlten die Zeiger und einige Ziffern, der Boden und die Gebäudewände waren mit faulem Obst übersät. Einige versuchten, die wenigen Fenster mit Steinen und brennendem Müll zu bewerfen, aber die meisten der Geschosse fielen nur herab, trafen sogar fast ein Mädchen, das unter einem der Fenster stand und eine heftig blutende Wunde am Arm dazu nutzte, mit dem Blut etwas an die Wand zu schreiben, das meine tränenden Augen nicht erkennen konnten. Für die Geschosse hatte sie keinen Blick.
Ich weiß nicht mehr, was mich mehr schockierte: der Anblick der sinnlosen Verwüstung auf dem Platz, dieser Teenager, dessen Schmerz weit genug reichte, um sich nicht mehr um seinen Körper zu kümmern, oder diese Leute, die sich nicht darum scherten, wenn ihre Geschosse Unschuldige trafen. Was es auch war, jegliche vielleicht einmal empfundene Euphorie war längst verschwunden, ebenso wie die Wut. Was blieb, war eine tiefe Verängstigung, die mich lähmte, ehe es mir endlich gelang, mich hochzurappeln und dem Schlachtfeld zu entfliehen, das in völliger Anwesenheit von Feinden entstanden war.
Fast schon panisch lief ich durch die Stadt, stieß dabei beinahe mit einem Schäfer zusammen, der mein Tun mit einem genervten Schnalzen kommentierte und sich sonst ebenso wenig wie die anderen Passanten um das scherte, was wenige Meter entfernt im Herzen ihres Gefängnisses vor sich ging.
***
Meine Mutter, eher verwundert als erzürnt über die Teilnahme ihrer sonst so unpolitischen Tochter an einer Demonstration, erzählte mir später, die Wächter seien nicht eingeschritten. Man hatte die Leute wüten lassen, bis sie wie ich nach und nach von selbst gegangen seien. Inzwischen herrschte wieder Ruhe auf dem Platz.
Morgen würde man höchstens noch die Köpfe über uns schütteln.
***
Sie kamen am frühen Morgen, um mich abzuholen. Schlaftrunken und von den Ereignissen des vergangenen Tages erschöpft, konnte ich meine Gedanken gar nicht richtig ordnen, als sie plötzlich vor meinem Bett standen, die Körper und Gesichter so verhüllt, dass ich nicht einmal erkennen konnte, ob ich Frauen oder Männer vor mir hatte.
Unser kleines Haus war ebenso leer wie die Straße, durch die sie mich schweigend führten, meine immer panischeren Nachfragen, was das alles solle, völlig ignorierend. Als wir an der Ecke zum nächsten Gässchen angelangt waren, legten sie mir, noch immer schweigend, eine Binde über die Augen, und als ich aufschreien wollte, knebelten sie mich. Ich hoffte, einer der Nachbarn hatte mich vielleicht zuvor schon gehört und würde bemerken, dass mich diese Fremden fortbrachten. Doch falls dem so war, blieb die erhoffte Hilfe aus.
Ich stolperte Treppen hinab, und nur die eisernen Griffe der Gesichtslosen hinderten mich daran, zu stürzen. Feuchte Luft und der unebene Boden ließen mich vermuten, dass ich mich unter der Erde befand, aber Panik und Verwirrung beherrschten mich zu stark, als dass ich auch nur einen Hauch von Orientierung hätte haben können. Ich hörte meine hektische Atmung und den gleichmäßigen Schritt der Gesichtslosen, nahm auch einen leichten Geruch nach Schweiß und Feuer wahr und meinte, ein Flackern vor meiner Augenbinde zu erkennen. Auf meine heiser gestotterte Frage, wo ich mich befände, bekam ich keine Antwort.
Schließlich ging es wieder bergauf. Ich stieg Treppen hinauf und hörte das Knarren einer Tür, dann hatte ich den Eindruck, als würde es vor meiner Augenbinde heller. Weitere Treppen, dann drückte mich jemand auf einen Stuhl. Wieder keine Reaktion auf meine Nachfragen, was das alles solle und wo ich mich befände. Mittlerweile erwartete ich sie schon gar nicht mehr.
Die Arme wurden mir auf dem Rücken zusammengebunden, dann hörte ich, wie sich Schritte entfernten und eine Tür geschlossen wurde. Mir war klar, dass ich der Falle saß. Oder besser gesagt, in einem Gefängnis, schlimmer als die Stadt selbst.
Ich versuchte, meinen Puls durch Atemübungen zu senken, die meine Mutter meiner Schwester und mir beigebracht hatte. Es klappte nicht so gut, wie ich es mir wünschte, aber wenigstens gelang es mir, meine Panik in den Griff zu bekommen. Nach ein paar Minuten atmete ich wieder etwas ruhiger.
Mit dieser Entwicklung hatte ich nicht gerechnet. Erinnerungen an Geschichten aus der alten Zeit durchströmten mich. Daran, was man früher alles mit den Menschen angestellte, die sich gegen die Regierungen gestellt hatten. Würde man mich foltern? Oder sogar … töten? Und was war mit meiner Familie? Wo war sie gewesen, als man mich mitgenommen hatte?
Eine neue Welle der Panik drohte mich zu überrollen, als ein Klicken ertönte, das ich der Tür zuordnete. Schritte ertönten, Stühle wurden gerückt. Die Lichtverhältnisse vor der Augenbinde änderten sich erneut, dann wurde sie mir abgenommen.
Ich musste blinzeln und meinen Kopf wegdrehen, denn das Licht einer der seltenen elektrischen Tischlampen war geradewegs auf mich gerichtet. Erst, nachdem sich meine Augen ausreichend an die plötzliche Helligkeit gewöhnt hatten, bemerkte ich die beiden reglosen Gestalten, die mir gegenüber saßen. Da sie im Schatten verborgen blieben, konnte ich kaum Einzelheiten erkennen, nur vage, unförmige Schemen. Aber selbst, wenn ich mehr hätte erkennen können – wahrscheinlich trugen auch sie die Gewänder und Masken, die sie als Mitglieder der Regierung auszeichneten.
»Was soll das?«, fragte ich erneut. Ich wollte meine Stimme wütend klingen lassen, aber es wurde nur ein heiseres Piepsen daraus.
Zu meiner Verwunderung erwartete mich dieses Mal nicht nur Schweigen.
»Wir haben dich beobachtet«, sagte der linke der beiden Schemen. Seine Stimme klang männlich.
Ich musste schlucken. »Bei der Demonstration?« Die Erinnerung an die Geschehnisse des letzten Tages kam mir auf einmal sehr weit weg vor. Ich hatte noch keine Zeit gehabt, über sie nachzudenken, und dass ich überhaupt dort gewesen war, fühlte sich nun so fremd an. Ob es normal war, nach einer Demo verhört zu werden? Ich hatte davon noch nie etwas gehört, aber was hieß das schon? Wenn auch nur die Hälfte der Gerüchte über die Regierung stimmte, würde nie jemand hiervon erfahren. Meine Gedanken glitten zu den Vermissten, die hin und wieder ohne ein Abschiedswort verschwanden. Verdammt, worauf hatte ich mich nur eingelassen?!
»Auch«, antwortete der Mann, und die Sanftheit seiner Stimme konnte meine Beunruhigung nicht lindern. »Und vorher.«
»Wie gefällt dir deine Arbeit als Kleinkinderbeaufsichtigung?«, erkundigte sich der zweite, schmalere Schemen mit der Stimme einer Frau. Sie klang kühler als ihr Kollege, und irgendwie lauernd.
Dieses Mal war es nicht das Licht, sondern die Überraschung, die mich blinzeln ließ. Mit dieser Frage hatte ich nicht gerechnet.
»Gut.« Meine Antwort klang mehr wie eine Frage, was man mir offenbar anmerkte, denn nach einem Moment schwer lastender Stille sagte die Frau: »Tatsächlich? Wir hatten nicht den Eindruck, als seiest du mit besonderer Begeisterung bei der Sache.«
»Woher wollt ihr das wissen?«, fragte ich widerwilliger als beabsichtigt und biss mir auf die Lippe. Verdammt, das hatte ja praktisch wie ein Eingeständnis geklungen!
Ich konnte die Frau nicht sehen, hatte aber den Eindruck, dass sie lächelte. Besonders warmherzig klang es jedoch nicht gerade, als sie antwortete: »Niemand weiß, wer wir sind. Wir könnten der Mann sein, der vor dem Fenster die Straße kehrt. Wir könnten deine Kollegin sein, dein Vater oder deine Mutter. Ja, wir könnten sogar Milos sein oder Mona. Vielleicht sind wir sie alle. Vielleicht sind wir immer überall und wissen alles.«
»Wer ist Milos?«
»Der junge Mann, der eure Meute heute Nachmittag mit so kämpferischen Worten aufgewiegelt hat.«
»Der an der Uhr?«
»Genau der.« Die Frau hustete.
»Er ist zu jung«, antwortete ich. »Und Mona auch. Selbst meine Eltern sind zu jung, um zu euch zu gehören.«
Dieses Mal lachte die Frau offen, wenn auch leise. »Oh glaub mir, Nihile, auch wir bilden Nachwuchs aus. Die Anonymität mag unseren Identitäten Unsterblichkeit geben, unsere Körper aber sind endlich. Aber wie dem auch sei … sag mir, warum bist du unzufrieden?«
»Ich bin nicht unzufrieden.«
Wieder so ein unangenehmer Moment der Stille. Irgendwie kam mir das Schweigen spöttisch vor.
»Sag mir, konntest du dich mit Milos’ Worten identifizieren? Ach, antworte nicht.« Die Frau machte eine wegwerfende Handbewegung, wobei ihr rechter Arm kurz unverdeckt in Licht getaucht wurde. Zu meiner Überraschung war er völlig faltenfrei. Dabei mussten die Gesichtslosen doch inzwischen alle mindestens sechzig Jahre alt sein!
Am Handgelenk baumelte ein Band mit kleinen weißen Anhängern, aber die Frau zog den Arm zu schnell wieder zurück, als dass ich weitere Einzelheiten hätten erkennen können.
»Natürlich konntest du dich mit ihnen identifizieren«, fuhr sie nun unbeeindruckt fort, als habe sie nicht gerade einen Teil der sonst so sorgsam gehüteten Maskerade fallenlassen. »Deine Reaktion hat das deutlich gemacht. Du bezichtigst uns also der Lüge. Nun, wenn du von uns Wahrheiten möchtest, solltest du mit gutem Beispiel vorangehen. Lüg uns nicht an, Nihile. Warum hättest du an dieser Protestaktion teilnehmen sollen, wenn du zufrieden wärst?«
Ich öffnete den Mund für eine Antwort und schloss ihn wieder.
»Je länger du schweigst, desto länger dauert das hier«, meinte der Mann, dessen Anwesenheit ich fast vergessen hatte.
Es dauerte dennoch einige Sekunden, ehe ich antwortete. »Sie sind zu laut. Die Kinder. Und sie hören nicht auf mich. Ihr Gebrüll verursacht mir Kopfschmerzen.«
»Warum hast du dir dann diesen Beruf ausgesucht?«, fragte die Frau. »Dass die Kinder nicht den ganzen Tag brav in der Ecke sitzen würden, hättest du dir gewiss vorher denken können.«
Ich lachte bitter auf. »Ausgesucht?«, echote ich ungläubig. »Seit wann habe ich mir das ausgesucht? Ich hatte die Wahl, draußen auf den Bauernhöfen zu helfen, die Kinder zu betreuen oder die Aborte zu reinigen. Na, was habe ich da wohl ausgewählt? Wer will schon sein ganzes Leben lang Aborte reinigen? Dagegen klingt sogar lebenslanges Windelwechseln attraktiv. Und sehe ich so aus, als wäre ich für körperliche Arbeit geeignet?« Meine Mutter jammerte ständig darüber, dass sich an mir kein Gramm Fett festzusetzen schien. Ich war zu dünn und kraftlos und konnte es mittlerweile nicht mehr auf die Pubertät schieben.
»Was hättest du dir denn ausgesucht, wenn du die freie Wahl gehabt hättest?«, wollte die Frau wissen. Ihre Stimme hatte wieder etwas Lauerndes und klang wie eine Warnung, besser aufzupassen, was ich antwortete. Dennoch entschied ich mich dieses Mal für die Wahrheit.
»Irgendwas Kreatives«, murmelte ich.





























