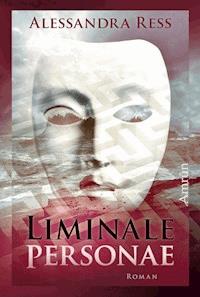Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: OHNEOHREN
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
… Lade Interface … … Willkommen in Holus … Username: _ Passwort: _ Das Leben ist ein Spiel. Zumindest in Lucies Freizeit. Die junge Frau sieht sich in ihrem Schulalltag mit Mobbing konfrontiert. Doch wie alle anderen Jugendlichen, deren gesellschaftlicher Stand es erlaubt, entflieht sie der Grausamkeit der Realität mit dem regelmäßigen Einloggen in die Simulation Holus. Virtuelle Menschen kämpfen hier in blutigen Kriegen. Götter verheeren Landstriche aus kunstvoll angeordneten Pixeln. Die Spieler aus der Primärrealität schwingen sich zu Herrschern auf. Doch wo endet die Wirklichkeit und an welcher Stelle beginnt das Spiel? Gibt es DIE Wirklichkeit überhaupt? Und wird Lucie Antworten auf diese Fragen finden?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 584
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Spielende Götter
Die Deutsche Bibliothek und die Österreichische Nationalbibliothek verzeichnen diese Publikation in der jeweiligen Nationalbibliografie. Bibliografische Daten:
http://dnb.ddp.de
http://www.onb.ac.at
© 2015 Verlag ohneohren, Ingrid Pointecker, Wien
1. Auflage
Autorin: Alessandra Reß
Covergestaltung: Ingrid Pointecker
Coverillustration: ARTEMENKO VALENTYN | shutterstock.com
Lektorat, Korrektorat: Verlag ohneohren
www.ohneohren.com
ISBN: 978-3-903006-39-3
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und/oder des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1 - Holus - Heimkehr
Kapitel 2 - Primärrealität - Ethik
Kapitel 3 - Holus - Zweifel
Kapitel 4 - Primärrealität - Verletzt
Kapitel 5 - Primärrealität/Holus Göttermodus - Lichtgöttin
Kapitel 6 - Primärrealität - Planung
Kapitel 7 - Holus - Spielfiguren
Kapitel 8 - Holus - Dämonen
Kapitel 9 - Primärrealität/Holus - Ankündigungen
Kapitel 10 - Primärrealität - Kontaktaufnahme
Kapitel 11 - Primärrealität - Ophelia
Kapitel 12 - Holus - Dem Tod begegnen
Kapitel 13 - Holus - Portal
Kapitel 14 - Holus - Cytear
Kapitel 15 - Primärrealität/Holus - Mord
Kapitel 16 - Holus - Offenbarung
Kapitel 17 - Primärrealität/Holus - Beben
Kapitel 18 - Holus - Aufstand
Kapitel 19 - Holus - Versteck
Kapitel 20 - Primärrealität/Holus - Veränderungen
Kapitel 21 - Holus - Warnung
Kapitel 22 - Holus/Primärrealität - Sterben
Kapitel 23 - Primärrealität/Holus - Kontrollverlust
Kapitel 24 - Primärrealität/Holus - Realität
Kapitel 25 - Holus - Eindringlinge
Kapitel 26 - Holus - Licht
Kapitel 27 - Primärrealität/Holus - Mondschein
Kapitel 28 - Primärrealität - Anfang
Epilog - Holus - Unsicherheit
Glossar
Die Autorin
Mehr Lesestoff von Alessandra Reß
1
Holus
Heimkehr
Den Begriff „Heimat“ verband Anpharis schon immer mit Schlamm, Regen, Dreck und dem Geruch nach schalem Bier. Als er durch das Tor ritt, das die Grenze von Fargisheim zur Außenwelt markierte, wusste er wieder, weshalb.
Feiner Nieselriegen fiel vom stets grauen Himmel, benetzte Haare und Bart und fraß sich langsam, aber unbarmherzig durch die Kleidung, die sich schon bald unangenehm klamm anfühlte. Kinder, in Lumpen von undefinierbarer Farbe gekleidet, spielten an den Wegesrändern und die Schichten von Schlamm und Dreck auf ihren Gesichtern verdeckten Wunden, hohle Wangen und Entzündungen.
Neugierig blickten sie zu Anpharis auf, wenn er an ihnen vorbeiritt, hofften vielleicht, er würde etwas an sie abgeben von dem Reichtum, den sie von ihm erwarteten, weil er ein Pferd hatte und eine Rüstung trug, der man ihre Schäden auf den ersten Blick nicht ansah.
Doch Anpharis besaß nichts mehr, was er ihnen hätte geben können. Ein paar einsame Kupferstücke versteckte er in einem Beutel an seiner Seite, doch die würde er selbst noch brauchen, um das Pferd versorgen zu lassen und sich am Abend bis zur Besinnungslosigkeit zu besaufen, in einem sinnlosen Versuch, einmal mehr zu vergessen, was er hinter sich gelassen hatte.
Nicht zum ersten Mal fragte er sich, warum er sich überhaupt die Mühe gemacht hatte, nach Fargisheim zurückzukehren. Viele Städte hatte er in den letzten Wochen gesehen und keine andere war ihm so unfreundlich und abweisend wie diese vorgekommen. Hier erwarteten ihn bloß Erinnerungen – und keine der angenehmen Art.
Zumindest fast keine. Auch Xelic erwartete ihn hier, jedenfalls, wenn er nicht inzwischen gehenkt worden war. Wahrscheinlich war er der Grund, weshalb Anpharis doch immer wieder zurückkehrte. Xelic stand zwar auf der anderen Seite des Gesetzes und kam meist zu seinem Essen, indem er es von anderen stahl, aber er war auch sein Halbbruder und damit der letzte Verwandte, der Anpharis geblieben war.
Abgesehen davon – Fargisheim verstand er zumindest. Er wusste, was die Menschen hier beschäftigte, nämlich die Frage, wie sie es schaffen sollten, den nächsten Tag zu überleben, ohne zu verhungern. Ja, diesen Ort zu verstehen war einfach. Der Rest der Welt war für ihn dagegen zu einem unangenehmen Rätsel geworden. Ein Rätsel aus sinnlosen Kämpfen, vergossenem Blut und Menschen, so kalt wie der Stahl, den Anpharis an seiner Seite trug.
Endlich erreichte er die Hütte, in der Xelic lebte und in der er auch ihn wohnen ließ - während der glücklicherweise meist begrenzten Zeit, die er in Fargisheim verbrachte.
Anpharis stieg von meinem Pferd Chvelios, um das er sich kümmern wollte, sobald er sich vergewissert hatte, dass es Xelic gut ging.
Mit der Faust hämmerte er an die hölzerne Tür.
Es vergingen einige Augenblicke, dann wurde geöffnet. Eine junge Frau mit strähnigem blondem Haar und einem schlafenden Kleinkind auf dem Arm blickte ihm entgegen.
Anpharis wurde heiß und kalt. Was tat diese Frau hier, in Xelics Hütte? Er wusste, wie sehr sein Halbbruder an diesem Haufen Holzbretter hing, er hätte sie niemals freiwillig verlassen. Aber vielleicht … hatte er ja eine Familie gegründet? Der Gedanke erschien Anpharis absurd. Zwar wusste er um die Wirkung Xelics auf die Frauen von Fargisheim, die den einfachen Dieb gerne zum edlen Helden hochstilisierten, der die in Fargisheim eigentlich nicht existierenden Reichen bestahl, um den Armen zu helfen. Aber er hatte selten mehr als beiläufiges Interesse an ihnen gezeigt.
„Was denn?“, fragte die Frau mit heller Stimme und musterte ihn dabei mit der typischen Mischung aus Neugier und Misstrauen, welche die Menschen in Fargisheim ihm häufig entgegenbrachten, obwohl die meisten ihn zumindest vom Sehen kannten. Da es in Fargisheim abgesehen von den unzureichend ausgebildeten Wachen keine Krieger gab, war Anpharis im Laufe der Zeit unweigerlich zu einer Stadtberühmtheit geworden. Allerdings war es nun schon fast wieder ein Jahr her, dass er zuletzt hier gewesen war. Insofern konnte er auch nicht ausschließen, dass sein Bruder inzwischen eine Familie gegründet hatte.
„Ich suche Xelic“, antwortete er der Frau und bemühte sich um einen neutralen Tonfall.
„Der lebt nicht mehr hier“, entgegnete sie.
„Was soll das heißen, er lebt nicht mehr hier?“ Innerlich verkrampfte Anpharis sich. Nie, niemals hätte Xelic diesen Ort freiwillig verlassen …
„Wir haben getauscht“, gab sie ungeduldig zurück und verlagerte ihr Gewicht von einem Fuß auf den anderen. „Er lebt jetzt weiter oben, gleich neben der Taverne.“
„Getauscht?“, wiederholte Anpharis verwundert.
„Ja, getauscht. Er kam sowieso kaum noch einen Abend von der Taverne nach Hause und so viel Platz hat er auch nicht gebraucht. Deshalb haben wir getauscht. Ist das so schwer zu verstehen?“, schloss sie und blickte Anpharis herausfordernd an.
„Nein“, antwortete er langsam. „Danke für Eure Auskunft.“
Die Frau nickte, rollte dabei genervt mit den Augen und schloss die Tür, noch bevor sich Anpharis zum Gehen wandte. Verwirrt blieb er vor der Hütte und blickte an die Stelle, wo die Frau gestanden hatte. Was sie ihm erzählt hatte, klang in seinen Ohren völlig seltsam. Xelic sollte diese Hütte, ein Familienerbstück, an dem er so sehr hing, einfach getauscht haben? Das konnte sich Anpharis kaum vorstellen.
Wie in Trance griff er nach den Zügeln Chvelios‘ und führte ihn weiter den Berg hinauf.
Auch, dass Xelic so viel Zeit in der Taverne verbringen sollte, stimmte Anpharis nachdenklich. Sein Bruder hatte stets behauptet, für seinen Beruf einen klaren Kopf und keine zitternden Hände gebrauchen zu können. Der Trinker in der Familie war immer Anpharis gewesen.
Während er den Stadtberg hinaufging, auf dessen Spitze die heruntergekommene Burg thronte, in deren Ruinen der wie der Rest der Bürger völlig verarmte Statthalter residierte, bemächtigte sich des Kriegers ein Gefühl des Verlusts. Auf einmal wurde ihm etwas klarer, weshalb er immer wieder nach Fargisheim zurückkehrte: Es war dieses Quäntchen an Vertrautheit, das er an diesem von allen Göttern verlassenen Ort schätzte. Doch je näher er der Taverne kam, desto mehr beschlich ihn das Gefühl, selbst diese Vertrautheit könne ihm abhandengekommen sein.
Da er nicht wusste, in welchem Gebäude Xelic inzwischen lebte, beschloss Anpharis zunächst die Taverne aufzusuchen. Es war ohnehin der einzige Ort, an dem er Chvelios unterbringen konnte.
Nachdem er ihn an einen Knecht übergeben hatte, betrat der Krieger den Schankraum. Hier hatte sich nichts verändert. Schon beim Reinkommen torkelten Anpharis zwei Betrunkene entgegen, obwohl die von dichten Wolken verdeckte Sonne im Zenit stand. Innen war es laut und voll; wer in Fargisheim ein paar Münzen verdient hatte, gab sie hier sofort wieder aus. Anpharis schlängelte sich durch die Menschenmenge, die mehr oder minder respektvoll versuchte, ihm Platz zu machen. Da der Großteil der Anwesenden allerdings kaum noch nüchtern genug war, um ihn wahrzunehmen, wurde er dennoch ständig angerempelt.
„Anpharis!“ Der Wirt erkannte ihn noch. Die erkleckliche Anzahl an Kupfermünzen, die er bei ihm gelassen hatte, sprach offenbar für ihn. „Aus dem Krieg zurück?“, brüllte er ihm über die lärmende Menge hinweg zu.
Anpharis nickte mit einem schiefen Lächeln und stützte sich auf die Theke, als er sie endlich erreicht hatte.
„Und, wer hat gewonnen?“, fragte der Wirt in lockerem Plauderton.
„Die Falschen, wie immer“, entgegnete Anpharis, was der Wirt mit einem schallenden Lachen quittierte.
Vielleicht denkt er wirklich, dass ich scherze.
„Das Erste geht aufs Haus“, versicherte er Anpharis generös, während er einen Humpen Bier vor ihn stellte. „Aber für eine dauerhafte Unterbringung von deinem Pferd musst du bezahlen. Du hast doch noch dein Pferd?“, fragte er und der Krieger fasste nach seinem Beutel, um für die Unterbringung zu bezahlen.
Nur war der Beutel nicht mehr da.
Fluchend langte Anpharis noch einmal an seinen Gürtel, in der unsinnigen Hoffnung, sich nur vergriffen zu haben, doch wirklich – der Beutel mit den Kupfermünzen fehlte. Jemand musste ihn auf seinem Weg durch die Menge entwendet haben.
„Suchst du den hier?“, kam eine Stimme von hinten und als Anpharis sich umdrehte stand dort Xelic und streckte ihm seinen Beutel entgegen. Mit dem ehrlichsten Lächeln seit Wochen nahm der Krieger ihn entgegen, ehe er sich zu seinem Bruder beugte, um ihn zu umarmen.
„Du kannst nicht erwarten, durch so eine Menschenmenge zu laufen, ohne dass jemand die Gelegenheit nutzt“, erklärte der ihm währenddessen.
„Schön, dich wohlbehalten wiederzusehen“, begrüßte Anpharis ihn, ohne auf seine Worte einzugehen. Sein Lächeln schwand allerdings, als er Xelic genauer musterte. Er wirkte ausgezehrt, seine halblangen dunklen Haare waren verfilzt und seine Haut fleckig. Für hiesige Verhältnisse ging er immer noch als gesund aussehend durch, aber nicht für Xelic, der es immer verstanden hatte, durch seinen Beruf genügend Essen heranzuschaffen. Auch sein Lächeln war nicht das verschmitzte, das Anpharis von ihm kannte. Es wirkte schief, fast traurig.
„Was ist los?“, fragte Anpharis forsch.
Statt einer Antwort wies Xelic zur Seite und verschwand in dieser Richtung in der Menge. Mit dem Bier in der Hand folgte Anpharis ihm in eine etwas ruhigere Ecke.
„Es tut auch gut, dich lebend wiederzusehen“, sagte Xelic ungewöhnlich ernst, als sein Bruder sich zu ihm gesetzt hatte. „Wir haben hier nur wenige Neuigkeiten vom Krieg erfahren, aber die wenigen waren … nun, sie haben mir Sorgen bereitet.“
„Wenn dir etwas Sorgen bereitet, will das schon was heißen“, brummelte Anpharis in seinen Bart. Zwar lächelte er dabei, meinte die Worte jedoch durchaus ernst. Schon immer war Xelic ein unverbesserlicher Optimist gewesen, obwohl seine Kindheit als Bastard wahrlich kein Vergnügen für ihn gewesen sein konnte. Etwas musste ihn nun tief getroffen haben, anders konnte Anpharis sich seine neue Ernsthaftigkeit nicht erklären.
„Und?“, fragte Xelic vorsichtig nach – noch etwas Ungewöhnliches, denn er war jemand, der direkte Worte schätzte.
„Was und?“
„Der Krieg“, hakte er nach. „Wie war er?“
Anpharis zuckte mit den Schultern. „Sinnlos, blutig und verlustreich. Wie immer.“ Sein Versuch, neutral zu klingen, misslang – er konnte die Bitterkeit in seiner Stimme selbst hören.
Xelic betrachtete ihn aufmerksam, doch ehe er etwas erwidern konnte, fragte Anpharis ihn erneut mit Nachdruck: „Und? Was ist hier vorgefallen?“
„Was meinst du?“ Xelic klang so unschuldig, dass Anpharis klar war, dass er nur Zeit zu schinden versuchte.
„Verkauf mich nicht für blöd“, fuhr er ihn mit einer Heftigkeit an, die ihn selbst überraschte. „Du weißt, was ich meine. Was ist los mit dir? Du siehst furchtbar aus. Und die Frau, die in deinem Haus wohnt, sagte, du würdest kaum noch aus der Taverne rauskommen.“
„Ah, Solaila übertreibt immer so maßlos“, wich Xelic der Frage aus. „Es kam vielleicht ein- oder zweimal vor, dass ich den Weg zurück nicht mehr gefunden habe. Dir ist das viel häufiger passiert“, fügte er hinzu, als er Anpharis‘ Blick sah.
„Schon“, gab er unumwunden zu, „aber von dir bin ich nicht gewohnt, dass du auch nur einen einzigen Tropfen zu dir nimmst. Was ist passiert?“
Zunächst zog Xelic es vor, zu schweigen. Während sein Bruder ihm unerbittlich in das ausgezehrte Gesicht mit den tief liegenden braunen Augen sah, ließ er den Blick durch die Taverne schweifen.
Es dauerte eine ganze Weile, bis er wieder etwas sagte. „Sie sind gestorben, weißt du.“ Seine Stimme klang seltsam tonlos.
„Wer ist gestorben?“, fragte Anpharis und versteifte sich innerlich. Im Kopf ging er alle Bekannten durch, die er in dieser Stadt noch hatte, und fragte sich, wen es getroffen haben mochte.
„Alortaila. Und Anlic.“
„Alortaila?“ Anpharis runzelte die Stirn. „Die Hure?“
Xelic wandte den Kopf und sah ihn einen Moment lang böse an, aber sogleich entspannten sich seine Züge wieder. „Ja“, sagte er leise. „Und meine Frau.“
Anpharis hatte gerade den Krug erhoben, um den letzten Rest seines Biers auszutrinken, doch bei dieser Information erstarrte er mitten in der Bewegung. „Deine Frau?“ Ungläubig starrte er seinen Bruder an. Hatte sein Bruder allen Ernstes tatsächlich eine Familie gegründet?
Xelic nickte. „Wir hatten schon länger ein Verhältnis. Ich habe es dir nicht erzählt, als du das letzte Mal hier warst, weil … Na ja, ich wusste nicht, wie ernst sie das meint, immerhin hatte sie ständig …“ Er räusperte sich. „Na, jedenfalls, kurz nachdem du fortgegangen bist, hat sie mir eröffnet, dass sie schwanger ist. Von mir.“
„Woher will sie denn wissen, von wem?“, erkundigte Anpharis sich stirnrunzelnd. „Sie hat doch schon mit so ziemlich jedem … Also, selbst ich …“ Ihm erstarben die Worte auf der Zunge, als er Xelics Blick sah. Innerlich verfluchte Anpharis sich für sein kaum vorhandenes Taktgefühl.
„Sie sagte, sie hätte mit niemandem mehr geschlafen seit Beginn unserer … Beziehung. Das Kind könne nur meines sein.“ Offenbar bemerkte Xelic den zweifelnden Blick Anpharis‘, denn wieder sah er ihn ziemlich finster an und wiederholte mit Nachdruck: „Es kann nur meines sein! Anlic war mein Sohn. Dein Neffe.“ Sein Gesicht verfinsterte sich weiter. „Doch er ist bei der Geburt gestorben. Ebenso wie Alortaila.“
Darauf wusste Anpharis nichts zu erwidern. Mit offenem Mund blickte er seinen Halbbruder an. So seltsam ihm kurz zuvor noch der Gedanke erschienen war, Xelic bei seiner Rückkehr mit einer Familie vorzufinden – nun, da er daran dachte, konnte er ihn sich eigentlich gut als Familienvater vorstellen. Anpharis war sich sicher, dass sein Bruder gut für seine Frau und seinen Sohn gesorgt hätte. Es gab vielleicht niemanden sonst in Fargisheim, der so gewitzt war – er hätte es geschafft, sie auch durch die härtesten Winter zu bekommen. Aber es hatte nicht sein sollen. Sanyse, die Muttergöttin, hatte nicht aufgepasst und Chsandsar, der Gott des Todes, hatte Xelics junge Familie in sein Reich geholt.
„Es tut mir leid“, flüsterte Anpharis und spürte, wie Fargisheim erneut etwas von seiner Vertrautheit verlor.
„Ich habe es in dem Haus nicht mehr ausgehalten, nachdem sie dort gestorben waren“, erklärte Xelic, den Blick zu Boden gerichtet und die Stimme so leise, dass Anpharis sich zu ihm hinüberbeugen musste, um ihn zu verstehen. „Deshalb habe ich Solaila gefragt, ob sie dort einziehen will. Mit den Kindern hat sie dort mehr Platz, ihre Hütte reicht für mich allein. Und für dich findet sich dort auch ein Lager, solange du hier bist. Ich muss zugeben“, fügte er mit etwas deutlicherer Stimme hinzu, „dass ich eine Zeit lang die Methode ausprobiert habe, die du verwendest, um zu vergessen. Aber das ist inzwischen vorbei. Ich bin zum Tee zurückgekehrt.“ Er schnitt eine Grimasse, die ihn aber auch nicht fröhlicher erscheinen ließ. Dann seufzte er. „Es macht sie nicht wieder lebendig, wenn ich mich betrinke, weißt du.“
Anpharis nickte langsam. „Ja“, bestätigte er leise, „ich weiß.“ Sein Blick wanderte in seinen eigenen Bierkrug, der inzwischen leer war. Früher war er heimgekehrt, hatte sich betrunken, bis er die Schreie der Vergangenheit vergessen hatte. Die Normalität seiner Heimat hatte es ihm ermöglicht, weiterzumachen wie zuvor. Zweifelnd, aber mit der Sicherheit, stets nach Fargisheim zurückkehren und hier alles ihm Verbliebene so vorfinden zu können, wie er es zurückgelassen hatte. Doch als Anpharis nun Xelics trauriges Lächeln sah, bekam er das Gefühl, dass ihm selbst dieser letzte Funken von Sicherheit genommen worden war.
2
Primärrealität
Ethik
„Was wir erschaffen haben, müssen wir mit dem Respekt behandeln, von dem auch wir erwarten würden, dass unsere Erschaffer ihn uns entgegenbrächten“, dozierte Frau Casion und schritt dabei aufmerksam vor uns Schülern auf und ab. „Wir dürfen die Virtuellen nicht nur als Spielfiguren behandeln …“
„Aber das sind sie doch“, warf Diotima ein.
Träge wandte ich den Kopf zu ihr und sah, wie sie mit verschränkten Armen und gerunzelter Stirn der Lehrerin entgegenblickte. „Ihr einziger Zweck besteht darin, Spielfiguren zu sein“, fuhr sie fort. „Dazu wurden sie geschaffen.“
Frau Casion nickte bedächtig mit dem Kopf. „Und doch gibt uns das nicht das Recht, mit ihnen zu verfahren, als seien sie bloße Objekte“, hielt sie den Worten Diotimas entgegen. „Jüngste Forschungen haben einmal mehr ergeben, dass sie Emotionen genauso stark empfinden wie wir, ebenso wie Schmerzen. Jeder von ihnen ist individuell und jeder von ihnen spürt individuellen Schmerz. Wenn sie sterben, werden sie nicht einfach ersetzt. Sie vergehen und zurück bleiben die Hinterbliebenen, die um sie ebenso trauern, wie auch wir um unsere Verstorbenen trauern.“
Diotima lachte auf. „Das ist doch lächerlich!“, rief sie und ihre Stimme pendelte zwischen Ungläubigkeit und Belustigung. „Es ist ja nicht so, als wären sie tatsächlich da. Sie existieren doch nicht mal richtig, sie sind nur … Ideen, Figuren, die sich irgendein Designer ausgedacht hat!“
„Ideen mit Gefühlen“, bestätigte die Lehrerin. „Lassen Sie sich auf das folgende Experiment ein, Fräulein Diotima“, fügte sie hinzu, als sie sah, wie die Angesprochene zu einer Entgegnung ansetzte. „Gehen Sie einmal davon aus, wie es wäre, wenn Sie selbst nur eine solche Idee wären – die Idee eines Gottes. Es gibt viele Menschen auf dieser Erde, die uns tatsächlich nur für das halten, für eine Idee von Göttern. Unsere ganze Welt ist ihnen zufolge nur der Vorstellung von höheren Wesen entsprungen.“
„Aber das ist bescheuert!“, warf Diotima ein.
Frau Casion schüttelte den Kopf. „Lassen Sie mich dieses Gedankenexperiment zu Ende führen“, bat sie und fuhr fort. „Wenn dem tatsächlich so ist, so wissen wir nichts davon. Für unser Leben ändert sich nichts. Wir sind weiterhin hier, unterhalten uns über die Virtuellen, spüren Schmerz, wenn wir hinfallen, trauern um Verstorbene und freuen uns über das tolle Wetter. Und genauso ist es mit den Virtuellen. Sie sind sich dessen sogar bewusst, dass sie nur den Ideen von Göttern entstammen, auch wenn sie nicht wissen, dass wir diese Götter sind. Aber das ändert nichts daran, dass auch sie sich tagtäglich freuen, traurig oder zufrieden sind, wütend oder glücklich werden. Verstehen Sie, was ich Ihnen sagen will, Fräulein Diotima? Verstehen Sie alle, was ich damit sagen will?“, fragte sie und sah sich aufmerksam nach uns anderen um.
„Herr Cyrillian“, wandte sie sich an einen dunkelhaarigen Jungen, der an der von mir aus gesehen rechten Seite des Raums lehnte. Sein Lächeln wirkte verächtlich. „Können Sie mir sagen, was ich meine?“
Ich konnte förmlich spüren, wie die gesamte Klasse inklusive mir selbst die Luft anhielt, als er sich der Lehrerin zuwandte. Man merkte, dass es ihr erster Unterrichtstag in Virtueller Ethik war; die meisten Lehrer begingen nicht zweimal den Fehler, Cyrillian unaufgefordert dranzunehmen.
Doch trotz seines dünnen, verächtlichen Lächelns, fiel seine Antwort vergleichsweise freundlich aus. „Dass Sie der Auffassung sind, wir sollten den Virtuellen am Lichterfest Bonbons schenken und wieder anfangen, uns abzuschlachten, anstatt dabei zuzusehen, wie Bild gewordene Zahlen einander umbringen?“
Frau Casions Mund wurde schmal. Sie warf Cyrillian einen tadelnden Blick zu, von dem sie vermutlich selbst bereits ahnte, wie wenig dieser ihn beeindruckte. Dann wandte sie ihre Aufmerksamkeit wieder dem Rest der Klasse zu. „Jemand anders?“, fragte sie fast beiläufig. Als hätte jetzt noch jemand gewagt, ihr die Antwort zu geben, die sie hören wollte, nun, da Cyrillian deutlich gemacht hatte, was er von ihren Ausführungen hielt. „Vielleicht Fräulein Luciena?“
Scheiße. Ich hätte mein Namensschild etwas schief stellen sollen, sodass sie es nicht so einfach hätte lesen können. Na, jetzt war’s zu spät, aller Augen inklusive der Frau Casions und Cyrillians waren auf mich gerichtet. Das Intelligenteste wäre jetzt gewesen, einfach mit den Schultern zu zucken und „Weiß nicht“, zu brummeln. Leider hatte ich irgendetwas in mir, das es mir unmöglich machte, den einfachsten Weg zu gehen. Vielleicht Stolz. Oder die winzige Chance auf Genugtuung Cyrillian gegenüber, obwohl ich natürlich wusste, dass er es mir erstens heimzahlen würde und er zweitens genauso gut wie ich wusste, worauf Frau Casion hinauswollte. Seine Antwort hatte das gezeigt.
„Sie wollen uns damit sagen, der Auffassung zu sein, dass es im Grunde keinen Unterschied zwischen den Virtuellen und uns gibt“, hörte ich mich sagen, während ich mich gleichzeitig fragte, warum ich verdammt nochmal nicht einfach mit den Schultern gezuckt hatte. „Sie leben wie wir, jedoch fühlen wir uns den Virtuellen überlegen, weil wir wissen, dass wir alles mit ihnen anstellen können. Wir können sie dazu bringen, einander umzubringen. Wir können sie sogar einfach so sterben lassen oder an ihren Informationen rumschrauben, bis sie selbst vergessen, wer sie sind. Aber der Gedanke, es könne Götter geben, die mit uns dasselbe machen und die Erkenntnis, wie wenig wir das mögen würden, sollte uns davon abhalten, mit den Virtuellen allzu sehr zu spielen.“
Unbehagliche Blicke wurden ausgetauscht und meine Klassenkameraden wandten sich betont von mir ab. Nur Cyrillian und seine Leute nicht. Ich sah sie nicht an, doch konnte ich ihre bedrohlichen Blicke auf mir spüren.
„Sehr gut“, sagte Frau Casion. „Ich hätte es nicht besser auf den Punkt bringen können.“ Sie schien erfreut darüber, dass es jemand geschafft hatte, ihrem Gedankengang zu folgen. Danach fuhr sie mit ihrem Monolog fort, der ständig von Diotimas nervigen Einwürfen gestört wurde, doch ich hörte nicht mehr hin.
In Gedanken versuchte ich bereits einen Fluchtplan auszuarbeiten, der mich nach der Stunde sicher vom Klassenzimmer bis nach draußen bringen würde.
Mein Fluchtplan bestand letztlich darin, Raum und Gebäude so schnell wie möglich zu verlassen und mich zur Limousine zu flüchten.
Aber natürlich wurde daraus nichts. Den Klassenraum verließ ich noch unbeschadet, aber ich war auf dem Gang noch nicht weit gekommen, als Chrysantha mich einholte. Sie hakte sich bei mir unter, als seien wir beste Freundinnen, dabei wusste jeder, der einmal das Pech gehabt hatte, Chrysantha von dieser Seite kennenzulernen, dass von ihr untergehakt zu werden im Prinzip nur ein Symbol der Gefangennahme war; Handschellen hatte sie eben nicht, beziehungsweise wären diese selbst für eine Alpha Ludens zu auffällig.
„Nicht so schnell, Lucie“, sagte sie sanft und lächelte mich dabei aus ihren beeindruckend leuchtend grünen Augen an. Ich kannte niemanden, dessen Lächeln gleichzeitig so unschuldig und bedrohlich wirkte. „Meine Freunde und ich wollen dir noch etwas sagen.“
„Ich habe jetzt keine Zeit“, entgegnete ich brüsk und wunderte mich selbst darüber, wie fest meine Stimme klang, obwohl mir doch klar war, was nun kommen musste. Vielleicht war ich es einfach schon so gewohnt, dass ich langsam dagegen abstumpfte.
Chrysantha lächelte breiter. „Diese Zeit solltest du dir nehmen.“
Inzwischen hatten sich auch Chrysanthas Zwillingsbruder Aurelian und sein Freund-Schrägstich-Teilzeitbodyguard Jodokus zu uns gesellt. Ein Uneingeweihter hätte uns für eine Clique gehalten, aber meine sonstigen Klassenkameraden hatten längst das Weite gesucht. Wenigstens blieben dieses Mal nicht noch ein paar Mitläufer, um zuzusehen. Das machte das Ganze immer nur noch unangenehmer.
Ohne, dass ich etwas dagegen tun konnte, bugsierte Chrysantha mich in einen anderen Gang, wobei wir von den beiden Jungen flankiert wurden. Abgesehen von uns war niemand hier, und es hätte wohl auch nichts an meiner Situation geändert. Chrysantha ließ mich los und schubste mich gegen die Wand. Die drei bildeten nun einen Halbkreis um mich. Aurelian blickte mich auf seine üblich ernste Art an, die Arme hatte er vor der Brust verschränkt. Jodokus, der einzige Beta in ihrer Runde, wich dagegen meinem Blick aus. Ich hatte schon häufiger den Eindruck gewonnen, dass er wenig Spaß an diesen Aktionen hatte; vielleicht war es ihm unangenehm, ein Mädchen zu schlagen. Das machte ihn mir trotz der zahlreichen blauen Flecken, die ich ihm verdankte, zum sympathischsten meiner Peiniger. Was zugegebenermaßen nicht viel hieß: Chrysantha war eine gelangweilte, sadistische Schlampe, fast so spielsüchtig wie Cyrillian – und ebenso machthungrig. Doch fehlte es ihr am Tatendrang, um von sich aus aktiv zu werden. Ihren Bruder konnte ich nicht richtig einschätzen. Soweit ich wusste, spielte er kaum, jedenfalls nicht so intensiv wie die meisten Ludens. Natürlich hatte er einen Avatar und herrschte inzwischen auch über eine nicht unbedeutende Stadt, alles andere wäre für einen Alpha Ludens wie ihn auch ein viel zu großer Imageschaden gewesen. Aber er investierte selten Zeit in den Ausbau seiner Macht, sondern hielt sie nur aufrecht und war wohl auch gut darin. Lieber widmete er sich anderen Aktivitäten, angeblich machte er Sport und in der Schule hatte er bereits demonstriert, was für ein toller Klavierspieler er war. So ähnlich wie im virtuellen Leben war es auch hier. Er war immer bei Cyrillians Aktionen dabei, und er tat, was von ihm erwartet wurde. Ob er das aber interessant fand, konnte ich nicht sagen, vermutete aber, dass es ihm eher darum ging, zu zeigen, dass er dabei war. Was nicht heißen sollte, dass er wie Jodokus den Eindruck gemacht hätte, ihm sei die ganze Sache unangenehm. Aurelian konnte extrem grausam sein, wenn er in der entsprechenden Stimmung war. Einmal hatte er einen Ludens, der total aufs Klavierspielen abgefahren war, mit Jodokus besucht und gemeinsam hatten sie ihm vier Finger gebrochen. Der arme Kerl konnte bis heute nicht mehr so spielen wie früher. Und warum das Ganze? Aurelian hatte es genervt, dass ein Lehrer das Klavierspiel des anderen so sehr gelobt hatte.
Ja, die drei waren ein übler Haufen und jeder für sich genommen stellte schon ein ziemliches Problem dar, jedenfalls, wenn man es sich mit ihnen verscherzt hatte. Aber der Oberbösewicht war unangefochten Cyrillian, der sich nun durch ruhige Schritte ankündigte. Offenbar hatte er es für als unter seiner Würde empfunden, sich direkt darum zu kümmern, dass ich nicht abhaute.
„Hallo Luciena“, begrüßte er mich mit einem dünnen Lächeln und gesellte sich in den Halbkreis. Einen Moment lang musterte er mich mit seinen stechend eisblauen Augen nur auf ziemlich unangenehme Art. Dann fragte er mich ruhig: „Was sollte das denn eben?“
Ich zuckte mit den Schultern (was ich besser schon viel früher hätte tun sollen). „Keine Ahnung. Ich hab bloß eine Frage beantwortet. Ist das schon ein Problem für dich?“
Wieder schwieg Cyrillian erst einmal, wobei sein Lächeln einen fast traurigen Ausdruck annahm. „Meine Botschaft an Frau Casion war eindeutig“, entgegnete er schließlich. „Wir gehen auf dieses bescheuerte Thema nicht weiter ein. Jeder hat das offenbar kapiert. Ich glaube, auch du hast diese Botschaft eigentlich verstanden. Wärst du dumm, stünden wir nicht schon wieder hier. Und trotzdem hast du ihr die Antwort gegeben, die sie hören wollte.“ Sein Lächeln verschwand. „Warum?“, fragte er und klang dabei ungewöhnlich böse. Kein gutes Zeichen, schätzte ich.
Dennoch war da diese blöde Angewohnheit von mir, weiter Widerworte zu geben. „Warum nicht?“, gab ich zurück. „Was für ein Problem hast du damit, dass ich einfach diese Antwort gegeben habe? Was ist an dem Thema denn schon so Bedeutsames?“
Sein Blick verfinsterte sich noch weiter – wir wussten beide, dass das ein sehr bedeutsames Thema war. Wie er so dastand, mit den hohen Wangen, der blassen Haut, kurzen braunen Haaren und dem schwarzen Rollkragenpulli, hatte er etwas Gruseliges an sich. Er erinnerte mich an einen Vampir, der sein Opfer begutachtete. Um sein aristokratisch-finsteres Aussehen zu komplettieren, fehlte nur noch ein Gehstock mit Totenkopfknauf.
„Die Lehrerin ist eine Beta Ludens“, erklärte er mir.
„Ebenso wie du, Lucie“, flüsterte Chrysantha und Cyrillian nickte.
„Ebenso wie du“, ergänzte er, weiterhin an mich gewandt. „Wenn die Schwachen meinen, sie müssten sich für Schwache einsetzen, ist das armselig und kann … gefährlich werden. Ich will Frau Casion keinen Vorwurf machen.“, meinte er mit neutralerer Stimme. „Schließlich ist sie angewiesen worden, uns in Virtueller Ethik zu unterrichten, dem undankbarsten Fach, das diese Schule anbietet. Wahrscheinlich ist ihr nicht einmal bewusst, welche Analogien ich in ihren Worten gesehen habe. Aber ich glaube, dir war das sehr wohl bewusst.“ Aus unerfindlichen Gründen kehrte sein Lächeln zurück. „Du weißt, welche Weisheit mein Vater für solche Fälle vorschlägt?“
Ich seufzte und verkrampfte mich innerlich. Hatte ich mich bisher vielleicht noch der Illusion hingegeben, diese Sache nur mit Einschüchterungen überstehen zu können, wurde mir spätestens jetzt klar, dass es so einfach nicht war.
„Wenn jemand deine Macht infrage stellt, bestrafe ihn oder so ähnlich“, rezitierte ich, wobei ich vergeblich versuchte, meiner plötzlich zitternden Stimme einen verächtlichen Klang zu verpassen. Mein Seitenblick fiel auf Jodokus, der seine Fingerknochen knacken ließ, mich dabei aber wenigstens nicht ansah.
„Eigentlich nicht bestrafe“, meinte Cyrillian, „sondern vernichte. Und dann folgt noch ein zweiter Teil, aber mit dem beschäftigen wir uns vielleicht ein andermal. Für heute reicht sogar bestrafen.“ Er nickte Jodokus zu und ging mit den Zwillingen ein Stück nach hinten, um ihm nicht im Weg zu sein.
Jodokus’ Schläge waren nicht allzu schmerzhaft. Ich wusste von anderen, die er ins Krankenhaus befördert hatte, aber bei mir sollten sie wohl vor allem der Demütigung dienen. Und das klappte ganz gut. Ich hatte vielleicht verhältnismäßig lange eine große Klappe, aber wenn ein Kerl wie Jodokus minutenlang Schläge auf einen niederprasseln lässt und man feststellen muss, wie wehrlos man trotz ein paar Stunden in Sachen Selbstverteidigung dagegen noch ist, dann ist die Beherrschung schnell dahin. Solange Jodokus auf mich einschlug, verhinderte irgendetwas, dass ich anfing zu weinen. Doch sobald er von mir abließ, war ich nur noch ein zitterndes Häufchen Elend, sehr zur Befriedigung Cyrillians und der seiner Freunde.
Dieses Mal ging die Tortur jedoch nicht sehr lange. Plötzlich hörte ich jemanden etwas rufen und Jodokus unterließ es, weiter auf mich einzuschlagen. Als ich es wagte, den Kopf zu heben, sah ich die hochgewachsene Gestalt von Siard auf uns zukommen, meinem besten Freund und Chauffeur. Er schrie Jodokus an. Ich war zu sehr damit beschäftigt, mich hochzurappeln, um zu verstehen, was er sagte. Zu meiner Verwunderung ließen Cyrillian und seine Leute kommentarlos zu, dass Siard mich auf die Beine hievte und mit sich zog, fort von der Clique.
Ohne ein weiteres Wort ging Siard mit mir schnellen Schrittes durch den Park vor der Schule. Erst, als er mich auf die Hinterbank des Autos bugsiert, selbst vorne auf der Fahrerseite Platz genommen hatte und losgefahren war, begann er zu sprechen. „Wann willst du das endlich deinem Vater sagen?“, rief er wütend. „Jetzt hab ich dich schon zum zweiten Mal in diesem Monat so vorgefunden! Als du nicht wie die anderen aus dem Gebäude rausgekommen bist, hab ich schon geahnt, dass wieder so etwas vorgefallen ist!“
„Bringt doch nichts, ihm das zu sagen“, murmelte ich. Ich schaffte es, nicht in Schluchzer auszubrechen, holte aber ein Taschentuch hervor, um mir die Tränen wegzuwischen, die ich nicht hatte zurückhalten können. „Was soll er schon dagegen machen? Jeder weiß, dass Cyrillian im Grunde tun kann, was er will. Seine Familie ist die mächtigste weit und breit.“
„Das gibt ihm noch lange nicht das Recht, dich verprügeln zu lassen!“, rief Siard aufgebracht und ich konnte durch den Rückspiegel sehen, wie sich seine dunklen Augen voll Zorn verengt hatten.
„Nein“, entgegnete ich düster, „eigentlich nicht. Aber bisher hat es noch niemand geschafft, etwas dagegen zu machen, oder? Es geht ja nicht nur mir so. Cyrillian, Aurelian und Chrys suchen sich ständig irgendwelche Beta Ludens, die sie fertigmachen können. Solange sie nicht anfangen, Alphas zusammenzuschlagen, wird sich niemand beschweren.“
Siard schüttelte den Kopf. „Das geht einfach nicht“, wiederholte er. „Das ist verdammt nochmal eine Schule! Ihr solltet da drin … rechnen und so Zeug. Stattdessen bekomm ich langsam das Gefühl, dich täglich aus einer Gladiatorenarena abzuholen.“
Er seufzte und beruhigte sich etwas, ebenso wie ich. Ich schaffte es sogar, auf seine Worte hin zu lächeln. Irgendwie hatte die Schule wirklich etwas von einem Kampf in einer Arena. Leider dauerte dieser Kampf Jahre.
„Was war denn dieses Mal der Grund?“, fragte Siard.
„Ach, keine Ahnung“, meinte ich und nun war es an mir, den Kopf zu schütteln. „Irgendwie glaubt er wohl, etwas, was ich gesagt habe, könnte die Alpha Ludens-Herrschaft gefährden oder so ein Quatsch.“
„Ich wünschte, es wäre so“, murmelte Siard und ich lachte.
„Aber das ist doch Quatsch“, wiederholte ich, „als würden wir uns je gegen die Alphas wehren. Wir sind ziemlich zufrieden mit dem, was wir haben. Ich meine, okay, wir müssen arbeiten, aber wer will schon so sein wie die Alphas? Die sind so gelangweilt, ohne Holus würden sie sich wahrscheinlich noch mehr Gemeinheiten einfallen lassen, einfach, um ihre endlose Freizeit zu füllen. Zum Glück hacken sie lieber auf den Virtuellen rum. Meistens jedenfalls“, fügte ich in Erinnerung an das gerade Erlebte hinzu. „Außerdem“, setzte ich noch einmal an, als Siard nichts auf meine Worte erwiderte, „wenn sich einer wehren würde, dann doch eher ihr Laborans.“
„Hm“, machte Siard darauf nur. Ich wusste, diese Gespräche über die Stände trafen ihn auf besondere Art. Er meinte zwar immer, er fände es ganz lustig, mich durch die Gegend zu kutschieren und wir verstanden uns ja wirklich gut. Aber ich wusste auch, dass er manchmal ganz gerne lieber an Orte gefahren wäre, an denen er gerne war.
„Danke übrigens“, meinte ich, auch um von dem Thema abzulenken, das ich zugegebenermaßen etwas unüberlegt angeschnitten hatte.
„Kein Ding“, antwortete er und sah mich durch den Rückspiegel an. „Bist du verletzt?“, fragte er mich, worauf ich den Kopf schüttelte.
Während der weiteren Fahrt sprachen wir nicht mehr miteinander. Ich hing meinen Gedanken nach, die sich noch immer um die letzte Attacke drehten. Siard hatte recht – so konnte es einfach nicht weitergehen. Irgendjemand musste etwas gegen Cyrillian tun. Etwas, das ihn wirklich traf, am besten so sehr, dass er sich davon nicht so schnell erholen würde. Und möglichst sollte man dabei nicht allzu offensichtlich aktiv werden, sonst würde Jodokus einen noch umbringen, ehe man die Früchte seines Werks begutachten konnte.
Mit einem leichten Schwindel im Kopf sah ich zu, wie die Stadt an mir vorbeiglitt. Die Schule lag etwas außerhalb im Westen, der Bereich meiner Familie dagegen im Nordosten. Normalerweise mochte ich die Fahrten mit Siard. Manchmal machten wir auch noch Halt in der Stadt, ehe er mich zu Hause absetzte. Aber heute waren wir beide nicht in guter Stimmung. Ich bekam langsam das Gefühl, dass Jodokus dieses Mal doch etwas fester zugeschlagen hatte: Mein Kopf pochte unangenehm und meine Schulter schmerzte.
Siard schien ebenfalls seinen eigenen Gedanken nachzuhängen. Stur blickte er auf die Straße, ohne einen wirklichen Blick für sie zu haben. Als er einem anderen Ludens-Auto fast hinten drauffuhr, begann er, über dessen Fahrer zu schimpfen.
Ich sparte mir einen Kommentar; wenn er sich beruhigt hatte, würde Siard schon von selbst bemerken, dass der Fehler bei ihm gelegen hatte. Außerdem verstand ich selbst so wenig vom Autofahren, dass es mir lächerlich vorgekommen wäre, Siard auf einen Fehler hinzuweisen. Ich fand es ohnehin fies, ihn in seiner Arbeit zu kritisieren. Es kam mir seltsam vor, dass wir beide fast gleich alt waren. Obwohl wir so viel Zeit miteinander verbrachten und ich Siard als meinen besten – und abgesehen von meiner nebenan wohnenden Cousine auch einzigen – Freund betrachtete, hatte ich manchmal das Gefühl, wir lebten in verschiedenen Welten. Er konnte Autofahren, hatte von Holus aber so gut wie keine Ahnung. Er konnte fast alles reparieren, was im Haus kaputtging, besuchte aber schon seit mehr als drei Jahren nicht mehr die Schule. Ihm gegenüber fühlte ich mich manchmal wie ein kleines, hilfloses Kind, ein andermal hatte ich aber auch das Gefühl, ihm intellektuell hoffnungslos überlegen zu sein. Einmal hatte ich ihn mitgenommen auf einen Ausflug nach Holus; schon nach zwanzig Minuten wäre er fast vom Leibwächter eines aufgebrachten Händlers ermordet worden, weil er überhaupt nicht verstanden hatte, wie er sich verhalten musste.
Heute war ich richtig froh, als endlich der Hügel in Sicht kam, den sich meine Familie mit vier anderen Beta Ludens-Familien teilte. In einer verhältnismäßig kleinen Stadt wie dieser konnten selbst Beta Ludens es sich noch leisten, in eigenen Häusern zu wohnen, worüber ich ziemlich froh war. Meine Cousine wollte in die Innenstadt ziehen, sobald sie die Schule beendet hatte; sie fand es hier draußen zu einsam. Aber mir war das nur recht. Wenn ich in die Stadt wollte, konnte ich schließlich jederzeit Siard anrufen, der mich hinfuhr. Und in der Stadt hatte kaum jemand einen so schönen Garten wie wir.
Für den hatte ich heute aber kaum einen Blick. Siard fuhr durch das Tor und hielt am Eingang. Ich stieg aus dem Wagen, wobei mein linkes Bein unangenehm pochte.
„Ist wirklich alles in Ordnung?“, fragte Siard, der ebenfalls ausgestiegen war und mich über den Rand des Autos hinweg mit einem Stirnrunzeln musterte.
Ich nickte. „Denke schon. Aber ich glaube, ich mag heute nicht mehr weg. Wenn du willst, kannst du heimfahren.“
„Bist du sicher? Ich finde es nerviger, sofort wieder losfahren zu müssen, wenn ich gerade daheim angekommen bin, als einfach direkt hier zu warten.“
Kopfschüttelnd lachte ich. „Keine Sorge. Heute bringen mich keine zehn Pferde mehr in die Stadt. Du kannst beruhigt zu deiner Familie fahren.“
„In Ordnung.“ Siard zögerte, schaute kurz weg und dann wieder zu mir. Zum ersten Mal für heute legte er seine reservierte Art ein wenig ab und ähnelte nun wieder mehr dem Freund als dem Angestellten. „Wenn du noch was brauchst oder was ist … ruf mich einfach an, okay?“
„Klar“, entgegnete ich, etwas überrascht.
Er nickte, hob die Hand zu einem lapidaren Gruß und stieg wieder ins Auto.
„Tschau“, sagte ich, während er bereits mit dem Auto die Auffahrt hochfuhr und kurz darauf durchs Tor verschwand.
Mit einem Seufzen wandte ich mich um und ging ins Haus.
3
Holus
Zweifel
Der Morgen graute und brachte heftige Regenfälle mit sich, die die ohnehin schon rutschigen Wege in wahre Schlammbäche verwandelten. Anpharis befürchtete, die ersten Hütten könnten bald dem Druck nachgeben und den Berg hinabrutschen.
Insofern war es ein Glück, dass Xelic in die winzige Hütte Solailas gezogen war. Schon mit den beiden Brüdern wurde es zwar unangenehm eng, aber die meisten Häuser in der Umgebung waren Steingebäude, Relikte aus Zeiten, da Fargisheim noch einen besseren Ruf genossen hatte. Sie gaben den Schlammmassen nicht so schnell nach, zudem war der Berg hier relativ eben und sogar ein paar Pflastersteine waren im Bereich um die Taverne noch zu finden. Unten, wo Xelics alte Hütte stand, wurde die Situation schneller gefährlich.
Von Anpharis‘ Standpunkt an der Tür aus konnte er durch den Regen schemenhaft die Leute sehen, die unter dem Vordach der Taverne standen und missmutig das Wetter betrachteten. Es war selbst für Fargisheimer Verhältnisse ein kräftiger Guss, und Anpharis vermutete, dass er auch den Feldern der Bauern nicht allzu gut tun dürfte, jedenfalls nicht, falls er noch länger anhielt.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!