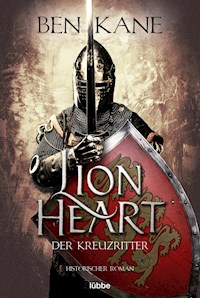
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Löwenherz
- Sprache: Deutsch
König, Politiker, Krieger, Eroberer - Richard Löwenherz!
1189. Endlich regiert Richard Löwenherz als König über England. Noch muss er in seinem eigenen Königreich für Ordnung sorgen, bald jedoch bereitet er einen neuen Kriegszug vor. Jerusalem, das Heilige Land, soll aus der Hand der Muslime befreit werden. Gemeinsam mit seinem treuen Diener Ferdia macht sich Löwenherz auf den beschwerlichen Weg ins Heilige Land. Dort erwartet sie ein gnadenloser Krieg - und Saladin, der berühmte Anführer der Sarazenen, der die Stadt einst von den Christen eroberte. Auf dem staubigen Feld von Arsuf stehen Löwenherz und seine Männer vor ihrer größten Bewährungsprobe ...
Der zweite Teil der Reihe um Richard Löwenherz, erzählt aus der Sicht seines treuen Begleiters
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 730
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über den Autor
Ben Kane
Impressum
Widmung
Personenverzeichnis
Prolog
ERSTER TEIL
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
ZWEITER TEIL
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
DRITTER TEIL
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
VIERTER TEIL
Kapitel XXIII
Kapitel XXIV
Kapitel XXV
Kapitel XXVI
Kapitel XXVII
Kapitel XXVIII
Kapitel XXIX
Kapitel XXX
Kapitel XXXI
Epilog
Anmerkungen des Autors
Über das Buch
König, Politiker, Krieger, Eroberer – Richard Löwenherz! 1189. Endlich regiert Richard Löwenherz als König über England. Noch muss er in seinem eigenen Königreich für Ordnung sorgen, bald jedoch bereitet er einen neuen Kriegszug vor. Jerusalem, das Heilige Land, soll aus der Hand der Muslime befreit werden. Gemeinsam mit seinem treuen Diener Ferdia macht sich Löwenherz auf den beschwerlichen Weg ins Heilige Land. Dort erwartet sie ein gnadenloser Krieg – und Saladin, der berühmte Anführer der Sarazenen, der die Stadt einst von den Christen eroberte. Auf dem staubigen Feld von Arsuf stehen Löwenherz und seine Männer vor ihrer größten Bewährungsprobe …
Der zweite Teil der Reihe um Richard Löwenherz, erzählt aus der Sicht seines treuen Begleiters
Über den Autor
Ben Kane wurde in Kenia geboren und wuchs in Irland auf, im Heimatland seiner Eltern. Bevor er sich ganz dem Schreiben widmete, arbeitete er als Tierarzt. Schon als Kind übte die Geschichte Roms eine große Faszination auf ihn aus, weshalb mit der Veröffentlichung seines Debüts Die Vergessene Legion ein lang gehegter Traum in Erfüllung ging. Mittlerweile ist Ben Kane Bestsellerautor und lebt mit seiner Familie in North Somerset, England.
Ben Kane
DER KREUZRITTER
HISTORISCHER ROMAN
Aus dem Englischen von Dietmar Schmidt
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Deutsche ErstausgabeFür die Originalausgabe:Copyright © 2021 by Ben KaneTitel der englischen Originalausgabe: »Crusader«Originalverlag: OrionFirst published in Great Britain in 2021 by Orion Fiction, an imprint of the Orion Publishing Group Ltd., an Hachette UK Company
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Rainer Delfs, ScheeßelEinband/-Umschlagmotive: © Henry Steadman; © shutterstock: Nejron Photo | ilolabUmschlaggestaltung: Thomas KrämereBook-Erstellung: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-2095-3
luebbe.delesejury.de
Für Ferdia und Pippa.Ihr seid mein Ein und Alles.
PERSONENVERZEICHNIS
Historische Persönlichkeiten sind durch einen * gekennzeichnet.
Ferdia Ó Catháin/Rufus, ein irischer Edelmann aus Nord-Leinster.
Rhys, walisischer Waisenjunge
Robert FitzAldelm, Ritter, Bruder des verstorbenen Guy FitzAldelm
Königshaus von England
Henry II. FitzEmpress* (Heinrich II.), König von England, Herzog der Normandie und Graf von Anjou (verstorben)
Alienor (Eleonore) von Aquitanien*, seine Witwe
Henry (»Hal«, »der Junge König«)*, ältester Sohn Henrys II. (verstorben)
Richard*, König von England und zweiter Sohn von Henry II.
Geoffrey*, Graf der Bretagne und dritter Sohn Henrys II. (verstorben)
John*, Graf von Mortain, jüngster Sohn Henrys II., auch bekannt als »Lackland« (Johann Ohneland)
Joanna* (Johanna von England), Königin von Sizilien, Tochter Henrys II.
Englischer Königshof
Beatrice, Zofe Königin Alienors
André de Chauvigny*, Ritter und Cousin von König Richard
Baudouin de Béthune*, Ritter
William Longchamp*, Bischof von Ely, Richards Justiziar
Hugh de Puiset*, Bischof von Durham
Geoffrey*, unehelicher Sohn Henrys II., Erzbischof von York
William Marshal*, einer von Richards Justiziaren
Bardolph*, FitzPeter* und Bruyère*, ebenfalls Justiziar Richards
Philip, Richards Knappe und Freund von Rufus
Geistlichkeit
Erzbischof Walter von Rouen*, Erzbischof Gerard von Auxienne*, Bischof Hubert von Salisbury*, Bischof John von Evreux*, Bischof Nicholas von Le Mans*
Jean d’Alençon*, Erzdiakon von Lisieux, früherer Vizekanzler von England
Hugues de la Mare*, Schreiber
Ambroise*, Geistlicher und Verfasser der erhaltenen Chronik des Kreuzzugs L’Estoire de la guerre sainte
Prior Robert von Hereford*
Ralph Besace*, heilkundiger Geistlicher
Adel
Robert, Earl von Leicester*, Graf de Pol*, Graf Robert de Dreux*
Ritter
Robert de Turnham*, Geoffrey du Bois*, Pierre und Guillaume de Preaux*, John FitzLucas*, Bartholomew de Mortimer*, Ralph de Mauleon*, Henry Teuton*, Henry de Sacey*, William de l’Etang*, Gerard de Furnival*, Jacques d’Avesnes*, Matthew de Sauley*, Peter Tireproie*, de Roverei*, Richard Thorne
Guillaume de Caieux*, flämischer Ritter
Richard de Drune, Hugh de Neville*, Soldaten
Andere Figuren:
William*, König von Schottland
Philippe Capet* (Philipp II. August), König von Frankreich
Alys Capet*, Philippes Schwester, seit ihrer Kindheit mit Richard verlobt
Henri de Blois*, Graf der Champagne und Cousin sowohl Richards als auch Philippe Capets
Philippe*, Graf von Flandern
Guillaume des Barres*, ein berühmter französischer Ritter
Raymond*, Graf von Toulouse
Hugues*, Herzog von Burgund, Cousin des französischen Königs
Joffroi*, Graf von Perche
Pierre*, Graf von Nevers
Bischof von Beauvais*, Cousin des französischen Königs
Dreux de Mello*, Edelmann
Albéric Clément*, Ritter
Sizilien
Guillaume II. de Hauteville* (Wilhelm II. von Sizilien), König von Sizilien (verstorben)
Constance de Hauteville*, Guillaumes Tante und Erbin, verheiratet mit Heinrich VI. von Hohenstaufen*, römisch-deutscher König und Erbe des Kaisers des Heiligen Römi-schen Reiches, Friedrich Barbarossa*
Tancrède de Lecce* (Tankred von Lecce), illegitimer Cousin Guillaumes
Réginald de Muhec*, normannischer Adliger
Hugues de Lusignan*, Neffe von Guy, Geoffroy und Aimery
Jourdain du Pin*, Gouverneur von Messina
Margaritone (Margaritos von Brindisi)*, Admiral von Tancrèdes Flotte
Berengaria*, Tochter König Sanchos VI.* von Navarra, Richards Verlobte
Zypern
Isaakios Komnenos*, selbsternannter Kaiser von Zypern
Beatrice*, seine Tochter
Im Heiligen Land
Guy de Lusignan* (Guido von Lusignan), König von Jerusalem
Sibylle*, Königin von Jerusalem, Guys Gattin (verstorben)
Isabella von Jerusalem*, Sibylles Halbschwester
Onfroy de Toron*, ihr Ehemann
Conrad de Montferrat* (Konrad von Montferrat), in Italien geborener Herrscher von Tyrus, Cousin des französischen Königs Philippe
Geoffroy* und Aimery* de Lusignan, Guys Brüder
Robert de Sablé*, Großmeister des Templerordens
Garnier de Nablus*, Großmeister des Johanniterordens
Balian d’lbelin*, Herr von Nablus
Renaud von Sidon*
Leopold V. *, Herzog von Österreich
Joscius*, Erzbischof von Tyrus
Saladin*, Al-Malik al-Nasir Salah al-Dīn, Abu’ al-Muzaff ar Yusuf ibn Ayyū, Sultan von Ägypten
Saphadin*, Al Malik al-’Āil, Saif al-Dī AbūBakr Ahmad ibn Ayyū, Bruder Saladins
Maschtub*, Saif al-Dīn ’Alī ibn Ahmad al-Mashtūb, muslimischer Befehlshaber in Akkon
Karakusch*, Bahā’ al-Dīn al Asadī Qara-Qūsh, muslimischer Befehlshaber in Akkon
Renaud de Châtillon*, Edelmann (verstorben)
Abu al-Majd, muslimischer Jüngling in Akkon
William Borrel* und Baldwin Carew*, Johanniter
Ibn an-Nahlal*, Saladins Sekretär
Rashīd ed-Din Sīnān*, der Alte Mann vom Berge
PROLOG
Southampton, November 1189
Tiefe Dunkelheit hüllte das kleine Haus ein, in dessen einzigem Zimmer ich mit Rhys wartete, die Nerven zum Zerreißen gespannt. Schweigend standen wir neben den Angeln der wackligen Haustür an der Wand. Sobald unser Opfer sein Haus betrat, würde es uns erst bemerken, wenn es zu spät war. Den Dolch fest in der Faust, das Auge an einem Loch im Lehmflechtwerk, spähte ich auf die Gasse, atmete langsam und versuchte mich zu überzeugen, dass wir das Richtige taten.
Schon vor einiger Zeit hatte sich die Nacht über den ärmsten Teil der Stadt gelegt, die Sündenmeile. Draußen war nicht mehr viel los. Kurz nach unserer Ankunft hatte der Metzger ein Schwein geschlachtet. Beim schrillen Quieken des Tieres hatte ich die Zähne zusammengebissen, bis es vorüber war. Zwei Nachbarinnen hatten tratschend das Haus passiert, sonst niemand. Unbehagen ergriff mich. Ich konnte nicht sicher wissen, ob mein Opfer, ein Soldat mit schaufelförmigem Bart namens Henry, vor seiner Gattin ankommen würde. Nichts lag mir ferner, als eine Unschuldige in mein finsteres Vorhaben zu verwickeln.
Ich rang um Entschlossenheit. Wenn die Frau auftauchte, würden wir sie fesseln und knebeln, ihr eine Augenbinde anlegen und weiter auf ihren Gatten warten. Ich versuchte, jeden Gedanken an den Säugling, von dem mir berichtet worden war, zu verbannen.
Ich verlagerte das Gewicht und machte kreisende Bewegungen mit den Schultern, um einem Krampf entgegenzuwirken, der sich in meinen Muskeln ankündigte. Mein Blick schweifte durch den Raum. Der matte orangene Schimmer des glimmenden Herds offenbarte zwei Hocker, einen Tisch aus einem Brett auf Böcken, eine Kleidertruhe und in der Ecke ein Strohlager mit Decken. Der Hund, der an der Rückwand angeleint war, machte keinen Laut – er hatte das Brot hinuntergeschlungen, das ich für genau diese Eventualität mitgebracht hatte, und schien nun nichts mehr gegen unsere stille Gesellschaft einzuwenden zu haben.
Ich weiß nicht, wie lange wir so warteten. Mir wurde kalt. Mehr als einmal musste ich, leise wie eine Katze, auf und ab schreiten, damit mir das Blut nicht in den Adern stockte. Rhys rührte sich nicht. Dass er keine Statue war, verriet nur die Bewegung seiner Augen, die mir folgten. Ein treuer Kerl, dachte ich, und es wärmte mir das Herz, dass er mich bei diesem schwierigen Vorhaben unterstützte.
Endlich näherten sich Schritte dem Haus. Ich drückte mich an mein Guckloch. Schwach hoffte ich, sie würden weitergehen.
Sie blieben vor dem Haus stehen.
Ich stieß Rhys an.
Er nickte. Er stand der Tür näher und war aufmerksam und sprungbereit.
Der Haken klirrte, und ich spannte mich an. Mir war es nicht gelungen, ihn von innen in die Öse am Türpfosten zu stecken.
Ein Fluch. »Hat sie schon wieder die Tür offen gelassen.«
Knarrend öffnete sich die Tür nach innen. Der Hund jaulte und zerrte schwanzwedelnd an seiner Leine.
Eine Gestalt schob sich in Sicht. Einen Bart hatte er, aber die Form konnte ich bei dem schlechten Licht nicht erkennen. Rhys sprang vor, schlang dem Mann einen Arm um die rechte Schulter und packte mit der anderen Hand den rudernden linken Arm. Mit gezückter Klinge sprang ich nach vorn. Rhys verlor den Halt um den linken Arm, und ich bekam die Faust des Kerls ins Gesicht. Er traf mich am Jochbein, und Sterne tanzten durch mein Blickfeld. Ich taumelte.
Dem Himmel sei Dank, unser Opfer wehrte sich lautlos, statt um Hilfe zu rufen. Während ich um meine Besinnung kämpfte, stürzten Rhys und er zu Boden, wo sie miteinander rangen. Ein verirrter Tritt traf den Topf, der an einer kurzen Kette über dem Feuer hing. Der Deckel flog herunter, prallte mit einem dumpfen Scheppern von der Wand ab, und heiße Suppe spritzte durch den Raum. Der Hund bellte.
Mein Kopf klärte sich, und ich trieb Henry die Faust in den Magen. Er riss den Mund auf wie ein Fisch im Netz und sackte in Rhys’ Armen zusammen. Rasch schob Rhys ihm die Arme unter die Achseln und verschränkte seine Hände im Nacken des Kerls. Sich aus diesem Griff zu befreien war fast unmöglich, aber dennoch drückte ich dem Mann meine Dolchspitze unter das linke Auge. Seine Brust hob und senkte sich heftig, während er die Waffe anstarrte, dann mich und wieder die Klinge.
»Wenn du schreist, war es das Letzte, was du tust«, zischte ich.
Der Schaufelbart wippte auf und ab. Er nickte verängstigt.
»Du bist Henry, ein Soldat?«
Erneut bekundete er eine Bejahung.
»Kennst du mich?«, fuhr ich ihn an und hielt mein Gesicht direkt vor seine Nase.
Er schüttelte den Kopf, aber in seinen Augen hatte ich das Wiedererkennen zucken sehen. Er log.
»Vor einigen Monaten hast du mit Robert FitzAldelm gesprochen, einem Ritter.« Vor der Krönung war die königliche Gefolgschaft durch Southampton gekommen. Mein Erzfeind hatte den Aufenthalt gut genutzt. Sollte es in meinen Gedanken irgendwelchen Zweifel gegeben haben, wurden sie von der nackten Angst ausgeräumt, die ich Henry ansah. Er war der Mann, den ich suchte. Ich fuhr fort: »FitzAldelm erkundigte sich nach dem Tod seines Bruders, der vor sieben Jahren nicht weit von hier vor einer Schenke gestorben ist.«
In jener Nacht hatte ich Guy FitzAldelm getötet und mir die lebenslange Feindschaft seines Bruders Robert zugezogen. Ich war hier, um sicherzustellen, dass Henry, sein Zeuge, meine Stellung am königlichen Hof nicht bedrohen konnte.
Ich drückte ihm die Dolchspitze in die Haut. »Also?«
»Ich habe mit FitzAldelm gesprochen, jawohl, Messire.«
»Du behauptest, mich – mich – in der Nähe der fraglichen Schenke gesehen zu haben.«
»E-euch, Messire?« Er wich meinem Blick aus.
Ich packte ihn beim Kinn und zwang seinen Kopf nach oben. »So sagt FitzAldelm.«
Sein Blick zuckte zu mir und wieder weg. »Ich habe m-mich geirrt, Messire. Es ist lange her. Mein Gedächtnis ist nicht mehr, was es mal war.«
»Ich bin dir im Leben nicht begegnet, und das wirst du beschwören, wenn dich jemand fragt.«
»Mit Freuden, Messire«, versicherte er. »Mit Freuden.«
»Das soll der Lohn für dein Schweigen sein.« Ich löste den Geldbeutel, der seit London an meinem Gürtel hing, und ließ ihn vor seinen Augen baumeln. »Darin ist dein dreifacher Jahressold.«
Zum ersten Mal sah ich die Spur eines Lächelns. »Kein Wort soll mir über die Lippen kommen, Messire, ich schwöre es bei meiner Seele. Der Satan soll mich holen, wenn ich lüge.«
Der Augenblick war gekommen, der Augenblick, vor dem mir graute, seit ich entschieden hatte, den – von FitzAldelm abgesehen – einzigen Mitwisser zur Strecke zu bringen, der mein verborgenstes Geheimnis kannte oder mutmaßte. Dennoch zögerte ich und richtete meinen Blick auf Rhys. Mit finsterer, misstrauischer Miene sah er mich an, als wollte er sagen: Ich glaube ihm kein Wort. Ich wandte mich wieder Henry zu, der mich gewinnend anlächelte.
Ich dachte an FitzAldelm und seine sengende Bösartigkeit. Er würde nicht einfach hinnehmen, dass Henry seine Haltung geändert hatte. »Du hast Frau und Kind«, sagte ich und dankte Gott, dass sie nicht dabei waren.
Grenzenloser Schrecken trat in sein Gesicht. »Jawohl, Messire. Der Junge ist erst drei Monate alt. Unser Erstgeborener. Sie sind zu Besuch bei ihrer Mutter.«
»Wo ist das?«
»Am anderen Ende der Stadt, Messire.«
»Wann kommen sie wieder?«
»Nicht vor morgen früh, Messire.«
Ich war über alle Maßen beruhigt. »Sind sie dir wichtig?«
»Jawohl, Messire.« Seine Stimme bebte. »Sie bedeuten mir alles. Bitte verletzt sie nicht, ich flehe Euch an!«
Empört begriff ich, dass er mich für fähig hielt, das Leben zweier Unschuldiger zu bedrohen. Ich gelangte zu einer raschen Entscheidung. »Ihnen soll kein Leid geschehen. Das schwöre ich bei Jesus Christus am Kreuze.«
Henry schluchzte vor Erleichterung auf.
Mein Dolch zertrennte Henrys Kehle von links nach rechts.
Seine Augen – vor Schock und Schmerz aufgerissen – suchten meinen Blick. Er konnte nicht sprechen. Ich auch nicht. Warmes Blut spritzte auf mich. Henry versuchte, um sich zu schlagen, aber Rhys hielt ihn fest. Das Leben wich aus ihm, und er sackte zusammen. Als Rhys ihn losließ, fiel er mit einem leisen Poltern zu Boden.
Als ahnte er das Schicksal seines Herrn, jaulte der Hund auf.
Rhys und ich starrten einander über Henrys Leiche hinweg an. Meine Hände zitterten. »Ich habe ihn umgebracht.«
»Das hast du.« Rhys klang nüchtern.
»Ich …« Ich sah auf meine rot befleckten Hände, mein blutgetränktes Hemd. Als ich mich mit dem Finger an der Wange berührte, war sie klebrig. Scham und Schuldbewusstsein befielen mich. »Was habe ich getan?«
»Messire.«
Noch nie hatte mich Rhys so angesprochen. Ich schaute ihm ins Gesicht und erschrak vor der rücksichtslosen Entschlossenheit, die ich dort entdeckte.
»FitzAldelm hätte Henrys Füße ins Feuer gesteckt, wenn er von seinem Wort abgerückt wäre, das weißt du. Henry hätte gesungen wie ein Vogel im Käfig.«
Niedergeschlagen nickte ich.
»Der Beutel Silber war eine Ablenkung. Nichts weiter.«
Ich hörte ihm zu wie ein Kind, das sich eine simple Sache erklären lassen muss.
»Ihn zu töten war die einzige Wahl, die uns blieb.«
Unwahr, dachte ich. Ich hätte nichts unternehmen können. FitzAldelms Versuch, meinen Namen mithilfe von Henrys Aussage zu beschmutzen, hätte scheitern können. Rhys wäre ein glaubhafter Zeuge gewesen, der meine Unschuld bekundete, er war zudem dem König bekannt. Henry hingegen war ein Niemand. Ein Niemand mit einer Frau und einem kleinen Sohn, schrie mich mein Gewissen an.
Von Rhys in die blutige Wirklichkeit zurückgeholt, tat ich, was er befahl. Die Tat sei geschehen, sagte er, und es nütze niemandem, wenn wir uns zu ihr bekannten.
Ich erhob keine Einwände, während wir die größten Blutlachen aufwischten und Henry in die Decke wickelten, die wir auf seinem Strohsack fanden. Dann folgte das Schlimmste, das Warten neben seinem erkaltenden Leichnam, bis wir uns auf die Gasse wagen konnten, ohne gesehen zu werden.
Von der Entsetzlichkeit wie betäubt, überließ ich weiterhin Rhys die Führung. Nie zuvor hatte ich einen Mann in einer Abfallgrube bestattet und war zurückgekehrt, in seiner Ersatzkleidung, um meine eigenen blutigen Sachen zu begraben. Niemals zuvor hatte ich den Hund eines Mannes gefüttert, den ich zuvor ermordet hatte. Ich stand in dem Häuschen und sah zu, wie das Tier einen Brocken Käse verschlang, der auf dem Tisch gelegen hatte.
»Wir müssen gehen.« Rhys, gelassener denn je, war neben mich getreten. »Bald wird es hell.« Er reichte mir meinen Mantel.
Immerhin ein kleiner Lichtblick, dachte ich. Wir hatten unsere Mäntel vor der Tat abgelegt und dadurch unabsichtlich dafür gesorgt, dass unsere Sachen von verräterischen Blutflecken verschont blieben. Ich schwang mir meinen Mantel über die Schultern.
Der Hund war mit dem Käse fertig und sah mich erwartungsvoll an.
Ich musste an Henrys Frau denken. Ihr Mann war tot, und bald würde sie hungern müssen. Mit einem leisen Klirren legte ich den Silberbeutel auf den Tisch. Wenn sie sparsam war, konnte sie länger als drei Jahre lang damit auskommen. Die Münzen würden ihr nicht den Mann zurückgeben, aber es war besser als nichts, versicherte ich mir.
Mit meiner Großzügigkeit minderte ich mein Schuldgefühl jedoch kein bisschen.
ERSTER TEIL
> September 1189 – Juli 1190 <
KAPITEL I
London
Richard sah von dem Dokumentenberg hoch, der vor ihm auf dem Tisch lag. Wie seine mächtige Gestalt auf dem Schemel kauerte, mutete unpassend an, und doch wirkte er in seinem dunkelroten Hemd, den feinen Beinlingen und den Lederstiefeln majestätisch. Schwaches Sonnenlicht fiel durch die Fenster und ließ seine rotgoldene Mähne leuchten. Er runzelte die Stirn. »Bei Gottes Beinen, Rufus, Ihr seht furchtbar aus! Seid Ihr krank?«
Ich zögerte. Seit Henrys Tod plagten mich Schuldgefühle. Nachdem wir den königlichen Auftrag in Southampton erfüllt hatten – wichtige Botschaften Richards an die Kapitäne seiner Schiffe zu überbringen, die dort lagen –, waren Rhys und ich zum Hof zurückgeritten. Nun sahen mich alle an: der König, William Marshal, einer seiner vertrauten Berater, der Justiziar William Longchamp, mein Feind FitzAldelm und mehrere Schreiber. Selbst die Pagen mit den Weinkaraffen an der Wand starrten.
»Mir geht es durchaus gut, Sire, ich danke Euch. Das Wetter taugt schlecht zum Reisen – ich habe mich erkältet.« Ich hustete, glaubhaft, wie ich hoffte.
Zufriedengestellt fragte Richard: »Ihr habt die Briefe übergeben?«
»Das habe ich, Sire, und ich bringe Euch die Antworten der Kapitäne.« Ich reichte die zusammengerollten Pergamente einem Pagen, der mit ihnen zum König eilte.
»Dann legt Euch ins Bett. Es geht nicht an, dass einer meiner besten Ritter krank ist.« Richards Sekretär hatte das erste Siegel gebrochen und entrollte den Brief schon, bereit, ihn dem König vorzulesen.
Seit seiner Krönung im September hatte er sich ausschließlich mit dem Sammeln von Mitteln für seinen lange geplanten Heerzug ins Heilige Land und dessen Planung befasst. Hinter vorgehaltener Hand munkelte man, dass alles im Königreich zum Verkauf stehe: Befugnisse, Grundherrschaften, Grafschaften, Sheriff-Bezirke, Burgen, Städte und Landsitze. Kein Tag verging, an dem sich nicht Barone und Bischöfe in seinem Palast versammelten, um zu bewahren, was sie schon hatten, oder ihre Stellung zu verbessern, indem sie sich neue Titel und Ländereien sicherten.
Dankbar, dass seine Aufmerksamkeit nicht mehr mir galt, murmelte ich meinen Dank und zog mich zurück.
FitzAldelm, jüngst von einem Treffen mit dem neuen Schottenkönig William zurückgekehrt, bedachte mich mit einem Ausdruck purer Tücke. Mein Hass flammte auf, aber nicht wie früher. Als Nächstes überwältigte mich das Schuldgefühl. Ein Mörder, dachte ich. Ich bin ein Mörder. Verdammt war ich zweifach, denn ich hegte nicht einmal den reuigen Wunsch, Henrys Ermordung ungeschehen zu machen, solange nur FitzAldelm keine Grundlage mehr besaß, mich anzuklagen, ich hätte seinen Bruder getötet.
Richard rief mir nach, ich solle mich so lange ausruhen, wie es nötig war.
Ich brauche kein Bett, sondern einen Priester, dachte ich. Meine Tat lastete jedoch so schwer auf meinem Gewissen, dass ich an eine Beichte nicht einmal denken konnte. Die Schuld war mein, und ich verdiente Strafe für das, was ich getan hatte. Eine Strafe, die ich im Stillen erdulden musste.
Im Gegensatz zu mir blieb Rhys von unseren Untaten unberührt, aber er wusste, wie es in mir aussah. Er brachte mich zu einer Taverne in der Sündenmeile, wo er einen Krug Wein nach dem anderen bestellte. Southampton wurde nicht erwähnt. Wir sprachen stattdessen von Outremer – dem Heiligen Land »über dem Meer« – und den Schlachten, die wir dort gewinnen würden. Wir sangen unzüchtige Lieder, die ein Spielmann auf einer Quinterne begleitete. Sie hoben ein wenig meine Stimmung.
Als wir torkelnd zum Palast zurückkehrten, stützte Rhys mich mit seinem starken Arm. Ich erinnere mich nicht, dass er mich zu Bett gebracht hat, aber getan haben muss er es, denn dort kam ich am nächsten Tag mit pochendem Schädel wieder zu mir. Froh, nicht vor den König treten zu müssen – er hatte mir befohlen, gesund zu werden, und gesund war ich nicht –, blieb ich in den Federn und bemitleidete mich selbst. Am Ende ging Rhys die Geduld aus. Er stellte mir einen Nachttopf und einen Krug Wasser ans Bett und überließ mich meinem Elend. Ich fand weder die Kraft noch den Mut, ihn zurückzurufen, geschweige denn, einen Tadel auszusprechen.
Ich sank wieder in Schlaf, um von Henrys letzten Worten geplagt zu werden, die mir endlos durch den Kopf geisterten: Sie bedeuten mir alles. Bitte verletzt sie nicht, ich flehe Euch an! Wieder sah ich ihn in Rhys’ festem Griff, und meine Klinge öffnete ihm die Kehle. Ich fuhr aus dem Schlaf hoch, der Magen drehte sich mir um. Ich stürzte nach dem Nachttopf und entleerte darin das Wasser, das ich unlängst getrunken hatte. Das Gesicht kalt vor Schweiß, Sabber an den Lippen, blieb ich verkrümmt über der Bettseite liegen. Mir war zu erbärmlich, um mich zu bewegen.
Nicht einmal die Schritte, die sich meinem Zimmer näherten, veranlassten mich, den Kopf zu heben. Das muss Rhys sein, dachte ich benommen, oder vielleicht Richard de Drune. Der Soldat war ein weiterer Kamerad und Freund. Er würde einen Scherz machen, und Philip ebenfalls, sollte er es sein, der eingetreten war. Philip diente dem König als Knappe, ganz wie ich früher, und er war mein engster Freund, dem ich mich in fast allem anvertraute. Ich fragte mich, ob ich ihm von Southampton erzählen konnte, aber als ich mir seinen Schock und seinen Abscheu vorstellte, entschied ich mich dagegen. Der Mord an Henry war ein finsteres Geheimnis, das nur mir gehörte – und Rhys.
»Wieder zu viel getrunken?« Ein leises Lachen.
Beatrice riskierte nicht oft, allein in mein Quartier zu kommen, denn wenn sie hier ohne Anstandsdame gesehen wurde, stand ihr Ruf auf dem Spiel. Überrascht hob ich den Kopf. »Madame.« Ich wischte mir den Mund ab und versuchte zu lächeln. »Einen Becher vielleicht, mehr nicht.«
Beatrice hatte kastanienbraunes Haar, eine üppige Figur und ein verschmitztes Lächeln. Sie war die Dienerin einer Hofdame Königin Alienors. Vor zwei Jahren hatte ich begonnen, um sie zu freien. Trotz der Zeiträume, in denen wir getrennt blieben, weil sie mit ihrer Herrin und ich mit dem König unterwegs war, hatten wir unsere Leidenschaft jedes Mal neu entfacht, wenn das Geschick uns wieder zusammenführte. Wir trafen uns heimlich in Ställen und gemieteten Zimmern über Schenken, und dort taten wir alles miteinander, nur lagen wir nicht als Mann und Frau zusammen. Diese letzte Bastion wollte Beatrice nicht aufgeben. »Sobald wir verheiratet sind, Rufus«, sagte sie gern. Dann suchte sie meinen Blick, und ich, Gott vergebe mir, murmelte ihr ins Ohr, dass wir, sobald wir Mann und Frau wären, endlich …
»Rufus?«
Ich hatte kein einziges Wort von dem aufgenommen, was sie sagte. »Madame?«
»Rufus!« Sie stampfte mit dem Fuß auf. Normalerweise fand ich das attraktiv, nun erschien es mir kratzbürstig. »Ihr seid wohl nicht imstande, über ernste Angelegenheiten zu sprechen.«
Ihr Ton erinnerte mich, dass wir in den zurückliegenden Monaten regelmäßig gestritten hatten. Sie war besessen vom Gedanken an die Heirat, und ich hatte mir jede erdenkliche Ausrede einfallen lassen, um der Verpflichtung auszuweichen, denn in meinem Kopf schallte unüberhörbar die schroffe Erkenntnis, dass sie nicht die richtige Frau für mich war.
Ich setzte mich auf und machte ein ernsthaftes Gesicht. »Das bin ich, Madame, ich bitte um Vergebung.«
Besänftigt sagte sie: »Ich sprach davon, dass Ihr bald aufbrecht. Ins Heilige Land.«
Zu meiner Erleichterung ließ die Übelkeit nach. »Spätestens im Frühjahr, aber vermutlich schneller.« Der König sprach davon, Philippe von Frankreich zu treffen, bevor das Jahr zu Ende ging, um mit ihm die Reisen nach Outremer, was jenseits des Meeres bedeutete, zu planen und sich um viele andere Dinge zu kümmern. Waren wir einmal in die Normandie aufgebrochen, war es unwahrscheinlich, dass wir vor der Reise ins Heilige Land nach England zurückkehrten. Dass Königinmutter Alienor sich uns anschloss, stand keineswegs fest.
»Ich würde Euch wenigstens ein Jahr lang nicht wiedersehen. Oder länger.« Ihre Stimme stockte, und das ging mir ans Herz.
»So ist es, Madame.«
»Für Verlobung und Hochzeit wäre noch Zeit.« Kokett fügte sie hinzu: »Als Mann und Frau könnten wir einander endlich kennen.«
»Das könnten wir …« Mit trüben Augen und pelziger Zunge musterte ich sie. So schön sie war, in ihrer Miene lag ein besitzergreifender Ausdruck, der mir nicht gefiel.
»Glaubt Ihr, der König würde kommen?«, fragte sie.
Mein Verstand war noch immer benebelt. »Kommen …«
»Auf unsere Hochzeit!«
Süßer Heiland, dachte ich. Schon zuvor hatte mich der Gedanke beschlichen, dass sie mein Verhältnis zum König und meine Stellung bei Hofe höher schätzte als das, was wir gemeinsam hatten. Ihre Frage bewies meine Vermutung. Mein bevorstehender Aufbruch ins Heilige Land bot mir eine Gelegenheit, unsere Tändelei zu beenden. Der Gedanke daran stach mir ins Herz, aber nicht aus Traurigkeit, sondern aus Erinnerung an Alienor, meine erste Liebe. Ihr hätte ich sofort die Ehe gelobt, ohne nachzudenken, und hätte sie nach meiner Rückkehr aus dem Heiligen Land zur Frau genommen. Leider bestand darauf keinerlei Hoffnung. Vor Jahren hatte sie ihre Herrin, Richards Schwester Matilda, nach Deutschland begleitet, und Matildas Tod in diesem Jahr machte die ohnehin geringe Aussicht, sie jemals wiederzufinden, völlig zunichte.
»Sagt etwas!«
»Beatrice, ich …«
»Wollt Ihr mich etwa nicht heiraten?«
Ich ließ den Kopf hängen, und das war natürlich das Falscheste, was ich tun konnte.
»Nun?« Sie klang gereizt.
Selbst in meinen besten Stunden fiel es mir schwer, mit Beatrice – oder einer anderen Frau – umzugehen, wenn die Gefühle sie beherrschten. Mir dröhnte der Kopf wie eine Trommel, und meine Gedanken überschlugen sich auf der Suche nach einer guten Antwort. Sprach ich die Wahrheit, brach ich ihr das Herz. Auch wenn ich ein Mörder war, schreckte ich davor zurück und zog die sanfte Lüge vor. »Auf nichts könnte ich mehr hoffen, Liebste, aber es besteht durchaus die Möglichkeit, dass ich in der Schlacht falle.«
»Sagt nicht so etwas!« Sie setzte sich neben mich aufs Bett und nahm meine Hand. In ihren Augen standen Tränen.
»Es ist die Wahrheit, Madame.« Und die Wahrheit auszusprechen bestärkte mich in meinem Entschluss, unser Verhältnis zu lösen. Dieser Weg erschien mir vielversprechend. »Ich würde nicht wollen, dass Ihr wenige Monate nach unserer Hochzeit zur Witwe werdet.«
»Andere Ritter heiraten auch, bevor sie aufbrechen!«
Sie hatte recht. Ohne nachzudenken, hätte ich zwei benennen können. Lass es sie bitte akzeptieren, dachte ich. »Stehen sie dem König so nahe? Ihr wisst, was für ein Löwe er in der Schlacht ist, Beatrice. Wo immer der Kampf am dichtesten tobt, wird Richard sein, und das gilt auch für mich. Im Heiligen Land wird der Tod immer an meiner Seite reiten.«
Sie erbleichte. »Ihr macht mir Angst, Rufus. Ersehnt Ihr für Euch den Tod?«
Wie merkwürdig, wenn jemand, ohne es zu ahnen, den Finger fast auf die Wahrheit legt, so grausam sie auch sein mag. »Wenn der Tod mich findet, Madame, werde ich mich ihm stellen.« Nichts anderes habe ich verdient, dachte ich.
»Rufus!« Nun rannen ihr die Tränen über die geröteten Wangen.
»Am besten wäre es, getrennte Wege zu gehen.« Ich tätschelte ihr die Schulter, als sie zu schluchzen begann. Meine Unaufrichtigkeit war mir unangenehm. Ich hätte nicht dankbarer sein können, als de Drune hereinkam.
Beatrice rückte von mir ab. Sie fasste sich, bedachte mich mit einem giftigen Blick und murmelte etwas, dass ich ihre Zeit verschwendete, dann stapfte sie zur Tür.
De Drune stieß einen leisen Pfiff aus. Sein Gesicht war engelsgleich. »Habe ich Euch gestört?«
»In gewisser Weise.« Ich fühlte mich ausgelaugt, verbraucht.
Er reichte mir einen Weinschlauch. »Gegen den Kater.«
Ich stürzte ein gutes Viertel seines Inhalts hinunter, bevor er mich aufhielt. »Der war nicht billig«, beschwerte er sich. »Das ist kein englischer Essig, den man mit geschlossenen Augen und zusammengebissenen Zähnen trinken muss.«
»Ihr verdient, den ganzen Wein zu verlieren, dafür, dass Ihr derart hier hereingeplatzt seid«, knurrte ich in gespielter Verärgerung.
»Woher sollte ich wissen, dass Ihr Hoffnung hattet, das Tier mit den zwei Rücken zu spielen?« Wie Philip wusste auch de Drune von meinem Techtelmechtel mit Beatrice und meiner Erfolglosigkeit beim Überwinden der letzten Hürde.
Ich schnaubte.
»Wäre es dazu gekommen?«
Ich seufzte. »Nein.«
Er zog eine bedauernde Miene. »Was für eine Schande.«
»Eher nicht.« Meine Leidenschaft flaute schneller ab als der Kopfschmerz, und der gesunde Menschenverstand kehrte zurück.
»Inwiefern?«
»Hätte ich je mit ihr gelegen, hätte sie mich endgültig und für alle Zeiten in den Klauen.«
De Drune sah mich forschend an.
»Beatrice wollte, dass wir heiraten. Bevor wir ins Heilige Land ziehen.«
»Und Ihr seid nicht einverstanden.«
Ich schüttelte den Kopf so heftig, wie der Schmerz es zuließ. »Ich hatte es ihr gerade eröffnet, als Ihr hereingekommen seid.«
»Ein weiser Zug. Gott allein weiß, wie lange wir alle fortbleiben.«
»Wenn wir überhaupt zurückkommen.« Ich dachte an Henry und die Erleichterung, die der Tod für mich bedeutete.
Er runzelte die Stirn. »Beschreit es nicht. Ich jedenfalls habe keine andere Absicht, als aus dem Heiligen Land zurückzukehren. Als reicher Mann, wenn Gott es so will.«
Froh über die Ablenkung von meinen düsteren Gedanken fragte ich: »Was werdet Ihr tun?«
»Die Zeit wartet auf niemanden, heißt es.« Er sah mich an. »Ich beabsichtige, mich niederzulassen, vielleicht eine Schenke zu eröffnen.«
Ich grinste. »Mit Freibier für alte Kameraden?«
»Davon war keine Rede.«
Wir lachten, und er erhob keinen Einwand, als ich wieder nach dem Weinschlauch griff.
Wenn Beziehungen zu Frauen nur so einfach wären wie die zu Waffenbrüdern.
Während es auf Weihnachten zuging, setzte Richard seine Vorbereitungen geschwind fort. Immer wieder erstaunte mich sein Auge für die Einzelheiten. Er hatte im Kopf, wo wie viele Hufeisen bestellt worden waren: »Fünfzigtausend aus der Eisenhütte am Wald von Dean«, und wie viele Wagenräder ein anderer Baron versprochen hatte. Von grenzenloser Kraft erfüllt, schritt er auf und ab, wiederholte Listen aus dem Kopf: Zahlen, Namen von Schiffen, die Größe ihrer Besatzungen und die Vorräte, die sie benötigten, während seine Schreiber und Beamten verzweifelt in Schriftrollen und Pergamenten wühlten, um die Angaben zu bestätigen.
Stückchenweise konnte ich den Bedarf des bevorstehenden königlichen Heerzugs verstehen. Einhunderttausend Nägel hier. Zwanzig mal zwanzig Fässer Salzfleisch dort. Zwei Zelter und zwei Lasttiere aus jeder englischen Stadt und halb so viele von jedem Herrensitz. Ein Dutzend Ritter und zweihundert Bogenschützen samt zugehörigen Waffen und Rüstungen von diesem Baron, zehn Ritter und einhundertfünfzig Fußsoldaten von jenem. Eine Zahl blieb mir besonders lange im Gedächtnis: vierzehntausend Pfund Silber, mehr als das halbe jährliche Einkommen Englands, hatte Richard für seine Flotte aus einhundert Schiffen bezahlt. Diese Summe überstieg alle Vorstellungen, aber sie machte mir den Umfang des Unterfangens klar, an dem ich teilnahm, und erhöhte meinen – ohnedies starken – Glauben an unseren Erfolg.
Sein Heer auszurüsten war längst nicht die einzige Sorge Richards. Während seiner Abwesenheit musste das Königreich verwaltet werden. Seine Mutter, Königin Alienor, würde die Angelegenheit beaufsichtigen. Der König traf sich oft mit ihr, und sie nahm an vielen Unterredungen mit seinen Lords und Beratern teil. Wenn es nötig wurde, schaltete sie sich direkt ein – erst jüngst hatte sie verhindert, dass ein unerwünschter päpstlicher Legat ohne Erlaubnis des Königs von Dover auslief –, und sie fungierte als beruhigende Kraft im Hintergrund. Die Mehrheit der Arbeiten erledigten jedoch Richards zwei neue Justiziare. Richard hatte den langgedienten obersten Minister seines Vaters abgelöst und die eigene Autorität gefestigt, indem er Hugh de Puiset, langjähriger Bischof von Durham, und William Longchamp, den Bischof von Ely, zu Justiziaren ernannte.
Eines stürmischen Morgens, mehrere Tage, bevor wir in die Normandie aufbrechen sollten, leistete ich dem König Gesellschaft, der die beiden Justiziare zu sich bestellt hatte. Sie trafen fast gleichzeitig ein, und ihr Auftritt verhieß nichts Gutes. De Puiset, groß und schlank, wollte die Schwelle als Erster überqueren, doch Longchamp, der klein und stämmig war, ebenfalls. Einen Moment lang blockierten sie beide den Eingang und tauschten feindselige Seitenblicke, dann drängte sich Longchamp vor und überließ es de Puiset, ihm wütend hinterherzustarren.
»Seht sie Euch an. Wie zankende Kinder«, sagte Richard.
»Ich fühle mich an meine Brüder erinnert, Sire.« Mir schmerzte das Herz beim Gedanken an meine lange toten Verwandten. Ich sagte mir, dass Guy FitzAldelm, der Mann, der für ihren Tod verantwortlich war und den ich in Southampton getötet hatte, ebenfalls in seinem Grab verschimmelte.
Jetzt ist der falsche Moment, um zu brüten, ermahnte ich mich. Ich musterte die beiden Justiziare. De Puiset beeilte sich, Longchamp einzuholen, damit dieser nicht als Erster vor den König trat. »Sie haben nur wenig füreinander übrig.«
Richard seufzte. »Und doch sollen diese beiden gemeinsam das Reich regieren, solange ich im Heiligen Land bin.«
Ich gab keine Antwort. Mir gebührte es nicht, ein weitergehendes Urteil über Männer abzugeben, die in der Gunst des Königs höher standen als ich.
Richard würdigte die Verneigungen der beiden und wies auf die Schemel, die vor ihn gestellt worden waren. »Zur Sache, meine Herren Bischöfe«, sagte er.
Ich hörte mit mehr als gewöhnlichem Interesse zu. Ihr Gespräch drehte sich keineswegs um Fässer mit Nägeln und Hufeisen, sondern um des Königs Halbbruder Geoffrey und seinen jüngsten Bruder John, der zuvor unter dem Spottnamen »Ohneland« bekannt gewesen war, seit Richards Krönung aber den Titel des Grafen von Mortain in der Normandie trug.
Geoffrey, etwa fünf Jahre älter als Richard, war bis zum Ende seinem Vater Henry II. treu geblieben. Als illegitimer Sohn besaß er keinen Anspruch auf den Thron, und doch, fand ich, wäre es nicht verwunderlich gewesen, wenn Geoffrey Ziele gehabt hätte, die über seinen Stand hinausgingen. Hatte nicht Wilhelm der Eroberer sein Leben als Guillaume der Bastard begonnen?
Mit John war es etwas anderes. Als Richards einziger lebender Bruder stand er dem Thron am nächsten, ein gehässiger, unangenehmer Mensch, der ständig intrigierte und Männern ins Ohr raunte. Ich hatte ihn von dem Moment an verabscheut, als sich unsere Blicke zum ersten Mal kreuzten, und leider war diese Empfindung beiderseits.
Die Angelegenheit war allerdings nicht ganz so schwarz-weiß, wie ich sie sah. Richard war unverheiratet und hatte keine anerkannten Kinder. Für ihn war es vernünftig, Frieden zu John mit der öligen Zunge zu halten, aber wie bei Geoffrey reichte sein Vertrauen – und ganz gewiss meines – zu ihm nicht sehr weit.
Das Gespräch zog meine Aufmerksamkeit wieder auf sich.
»Es mag sein, dass Geoffrey niemals Priester werden wollte, Sire, aber er hat zugelassen, dass man ihn weihte«, sagte Longchamp.
»Unter lautstarkem Protest«, fügte de Puiset hinzu. »Ich glaube mich zu erinnern, wie er einmal sagte, er ziehe Pferde und Hunde den Büchern und Geistlichen jederzeit vor.«
Die Bemerkung amüsierte mich, denn ich empfand genauso.
»Ihr sprecht die Wahrheit«, sagte Richard mit einem gefährlichen Glitzern in den Augen. »Er setzte sich auch einmal den Deckel einer goldenen Schüssel auf den Kopf und fragte seine Freunde, ob ihm eine Krone nicht gut stünde. Es ist gut, dass Geoffrey nun Priester und Erzbischof ist.«
»Dennoch wäre es klug, in Betracht zu ziehen, ihn für die Dauer Eurer Abwesenheit aus England zu verbannen, Sire«, sagte Longchamp.
»Und John? Wäre es richtig, ihm das Gleiche anzutun?«, wollte Richard wissen.
Die Justiziare tauschten einen Blick. Ich entnahm ihren Augen Vorsicht. Richard hatte schon davon gesprochen, auch John zu verbannen, aber seine Frage deutete darauf hin, dass er Zweifel hegte. Nur wenige Männer widersprachen jedoch gern dem König.
»Nun?« Richards Blick schweifte vom einem zum anderen.
»Haben Euch Zweifel beschlichen, Sire?« Geschickt richtete Longchamp die Frage zurück an den König. »Ich frage mich, ob Ihr mit Eurer Frau Mutter schon darüber gesprochen habt.«
»Das habe ich«, gab Richard zu.
De Puiset war ebenfalls von regem Geist. »Mich würde es nicht überraschen, Sire, wenn sie mit der Liebe einer Mutter fände, dass John eine zweite Chance erhalten sollte.«
Richard schnaubte. »Habt Ihr gelauscht?«
»Keineswegs, Sire.« De Puiset lachte höflich, aber er sah erfreut aus.
Longchamp wollte seinem Amtskollegen das Heft des Handelns nicht überlassen. »Vielleicht, Sire, sorgt sich die Königinmutter, was geschehen könnte, sollte Euch – was der Herr verhüten möge – in Outremer etwas zustoßen, und John weilte in der Normandie oder im Anjou statt in England. Ein leerer Thron wäre für viele Männer eine Verlockung.«
Richard lachte leise. »Bei Gottes Beinen, Ihr habt ebenfalls gelauscht! Ich sage Euch aber, auf diesem Heerzug wird mir nichts geschehen.«
Seine Überzeugung war ansteckend, dabei waren die Gefahren und Strapazen, die vor uns lagen, uns allen bewusst: Meeresstürme, Seuchen, Verwundung, Gefangenschaft, sogar Tod. Still bat ich Gott, seine Hand über meinen Herrn und König zu halten.
»Dennoch, Sire, ist es am besten, für alle Eventualitäten zu planen«, sagte de Puiset, und Longchamp bekundete murmelnd seine Zustimmung. De Puiset fuhr fort: »Und sollte Euch doch etwas Schlimmes widerfahren, Sire, wäre Prinz John vermutlich Euer Erbe.«
»Richtig.« Richard runzelte die Stirn. »Trotzdem hat er sich mein Vertrauen nicht verdient. Ich kann aber verstehen, weshalb einige es für weise halten, dass er nach England zurückkehrt, sobald ich aufbreche.«
De Puiset nickte, doch Longchamp blickte weniger zufrieden drein.
Er möchte nicht, dass seine Macht beschnitten wird, dachte ich.
»Ich werde jeden Eurer Wünsche beherzigen, Sire«, sagte Longchamp. »Was immer Ihr entscheidet, fürchtet nichts. Euer Königreich ist in guter Hut.«
»Das freut mich zu hören.« Richards Stimme troff vor Sarkasmus.
Longchamp schenkte ihm ein teigiges Lächeln. De Puisets Gesicht blieb ausdruckslos, aber bei dem Tadel waren seine Augen erfreut aufgeblitzt.
Schweigen setzte ein, das keiner der beiden Justiziare zu brechen entschied.
»Ich werde weiter darüber nachdenken«, erklärte Richard schließlich. »Die Zeit ist noch auf unserer Seite. Ihr dürft gehen.« Er warf einen Blick über die Schulter. »Rufus, lasst uns gemeinsam ausreiten. Mein Kopf ist voller Spinnweben. Nur durch frische Luft bekomme ich ihn wieder klar.«
»Sire.« Ich war erfreut. Ein Berg von Pergamenten harrte der Aufmerksamkeit des Königs, und die Warteschlange aus Adligen und Beamten vor der Audienzkammer zählte wenigstens zwanzig Köpfe. Trübselige Stunden lagen vor uns.
Wir verabschiedeten uns von den Justiziaren und machten uns auf zum Stall. Unsere Destrier benötigten wir nicht, denn wir ritten ungepanzert, aber die Tiere mussten regelmäßig geritten werden. Den ganzen Winter über im Stall zu stehen tue keinem Pferd gut, erklärte Richard, und schon gar nicht den großartigen Tieren, auf denen wir in die Schlacht zogen. Ich nahm Pommers, und der König den Destrier, den er seit dem Tod seines geliebten Diablo ritt. Er war ein kräftiger, feuriger Brauner namens Tempest, der gern jeden biss, der in seine Nähe kam, sei es Mensch oder Tier.
Die Kapuzen unserer Mäntel über die Köpfe gezogen, trabten wir vom frostigen Burghof. Die Wolken unseres Atems zogen hinter uns her, während wir zum Fluss hinunterritten. Rhys und Philip ritten hinter uns auf Oxhead – meinem zweiten Schlachtross – und einem anderen Destrier des Königs. Fußgänger machten uns eilends den Weg frei, und mehr als ein Fluch gellte uns hinterher. Ich hoffte, dass Richard nichts davon hörte. Ich verspürte keine Lust, jemanden dafür zu bestrafen, dass er nicht wusste, wer da an ihm vorbeigeritten war. Er lachte jedoch auf, und ich bemerkte, dass er die allzu seltene Anonymität zutiefst genoss.
Wir ritten schweigend. Ich genoss, nicht sprechen zu müssen, solange der König in nachdenklicher Stimmung war und nichts sagte. Wir folgten dem Fluss dicht am Ufer, näherten uns den Stadtmauern und erreichten bald offenes Land. Wolken jagten über uns hinweg, nur hin und wieder erinnerte ein Aufblitzen von Blau daran, dass die Sonne irgendwo dort oben war. Rauch, der aus dem Dach eines Bauernhauses quoll, wurde weggerissen. Obwohl die Bäume braun und ohne Laub waren, die Hecken von einem gedämpften Grün und die Straße ein Meer aus Schlamm, lag eine Frische in der gelb getönten Winterluft. In der Ferne bellte ein Hund. Dohlen schnatterten und beschimpften einander in einem nahen Wäldchen, und ein Rotkehlchen beobachtete uns aus einem Christdornbusch, der voller Beeren hing. Ein Hase suchte sich einen Weg durch ein Stoppelfeld. Zwei rotwangige Jungen, die Reisig sammelten, winkten uns zu.
»Gut, einmal fern von allem zu sein, Rufus«, sagte Richard. »Ein Tag wie dieser ist Nahrung für die Seele.«
Ich sah ihn überrascht an, denn er wurde nicht sonderlich oft poetisch.
»Im Frühjahr und Sommer fällt es leicht, das Land zu lieben, wenn alles grün ist und blüht, aber auch der Winter hat seine Schönheit.«
»Die hat er, Sire. Ein klirrend kalter Tag wie heute macht die Regentage erträglicher.«
»Erinnert Euch gut daran, denn einen richtigen Winter werden wir so bald nicht mehr sehen, der Herr allein weiß, wie lange nicht.« Richards Stimmung war schon wieder ins Geschäftige umgeschwenkt. »Unser Ausritt muss leider kurz sein. Wenden wir uns dem Wald zu, ehe wir umkehren.«
Wir ritten weiter. Mein Blick kehrte zu dem Hasen zurück, der noch nicht den Rand des Ackers erreicht hatte. »Wenn der Wind nur ein bisschen nachließe, wäre es ein schöner Tag, um einen Falken auf das Tier loszulassen.«
Ein Lächeln. »Ihr werdet einer von uns, Rufus.«
Er hatte nicht beabsichtigt, mich aus der Fassung zu bringen, aber ich drückte mich im Sattel zurück. Mein erzwungener Abschied von Irland lag mehr als ein Jahrzehnt zurück. Ich träumte immer seltener von der Rückkehr. Ich hatte Herr von Cairlinn werden wollen, auf dem Land, das früher meiner Familie gehört hatte, aber dieser Wunsch pochte mir nicht mehr in den Adern wie einst. Ein anderes Schuldgefühl überkam mich. Wie ich lebte, ehrte ich weder Vater noch Mutter, die so heimtückisch ermordet worden waren.
»Ich sagte es nicht, um Euch zu schelten, Ferdia, sondern aus Zuneigung.«
»Jawohl, Sire.« Das ist noch nicht alles, dachte ich, denn er neigte dazu, mich nur dann mit meinem richtigen Namen anzusprechen, wenn er zu etwas Ernstem ausholte.
»Ihr seid mein Gefolgsmann, Ferdia, und Ihr habt auch das Kreuz genommen. Solange Ihr nicht ehrlos seid – und ich weiß, dass das nicht der Fall ist –, gibt es zurzeit keinen Weg für Euch zurück nach Irland.«
Von seinen Worten erschrocken, sah ich ihm in die Augen. »Ihr wusstet, dass ich an Cairlinn dachte, Sire?«
»Die meiste Zeit ist Euer Gesicht wie ein offenes Buch.« Er lachte sein ansteckendes Lachen aus tiefstem Herzen, das aus ihm hervorbrach, wenn er sehr belustigt war.
Ich bemerkte, dass sich meine Wangen röteten, als wäre ich noch immer ein törichter Junge. Ich hatte mich stets bemüht, Richard nachzueifern, der seine Gefühle meisterhaft zu verbergen wusste, aber es war offensichtlich, dass ich noch viel zu lernen hatte.
»Gott hat Euch erschaffen, wie Ihr seid, Ferdia. Das ist nichts Schlechtes.«
Dadurch hat Beatrice mich so mühelos durchschaut, dachte ich verzagt.
»Mein Bruder John, nun, er ist aus anderem Holz geschnitzt.« Richards Stimme hatte einen matten Tonfall angenommen. »Er hat mir ganz wie Ihr Gefolgschaft geschworen. Euch würde ich mein Leben anvertrauen, aber ihm …« Seine Stimme versiegte.
Ich hätte ihm nicht mehr zustimmen können. Für mich war Prinz John eine Schlange.
Der König sah mich fragend an.
Ich zögerte. Hin- und hergerissen, aber gezwungen, auf der Stelle eine Entscheidung zu treffen, schluckte ich meine Meinung hinunter. Meine Abneigung gegen John ist persönlicher Natur, sagte ich mir. Er hat mir nie irgendetwas getan. »Wenn Eure Frau Mutter ihm vertraut, Sire, solltet Ihr es vielleicht auch.«
»Ha! Ich weiß, dass auch sie John nicht vertraut, aber sie findet, er sollte eine zweite Chance erhalten. Mutterliebe, Ferdia. Nichts ist stärker und zuweilen blinder.«
Hätte der König eigene Kinder, dachte ich, wäre John ein geringeres Problem. Das Thema war heikel, denn Richard war seit vielen Jahren mit Philippe Capets Schwester Alys verlobt, schien aber nicht geneigt zu sein, das Verlöbnis je zu erfüllen. »Würdet Ihr heiraten, Sire, und hättet einen eigenen Nachkommen …«
»Bei Gottes Beinen, Ihr seid ja so schlimm wie meine Mutter!«, rief Richard, aber er lächelte dabei. »Doch freilich ist es wahr, ein König braucht eine Frau und, noch wichtiger, einen Erben. Zum Glück hege ich in dieser Hinsicht starke Hoffnungen. Eine Vereinbarung mit einem der nördlichen spanischen Königreiche würde zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, mir eine Frau liefern und mir im Süden einen Verbündeten gegen den Grafen von Toulouse schaffen. Wie ich höre, hat Sancho von Navarra eine Tochter im passenden Alter. Wir werden bald nach Süden reisen und uns mit ihm treffen. So Gott es will, bin ich mit seinem Kind verlobt, ehe wir uns wieder trennen.«
»Und Philippe, Sire?« Ich brauchte den Namen Alys nicht zu nennen.
Er sah mich verschmitzt an. »Mit ihm befasse ich mich, wenn der Heerzug im Gange ist und er keine Möglichkeit hat, sein Versprechen zurückzuziehen und wieder nach Hause zu reisen.«
»Er wird nicht erfreut sein, Sire.«
»Das wird er nicht, aber jeder Mann hat seinen Preis. Ich werde herausfinden müssen, was Philippes Preis ist.«
Ich entschied, dass meine Schwierigkeiten mit Beatrice eine Nichtigkeit waren, verglich ich sie mit den Sorgen des Königs.
»Da ist der Wald«, verkündete Richard. »Wir müssen umkehren.«
»Zu den Büchern und Schriftrollen«, sagte ich matt und wünschte, ich wäre schon in Outremer.
Er lachte leise. »Sie sind eine Plage, das ist wahr. Ich hätte nichts lieber getan, als sie liegen zu lassen und am Tag nach meiner Krönung ins Heilige Land aufzubrechen. Aber im Krieg ist sorgfältige Planung lebenswichtig, wie auch in allem anderen.«
»Lieber stürme ich allein mit der Lanze gegen eine ganze Schlachtreihe von Sarazenen, als dass ich mich mit den Pergamenthaufen auf Eurem Schreibpult befasste, Sire.«
»Mir geht es genauso.«
Ich grinste.
»Wenn der Tag kommt, uns den Türken zu stellen, und dieser Tag wird kommen, dann reiten wir zusammen gegen den Feind.«
Ich sonnte mich in der Gunst des Königs. Den Kopf voller ruhmreicher Schlachtenszenen, vergaß ich Beatrice, FitzAldelm und Henry.
Wichtig war allein der Krieg gegen die Sarazenen.
KAPITEL II
Nonancourt, Normandie, März 1190
Regenspritzer trafen mein Gesicht, als Philip und ich das untere Ende der Stufen erreichten, die zur Wohnhalle hinaufführten, und ich sah zum Himmel. Ich hatte entschieden, dass uns genug Zeit bliebe, um ohne Mantel die Küche zu erreichen. Jetzt war ich nicht mehr so sicher. Eine große schwarze Wolkenbank hing drohend über der Burg, Donner grollte. Von einem Jungen abgesehen, der eilig ein Pferd in den Stall zog, war der Burghof verlassen. Gesichter spähten aus der Schmiede und den anderen Werkstätten und warteten auf das Unwetter.
»Beeilen wir uns«, sagte ich.
Philip brauchte nicht angetrieben zu werden, denn wie ich trug er nur Hemd und Hose. Er lief los, und ich spürte die Herausforderung und rannte ihm hinterher. Binnen eines Herzschlags hatten wir uns in kleine Jungen verwandelt und maßen uns ungezügelt in einem Wettlauf. Dank seines Vorsprungs holte ich Philip nicht mehr ein, und er krähte vor Freude, als er die Küchentür als Erster erreichte. Ich war froh, gerade noch rechtzeitig in den Schutz des Vordachs zu gelangen, als der Himmel seine Schleusen öffnete.
»Du verbringst zu viel Zeit bei Tisch, Rufus, und nicht genug an der Stechpuppe«, sagte er und ging hinein.
Ich schubste ihn. »Du hast geschummelt! Wir sind nicht zugleich losgerannt.«
»Sehe ich da ein Bäuchlein?« Er stieß mir mit dem Finger in die Magengrube.
In der Tat war dort ein bisschen mehr Fleisch als früher. »Ertappt«, knurrte ich und schlang ihm einen Arm um den Hals. »Dir bin ich noch lange gewachsen, du Welpe!«
Lachend befreite er sich von meinem Griff. »Mit einem Schwert vielleicht. In einem Rennen niemals.«
Er hatte vermutlich recht, auch wenn ich es nicht gern zugab. Seit London hatte ich wenig Zeit für Leibesertüchtigung und Waffenübungen gefunden. Als Knappe hatte Philip größere Freiheit, um sich um seine Ausbildung zu kümmern, während ich als enger Gefährte des Königs vom ersten bis zum letzten Tageslicht bei Unterredungen beschäftigt war, Botschaften zu überbringen hatte und Beamten Anweisungen geben musste. Und das war noch nicht alles. Kaum jemals blieben wir irgendwo länger als eine Woche. Wenn ich morgens aufwachte, wusste ich oft nicht, wo ich mich befand. Unter gewöhnlichen Umständen wäre mir dieser beständige Wechsel schon bald zu viel geworden, aber die wachsende Erregung des Hofes über unseren Aufbruch ins Heilige Land war ansteckend.
Am elften Dezembertag hatten wir von Dover aus das Schmale Meer überquert. Weihnachten verbrachten wir bei Burun in der Normandie, eine angenehme Zeit, in der wir zu viel aßen und tranken. Einige Tage danach hatte es jedoch eine angespannte Unterredung mit Philippe Capet gegeben. Beide Könige hatten sich auf einen anhaltenden Frieden geeinigt, der herrschen sollte, solange sie fort waren. Keiner sollte das Territorium des anderen verletzen und jeder auch seine Barone dazu verpflichten. Richard hatte erneut sein Verlöbnis mit Alys bekräftigt, Philippes Schwester, und das erst Tage, nachdem er mir von seinen Plänen erzählte, die Tochter König Sanchos von Navarra zu ehelichen. Er wandelte auf Messers Schneide. Ein falscher Schritt, und der französische Monarch zog sich vielleicht aus dem Heerzug zurück und erklärte stattdessen Richard den Krieg. Richard schien jedoch überzeugt zu sein, dass sein Plan gelingen würde, und ich versicherte mir immer wieder, er wisse es am besten.
An Lichtmess waren wir südlich nach La Réole am Ufer der Garonne gezogen, wo Richard seinen Adligen in der Gascogne erneut den Gefolgschaftseid abnahm. Die geplanten Beratungen über die Absicht des Königs, Berengaria zu heiraten, die Tochter Sanchos VI. von Navarra, waren von Schneefall verhindert worden, der das Pyrenäengebirge unpassierbar machte, aber der Antrag war mit dem Schiff ausgesendet worden. Von La Réole waren wir nach Nonancourt geritten und dort vor zwei Tagen eingetroffen. Richard hatte einen großen Rat einberufen, zu dem seine Mutter Königin Alienor erscheinen sollte, seine Brüder Geoffrey und John, William Longchamp, Hugh de Puiset und eine Vielzahl anderer Bischöfe. Fast jeder war nun hier. Die Wohnhalle war zum Bersten gefüllt. Noch keine Stunde lag es zurück, dass ich die beiden Justiziare beobachtet hatte, wie sie sich stritten. Richards Bedenken, ihnen die Herrschaft über England anzuvertrauen, waren keineswegs verfehlt.
Wir schlängelten uns zwischen den Dienerinnen hindurch, die an den Spülbecken Töpfe und Pfannen schrubbten, und gingen zu den Backöfen. Hier waren wir wohlbekannt, denn wir kamen oft wegen frischen Brotes oder Kuchen. Ich hatte für ständiges Willkommen gesorgt, indem ich jedem Koch am Tag unserer Ankunft ein paar Silberpennys in die Hand gedrückt hatte. Wir erhielten Pasteten mit Huhn und Rosinen und zogen uns neben den Eingang zurück, um beim Essen in den Regen zu blicken.
Eine mit einer Kapuze verhüllte Gestalt stieg die Treppe herab. Auf der vorletzten Stufe riss ein Windstoß die Haube zurück und entblößte für einen Augenblick den kantigen Schädel FitzAldelms. Statt zur Küche zu gehen, schob er sich jedoch durch einen Eingang, der in den Keller unter der Wohnhalle führte. Dort wurden Wein, Lebensmittel und Material gelagert, außerdem gab es Zellen, die als Kerker dienten. Wie seltsam, dass FitzAldelm bei diesem Wetter den Donjon verließ und es riskierte, durchnässt zu werden. Jeder sonst hätte die innere Treppe in der Wohnhalle genommen. Ich erwähnte es Philip gegenüber, der mir zustimmte.
»Gehen wir und schauen nach«, schlug er vor.
Gerührt, denn FitzAldelm war nur sein Feind, weil er meiner war, fasste ich dankend nach seinem Oberarm. »Wenn er mich dort sieht, wüsste er, dass ich ihm nachspioniere.«
»Während ich als Knappe aus einer Vielzahl von Gründen dort sein könnte.« Philip zwinkerte, schob sich den letzten Bissen Pastete in den Mund und eilte in den Regen.
Lange dauerte es nicht, und der Wolkenbruch, der den Burghof in eine Pfützenlandschaft verwandelt hatte, war vorüber. Ich hielt mich dicht an der Mauer und erreichte die Treppe mit trockenen Füßen. An der nahen Abtei läuteten die Glocken zur Terz. Ich eilte hinauf, nahm zwei oder drei Stufen auf einmal. Ich hatte viel zu tun, bevor der von Richard einberufene Rat beginnen konnte, genug, um meine Gedanken von FitzAldelm und seinen Teufeleien abzulenken.
Die Wohnhalle war leer geräumt, alle Tische von Dienern an die Seitenwände gerückt worden. Nur noch eine lange Tafel stand im Zentrum des Saals. Kissen auf den Bänken bedeuteten, dass Angehörige des Königshauses und Bischöfe nicht auf hartem Holz zu sitzen brauchten. Frische Binsen, mit getrockneten Kräutern versetzt, bedeckten den Fliesenboden. Im großen Kamin loderte ein Feuer und hielt alle nahe Sitzenden angenehm warm, vielleicht sogar zu warm. Wer ferner saß, würde die Zugluft spüren. Der Wind ratterte an den geschlossenen Fensterläden, und jedes Mal, wenn die Tür am anderen Ende des Saals geöffnet wurde, traf uns ein Schwall kalter Luft.
Fast jeder war hier. Richards Platz war leer, denn er schritt auf und ab mit Henri de Blois, dem Grafen der Champagne, einem jungen Mann mit hellen Haaren, der in der merkwürdigen Position war, sowohl Richards als auch Philippe Capets Neffe zu sein. Liebenswert und lustig, wirkte er wie ein netter Kerl, und der König mochte ihn. Henri sollte in den nächsten Tagen ins Heilige Land aufbrechen. Seine Aufgabe bestand darin, bei der Belagerung von Akkon zu helfen, der Küstenstadt, die vor fast drei Jahren an die Sarazenen verloren gegangen war. Wie beinahe alle christlichen Festungen war sie kurz nach der verlustreichen Schlacht bei den Hörnern von Hattin gefallen.
Auch für Richards Mutter und Alys, seine Verlobte, waren Plätze frei gehalten, gleich rechts vom König.
Unaufdringlich wartete Philip einige Schritte hinter ihnen. Neben den leeren Plätzen saß Geoffrey, der Halbbruder des Königs und Erzbischof von York. Er war in ein Gespräch mit den Herzögen von Norwich, Bath und Winchester vertieft und übersah angelegentlich Hugh de Puiset, den Bischof von Durham, der ihm gegenübersaß. Dieser wiederum gab vor, den Kanzler William Longchamp, Bischof von Ely und sein Mit-Justiziar, nicht zu sehen, der gleich neben Bischof Hubert von Salisbury saß und mit William Marshal und dessen Bruder John sprach.
Die Gegenwart so vieler hochrangiger Geistlicher rieb den Schorf von der schwärenden Wunde auf meiner Seele. Ich hatte erwogen, den Mord an Henry bei einem der Bischöfe zu beichten, den Gedanken aber rasch von mir gewiesen. Meine Bußfertigkeit mochte einen Kleriker überzeugen, aber Gott würde mich als Heuchler erkennen. Von meiner Erbärmlichkeit lenkte ich mich ab, indem ich erneut die Anwesenden musterte.
Den Sitz links von Richards Platz nahm Prinz John ein, sein Bruder und Graf von Mortain. John blieb für sich selbst und nippte oft aus seinem Becher, während sein Schlangenblick über die Versammelten glitt. Den Bischof neben ihm schien es nicht zu stören, nicht beachtet zu werden, stattdessen sprach er mit seinen Mitgeistlichen und den Baronen an der gegenüberliegenden Tischseite.
John erinnerte mich an FitzAldelm, und ich lenkte meinen Blick beiläufig auf meinen Erzfeind. Wie ich stand er mit Baudouin de Béthune, André de Chauvigny und einer Gruppe von Hausrittern und Beamten hinter dem Platz des Königs, und das in gebührendem Abstand. Wir durften Zeuge der Beratung werden, aber nicht an ihr teilnehmen. FitzAldelm sprach mit Odo de Gunesse, einem seiner Kumpane in Richards Diensten. De Gunesse war charmant und ein guter Kämpfer, was erklärte, weshalb Richard ihn aufgenommen hatte, aber er war auch verschlagen wie ein Fuchs, und ich bezweifelte, dass der König diese Seite seiner Persönlichkeit je bemerkt hatte. Mir war sie nur bekannt, weil ich einmal belauscht hatte, wie FitzAldelm mit ihm sprach. Für mich bestand kein Zweifel, dass de Gunesse auch zu einem Mord fähig gewesen wäre.
Die Tür zum Privatgemach an der Stirnwand des Saals wurde geöffnet. Ein Vogt trat hindurch und rief mit lauter Stimme: »Königin Alienor!« Er kündete auch Alys an, Schwester von Philippe Capet.
Ihre Verlobung mit dem König wurde nicht erwähnt, eine Einzelheit, die mir auffiel. Bevor er Berengaria heiraten konnte, musste er das zwanzig Jahre bestehende Verlöbnis mit Alys lösen, eine dornige Angelegenheit, bei der Krieg mit Frankreich drohte. Diese rechtliche Zwickmühle, hatte ich Richard gegenüber de Chauvigny erwähnen hören, war der Grund, weshalb er so viele Bischöfe zu dem Rat geladen hatte. Um sein Dilemma zu lösen, musste jeder Aspekt dynastischer Heirat und die anwendbaren Bestimmungen des Kirchenrechts erörtert werden. »Sie bleiben am Tisch, bis ich bekomme, was ich will«, hatte der König erklärt. Alys’ Gefühle erwähnte er nicht, aber ich wusste, dass sie nach ihrer Ankunft miteinander gesprochen hatten. Ich beneidete sie nicht um ihre Stellung als Bauer im Spiel zweier Könige.
Alle am Tisch erhoben sich. Richard eilte herbei, um seine Mutter zu ihrem Sitz zu geleiten. Alys, die schüchtern Alienor folgte, bedachte er mit einem leisen Gruß. Wir verneigten uns alle, als die Königin uns erreichte, in einem dunkelgrünen Kleid, die Frisur in ein zart gesponnenes goldenes Haarnetz gehüllt. Trotz ihres Alters war sie eine Schönheit, Gestalt gewordene Würde und Anmut, und sie lächelte, während der König ihr sorgsam das Sitzkissen zurechtrückte. Die gleiche Aufmerksamkeit schenkte er Alys, die hübsch, aber reserviert war in ihrem himmelblauen Kleid. Ich fragte mich, ob die Gerüchte stimmten, sie habe eine Affäre mit dem Vater des Königs gehabt, als Henry II. noch lebte.
Richard nahm selbst Platz und begann ohne Umschweife. Es gebe viel zu bereden, sagte er, aber zunächst würde er sich den dringlichsten Angelegenheiten zuwenden.
»Seit meiner Abreise aus England scheint es, dass meine Justiziare, selbst wenn sie einander nicht an die Kehle fuhren, doch zutiefst uneinig wären.« Er sah de Puiset an, dann Longchamp. Ersterer errötete, Letzterer jedoch wirkte ungerührt.
Er weiß, was bevorsteht, dachte ich. Richard hat es ihm gesagt.
»Was den einen von Euch erfreute, sagte man mir, erboste stets den anderen«, fuhr Richard fort.
De Puiset hüstelte. »Es ist richtig, wenn Ihr sagt, Sire, dass wir uns nicht in vielem einig waren.«
Richards Blick schwenkte zu Longchamp.
Glatt wie Öl sagte der Kanzler: »Ich war mit etlichen von de Puisets Plänen einverstanden, Sire, wohingegen er …« Als Richard die Hand hob, verstummte er.
»Mir fehlen Zeit und Geduld, auch nur einen von Euch anzuhören. Wenn die Dinge so stehen, obwohl ich nur das Schmale Meer überquere, graut mir bei dem Gedanken, was geschehen mag, sobald ich das Heilige Land erreiche. Von diesem Tag an soll die Regentschaft über mein Königreich zweigeteilt werden. Ihr, de Puiset, sollt Justiziar über die Lande nördlich des Humbers bis zur schottischen Grenze sein. Longchamp, Ihr sollt über den Rest Englands gebieten.«
Während Longchamp grinste wie eine Katze, der man eine Schüssel Sahne hinstellt, und seine Dankbarkeit bekundete, lief de Puiset tiefrot an. »Habe ich Euch missfallen, Sire, dass Ihr mich bestrafen wollt mit dieser Aufgabe?« Das letzte Wort ließ er klingen wie einen Kraftausdruck.
»Möchtet Ihr sagen, dass Ihr sie nicht wollt?«
Auf dem falschen Fuß erwischt, stammelte de Puiset: »N-nein, Sire!«
»Dann nehmt, was Euch gegeben wird, und seid dankbar.«
Machtlos angesichts königlicher Autorität murmelte de Puiset seinen Dank. Longchamp bedachte er mit einem mordlustigen Blick.
Des Kanzlers Stern setzte seinen Aufstieg fort, als Richard erklärte, dass an Papst Clemens Botschaften gesendet würden, in denen er gebeten wurde, Longchamp zum Legat von England und Schottland zu ernennen, der höchsten verfügbaren Kirchenstellung. Der König befahl Longchamp ferner, den Tower von London mit einem tiefen Burggraben zu umgeben, um seine Befestigung zu verstärken.
Die Aufmerksamkeit verlagerte sich zu Geoffrey, Richards Halbbruder, und der König gebärdete sich noch schroffer. Das überraschte mich nicht. Erst vor wenigen Monaten, am Vorabend unseres Aufbruchs von England, hatte er einen bitteren Disput zwischen Geoffrey, de Puiset und mehreren anderen Bischöfen und hohen Kirchenbeamten auflösen müssen. Seit Weihnachten setzte sich der Streit fort und erzürnte den König so sehr, dass er Geoffrey einige Ländereien entzogen hatte.
»Wenn es jetzt um das Geld geht, das ich dir schulde …«, setzte Geoffrey an.
»Darum geht es nicht«, schnitt Richard ihm das Wort ab. »Leider lässt es sich anders nicht sagen, Geoff. Ich möchte, dass du einen Eid auf die heiligen Evangelisten ablegst, für die nächsten drei Jahre keinen Fuß auf englischen Boden zu setzen, es sei denn mit meiner Erlaubnis.«
Geoffrey spie fast den Wein aus, den er im Mund hatte.





























